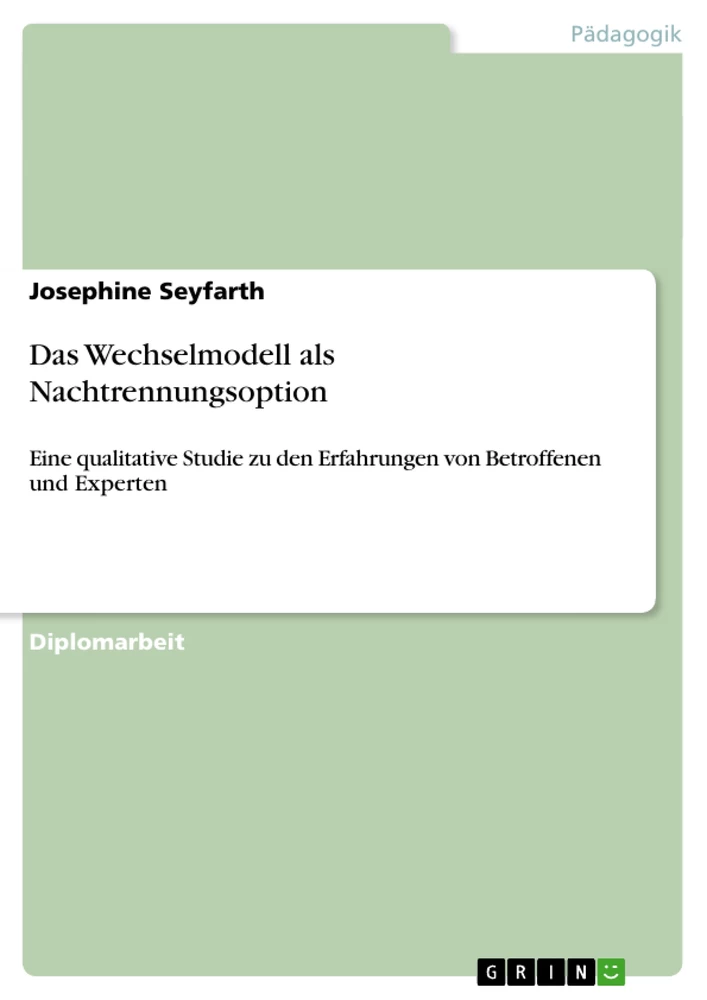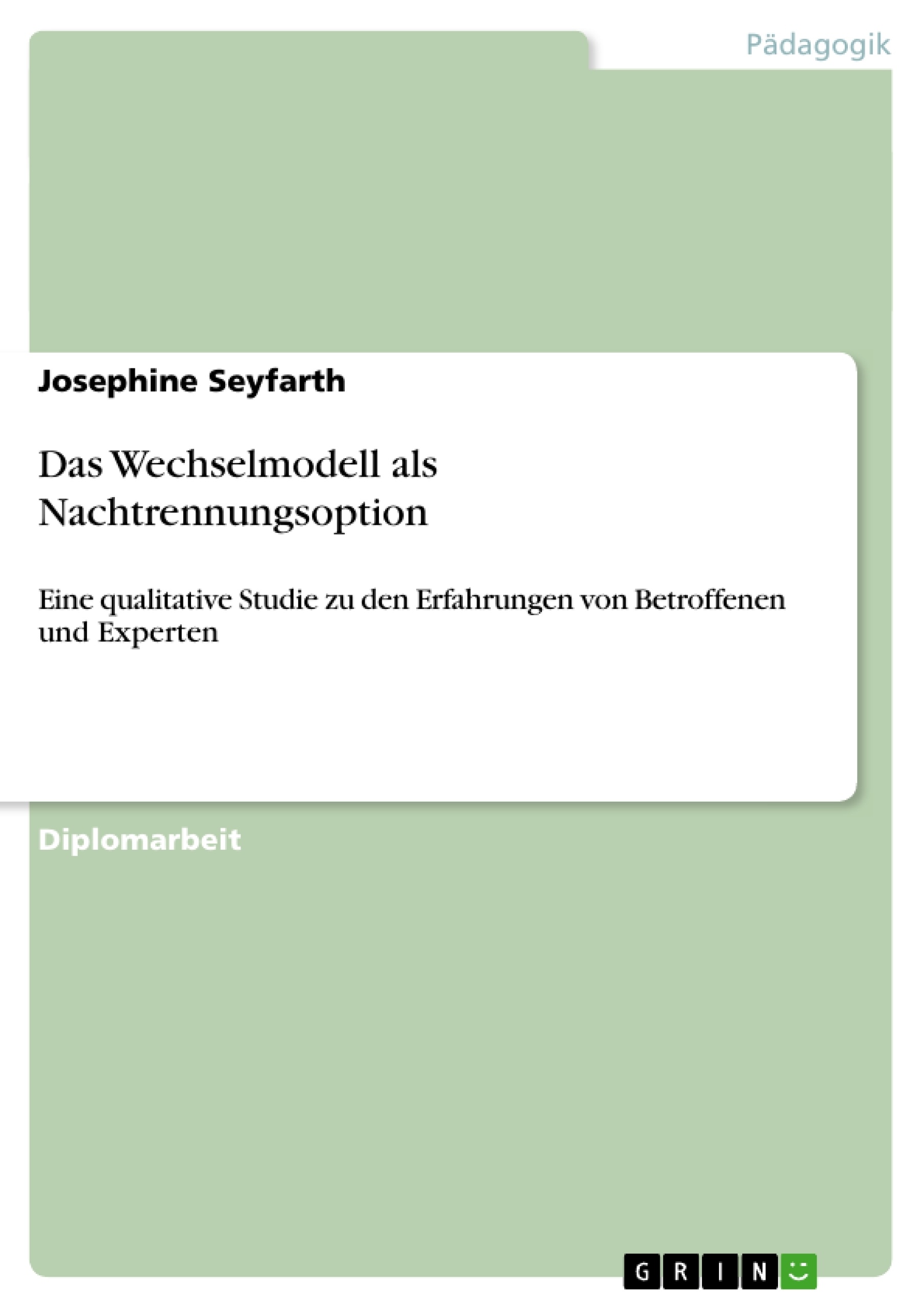„Und dabei liebe ich euch beide“ lautet der Titel des Liedes von Andrea Jürgens, welches 1977 veröffentlicht wurde. Die damals Zehnjährige verarbeitete mit diesem Lied die Trennung ihrer Eltern. Sie schildert, dass sie zweimal im Monat ihren Vater sieht, wahrscheinlich alle zwei Wochen am Wochenende. Den größten Teil der Zeit lebt sie demzufolge bei der Mutter. Weiterhin wird deutlich, dass die Eltern kein gutes Verhältnis zueinander haben. Andrea wünscht sich mehr Zeit mit dem Vater, da sie beide Eltern liebt. Ihre Mutter verbietet dies aber, sie hält den Vater vom Kind fern. Das Mädchen wünscht sich, dass die Familie wieder vereint wird, auch wenn dies nur kurzzeitig der Fall ist. Der Wunsch des Kindes, selbst entscheiden zu können, bei wem es sein kann, bildet den Refrain und somit die Kernaussage des Liedes. Die Mutter stellt das Verhalten vieler Mütter dar, bei ihr ist das Kind, sie hat die Macht zu entscheiden, wie oft der Vater das Kind sehen kann. Die Väter haben oftmals keine Chance sich aktiv am Familienleben zu beteiligen.
Wie bereits erwähnt, wurde das Lied 1977 bekannt gemacht, aber selbst 37 Jahre später ist dieses Thema immer noch aktuell. Auch heute noch trennen sich Eltern, was schmerzhaft für die Kinder ist. Schlimmer ist jedoch, dass der größte Anteil der Kinder bei einem Elternteil weiterlebt und zum anderen kaum bis gar kein Kontakt besteht. Der Wandel der Gesellschaft birgt eine Zunahme von Scheidungen bzw. Trennungen in sich. Die Leidtragenden sind die Kinder, da sie nicht in einer kompletten Familie aufwachsen können. Oftmals haben sie nur einen Elternteil, der sie während ihrer Entwicklungen in Kindheit und Jugend begleiten bzw. unterstützen kann. Die Trennung oder Scheidung von Eltern bedeutet das Ende der Paarbeziehung, jedoch nicht die Auflösung von Mutter- und Vaterrolle. Die Eltern sind in der Pflicht, weiterhin die Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen.
Eine Option, Familienleben nach der Trennung der Eltern zu gestalten, ist das Wechselmodell. Hierbei verbringt das Kind weiterhin gemeinsam Alltag mit den Eltern, indem es in einem zuvor festgelegten Rhythmus zwischen den Haushalten pendelt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theoretischer Teil
- 1. Ehe, Trennung und Scheidung
- 1.1 Definitionen und rechtliche Grundlagen
- 1.2 Aktuelle statistische Daten und Trends
- 1.3 Folgen von Trennung und Scheidung
- 1.4 Nachtrennungsfamilien
- 2. Wechselmodell
- 2.1 Merkmale
- 2.2 Forschungserkenntnisse und Folgen der Betreuung
- 2.3 Voraussetzungen und Kontraindikationen
- 2.4 Vorteile
- 2.5 Nachteile
- 2.6 Exkurs: Internationale Verbreitung
- 3. Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien
- 1. Ehe, Trennung und Scheidung
- II. Empirischer Teil
- 4. Vorbereitung und Durchführung der Interviews
- 5. Ergebnisse
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Wechselmodell der Kinderbetreuung nach Trennung der Eltern. Ziel ist es, die Erfahrungen von Betroffenen (Eltern und Kinder) und Experten mit diesem Modell qualitativ zu erforschen. Die Arbeit beleuchtet die praktischen Auswirkungen des Wechselmodells und analysiert die Faktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg beitragen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen und soziodemografische Aspekte des Wechselmodells
- Erfahrungen von Eltern und Kindern mit dem Wechselmodell
- Kommunikation und Kooperation der Eltern im Kontext des Wechselmodells
- Faktoren, die das Gelingen des Wechselmodells beeinflussen
- Rolle von Beratungsstellen bei der Einführung und Begleitung des Wechselmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Wechselmodells als Betreuungsoption nach Trennung ein und skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas und die Forschungslücke, die diese Arbeit adressiert.
1. Ehe, Trennung und Scheidung: Dieses Kapitel liefert einen theoretischen Überblick über Ehe, Trennung und Scheidung. Es definiert relevante Begriffe, beleuchtet rechtliche Grundlagen wie das gemeinsame Sorgerecht und Umgangsrecht, und präsentiert aktuelle statistische Daten zu Eheschließungen und -scheidungen in Deutschland. Besonderes Augenmerk liegt auf den psychosozialen und finanziellen Folgen von Trennung und Scheidung für Eltern und Kinder, sowie auf Risiko- und Schutzfaktoren. Der Abschnitt über Nachtrennungsfamilien bildet einen wichtigen Übergang zum Thema Wechselmodell.
2. Wechselmodell: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Wechselmodell der Kinderbetreuung. Es definiert das Wechselmodell, beschreibt verschiedene Wechselrhythmen und relevante rechtliche Regelungen. Es analysiert Forschungsergebnisse zu den Folgen verschiedener Betreuungsmodelle für Kinder und Eltern, sowie die Voraussetzungen und Kontraindikationen für die erfolgreiche Implementierung eines Wechselmodells. Vorteile und Nachteile werden detailliert erörtert, einschließlich eines Exkurses zur internationalen Verbreitung des Modells.
3. Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien: Dieses Kapitel beschreibt die Rolle von Beratungsstellen in der Unterstützung von Trennungs- und Scheidungsfamilien. Es definiert Beratungsstellen, beleuchtet ihre rechtlichen Grundlagen und das Angebotsspektrum. Es analysiert die Anforderungen an Berater, die mit Trennungsfamilien arbeiten und die spezifische Unterstützung bei der Installation und Begleitung eines Wechselmodells.
4. Vorbereitung und Durchführung der Interviews: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der Studie. Es erläutert die gewählte qualitative Forschungsmethode, die Auswahl der Interviewpartner (Eltern, Kinder und Experten), den Ablauf der Interviews und die anschließende Datenverarbeitung. Die Kapitel beschreibt auch die methodischen Grenzen der Studie.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Es analysiert die Einflussfaktoren auf die Entscheidung für ein Wechselmodell, den Ablauf des Modells in der Praxis, die Kommunikation und Kooperation der Eltern, die Gefühle und Wünsche der Kinder und Eltern sowie die Vorteile und Nachteile aus Sicht der Beteiligten. Besondere Aufmerksamkeit wird den Bedingungen für das Gelingen des Modells und den Meinungen von Dritten gewidmet.
Schlüsselwörter
Wechselmodell, Trennung, Scheidung, Kinderbetreuung, Eltern, Kinder, gemeinsames Sorgerecht, Umgangsrecht, qualitative Studie, Interviews, Beratungsstelle, Kooperation, Kommunikation, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Patchworkfamilie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wechselmodell der Kinderbetreuung nach Trennung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht qualitativ das Wechselmodell der Kinderbetreuung nach Trennung der Eltern. Sie erforscht die Erfahrungen von betroffenen Eltern und Kindern sowie von Experten mit diesem Modell und analysiert Faktoren, die zu dessen Erfolg oder Misserfolg beitragen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt rechtliche Rahmenbedingungen und soziodemografische Aspekte des Wechselmodells, die Erfahrungen von Eltern und Kindern, die Kommunikation und Kooperation der Eltern, Einflussfaktoren auf das Gelingen des Modells, und die Rolle von Beratungsstellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst Kapitel zu Ehe, Trennung und Scheidung, zum Wechselmodell selbst, und zur Rolle von Beratungsstellen. Der empirische Teil beschreibt die Durchführung der Interviews und präsentiert die Ergebnisse.
Wie ist der theoretische Teil aufgebaut?
Der theoretische Teil beginnt mit Definitionen und rechtlichen Grundlagen von Ehe, Trennung und Scheidung, inklusive statistischer Daten und Folgen für Familien. Es folgt eine detaillierte Betrachtung des Wechselmodells: Merkmale, Forschungsergebnisse, Voraussetzungen, Vorteile, Nachteile und internationale Verbreitung. Schließlich wird die Rolle von Beratungsstellen für Familien beleuchtet.
Wie ist der empirische Teil aufgebaut?
Der empirische Teil beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie (qualitative Interviews), die Auswahl der Interviewpartner und die Datenanalyse. Die Ergebnisse der Interviews werden präsentiert und analysiert, mit Fokus auf Einflussfaktoren, Kommunikation, Gefühle der Beteiligten und Bedingungen für das Gelingen des Wechselmodells.
Welche Methodik wurde verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, basierend auf Interviews mit Eltern, Kindern und Experten. Die Methodik und ihre Grenzen werden im entsprechenden Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse analysieren die Einflussfaktoren auf die Entscheidung für ein Wechselmodell, den Ablauf in der Praxis, die Kommunikation und Kooperation der Eltern, die Gefühle und Wünsche der Kinder und Eltern, sowie die Vorteile und Nachteile aus Sicht der Beteiligten. Besonderes Augenmerk liegt auf den Bedingungen für das Gelingen des Modells.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wechselmodell, Trennung, Scheidung, Kinderbetreuung, Eltern, Kinder, gemeinsames Sorgerecht, Umgangsrecht, qualitative Studie, Interviews, Beratungsstelle, Kooperation, Kommunikation, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Patchworkfamilie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Erfahrungen von Betroffenen (Eltern und Kinder) und Experten mit dem Wechselmodell qualitativ zu erforschen und die praktischen Auswirkungen sowie Faktoren für Erfolg oder Misserfolg zu analysieren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Eltern, die sich einer Trennung oder Scheidung gegenüberstehen und über Betreuungsmodelle nachdenken, für Fachkräfte in der Familienberatung und im Rechtsbereich, sowie für Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Familienrecht und Kindeswohl befassen.
- Quote paper
- Josephine Seyfarth (Author), 2014, Das Wechselmodell als Nachtrennungsoption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283938