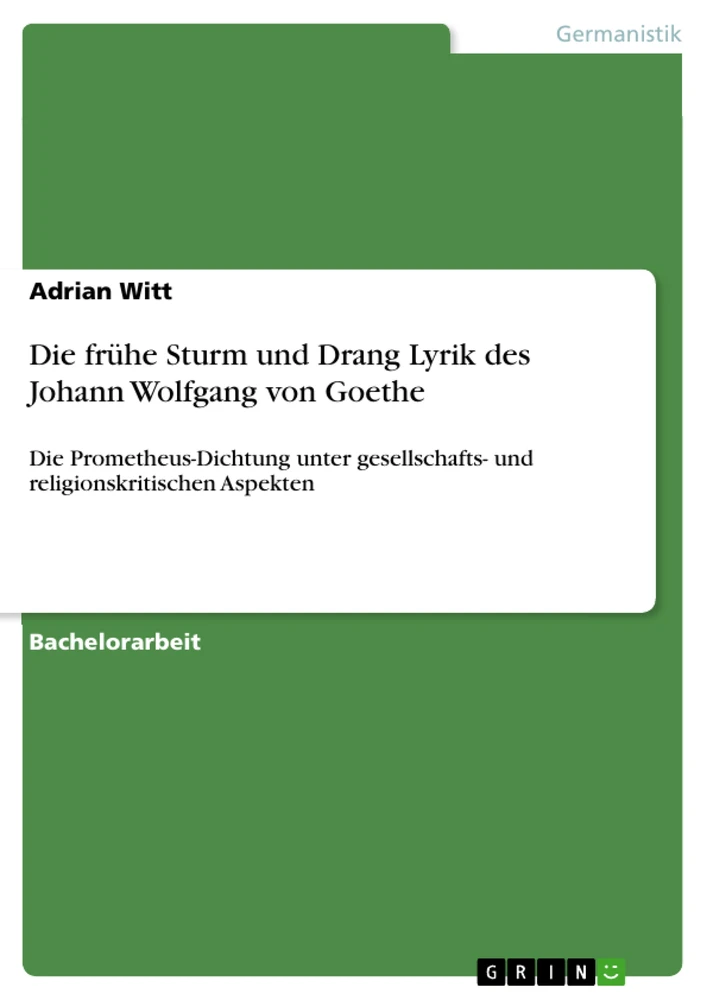Bereits seit tausenden von Jahren sind die verschiedensten Mythen und Sagen in den unterschiedlichsten Kulturen der Menschheit von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung und haben dabei nicht nur einen großen Einfluss auf das kollektive Bewusstsein der Menschen genommen, sondern wurden im Laufe der Geschichte selbst zum festen Bestandteil des menschlichen Selbstverständnisses. Die dadurch von den Mythen und Sagen ausgehende Besonderheit zeigt sich insbesondere in deren Funktion als vermeintliche Wissensträger, um entweder historische Begebenheiten näher zu erläutern oder auf all jene offenstehenden Fragen eine möglichst genaue Antwort zu finden, für dessen eindeutige Beantwortung der Menschheit das Verständnis und auch das dafür notwendige Wissen fehlt. Mit dem Versuch der Menschen der unterschiedlichsten Kulturen das eigene Welt- und Selbstverständnis zum Ausdruck zu bringen, haben sich mit der Zeit grundverschiedene Mythen herausgebildet, von denen die Schöpfungsmythen in der gesamten Menschheitsgeschichte eine besondere Relevanz für die Menschen eingenommen haben. Viele dieser Mythen blieben dabei im Laufe der Geschichte nicht nur auf einen rein religiösen Kontext beschränkt, sondern haben ihrerseits Einfluss auf die unterschiedlichsten Künste genommen oder fanden durch ihren inspirierenden Charakter immer wieder als Themenstoff eine schriftbezogene Verwendung. Doch nur die wenigsten der auf die Schöpfung eingehenden Mythen konnten in den einzelnen Epochen eine immer wiederkehrende Resonanz bei den Zeitgenossen hervorrufen, wie dies insbesondere der Prometheus-Sage als Bestandteil der griechischen Mythologie gelang. Dabei hat die Auseinandersetzung mit dem Prometheus-Stoff eine äußerst lange Tradition vorzuweisen. Gehört doch die mythologische Gestalt des Prometheus zu den bedeutendsten Figuren der okzidentalen Literaturwissenschaft, deren Ursprünge im geschichtlichen Dunkel des griechischen Altertums zu finden sind. Die lange und wechselvolle Rezeptionsgeschichte der Prometheus-Sage reicht dabei von der griechischen Antike, deren ältesten Ansätze aus den Werken Theogonie und Werke und Tage des Hesiod stammen, bis in die jüngere Vergangenheit der Neuzeit, durch Mary Shelley oder Heiner Müller geprägt, und ist wie kaum eine andere in unserem kulturellen Gedächtnis verankert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die epochale Zuordnung
- Die Epoche der Aufklärung
- Die Sturm und Drang Strömung
- Der Geniegedanke im Sturm und Drang
- Das neue Selbstverständnis des Dichters
- Das zentrale Begriffspaar - Nachahmung und Schöpfung
- Goethes Prometheus-Dichtung im Kontext des Sturm und Drang
- Das Verständnis von Religion und Wissenschaft im 18. Jahrhundert
- Prometheus in seiner mythologischen Gestalt
- Begriffsklärung Mythos
- Die antike Gestalt des Prometheus als Teil der griechischen Mythologie
- Das Fehler einer Einheitsbezeichnung für die Prometheus-Dichtung Goethes
- Die Prometheus-Dichtung von Johann Wolfgang von Goethe
- Die formale Gestaltung der Dichtung im Zeichen des Sturm und Drang
- Interpretation der Dichtung unter religionskritischen Aspekten
- Interpretation der Dichtung im Kontext des neuen Geniebewusstseins
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Prometheus-Gedichts von Johann Wolfgang von Goethe für die Sturm und Drang Strömung. Die Zielsetzung besteht darin, den Einfluss dieses Gedichts auf die literarische Strömung des Sturm und Drang zu analysieren und zu verstehen, wie sich das Werk in den Kontext der Epoche einordnen lässt.
- Die Epoche der Aufklärung und ihre Bedeutung für die Entstehung des Sturm und Drang
- Das neue Geniebewusstsein und das Selbstverständnis des Dichters im Sturm und Drang
- Die Rolle des Prometheus-Mythos in der Literatur und seine Bedeutung für Goethes Gedicht
- Die formale Gestaltung und die inhaltlichen Aspekte des Prometheus-Gedichts
- Die religionskritischen Aspekte und die Kritik an Autoritäten im Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz des Prometheus-Mythos in der Geschichte und Literatur dar und führt das Gedicht von Goethe als einen bedeutenden Ausdruck der Sturm und Drang Strömung ein.
- Kapitel 2 ordnet das Gedicht in die Epoche der Aufklärung ein und beleuchtet den Einfluss dieser Epoche auf die Entstehung des Sturm und Drang.
- Kapitel 3 fokussiert auf die literarische Strömung des Sturm und Drang, die sich durch ihre Rebellion gegen bestehende Autoritäten und die Betonung von Individualität und schöpferischer Kraft auszeichnete.
- Kapitel 4 beleuchtet das Verständnis von Religion und Wissenschaft im 18. Jahrhundert, das entscheidend zur Entstehung der Sturm und Drang Strömung beitrug.
- Kapitel 5 erörtert die mythologische Gestalt des Prometheus und seinen Stellenwert in der griechischen Mythologie.
- Kapitel 6 untersucht die formale Gestaltung des Prometheus-Gedichts von Goethe und wie sich diese in den Kontext des Sturm und Drang einordnen lässt.
- Kapitel 7 interpretiert das Gedicht unter religionskritischen Aspekten und betrachtet die Kritik an Autoritäten und die Betonung der menschlichen Freiheit.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die die Hauptaussagen der vorliegenden Arbeit widerspiegeln, sind: Sturm und Drang, Aufklärung, Prometheus-Mythos, Geniebewusstsein, Schöpfung, Religionskritik, Autonomie, Individualität, Selbstverständnis des Dichters, formale Gestaltung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat der Prometheus-Mythos für Goethes Lyrik?
Der Prometheus-Mythos dient Goethe als Symbol für den rebellischen, schöpferischen Geist des Sturm und Drang, der sich gegen göttliche und weltliche Autoritäten auflehnt.
Was charakterisiert das "Geniebewusstsein" im Sturm und Drang?
Das Geniebewusstsein betont die Autonomie und Originalität des Dichters, der nicht mehr Regeln nachahmt, sondern aus sich selbst heraus wie ein Gott Neues erschafft.
Wie grenzt sich der Sturm und Drang von der Aufklärung ab?
Während die Aufklärung die Vernunft betont, setzt der Sturm und Drang auf Gefühl, Individualität und die Rebellion gegen starre gesellschaftliche Konventionen.
Welche religionskritischen Aspekte enthält Goethes Prometheus?
Das Gedicht kritisiert die Abhängigkeit des Menschen von den Göttern und fordert die menschliche Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ein.
Warum ist die formale Gestaltung des Gedichts so wichtig?
Die freie Form ohne festes Reimschema oder Metrum spiegelt den Drang nach Freiheit und den Bruch mit literarischen Traditionen wider, der typisch für diese Epoche ist.
- Quote paper
- B.A. Adrian Witt (Author), 2012, Die frühe Sturm und Drang Lyrik des Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283395