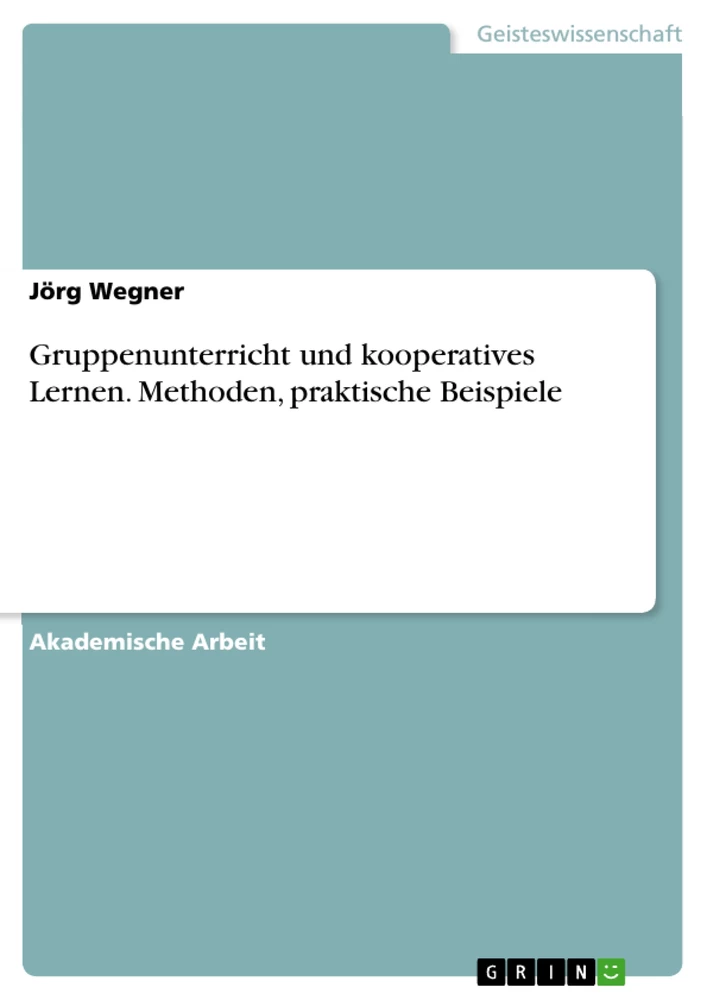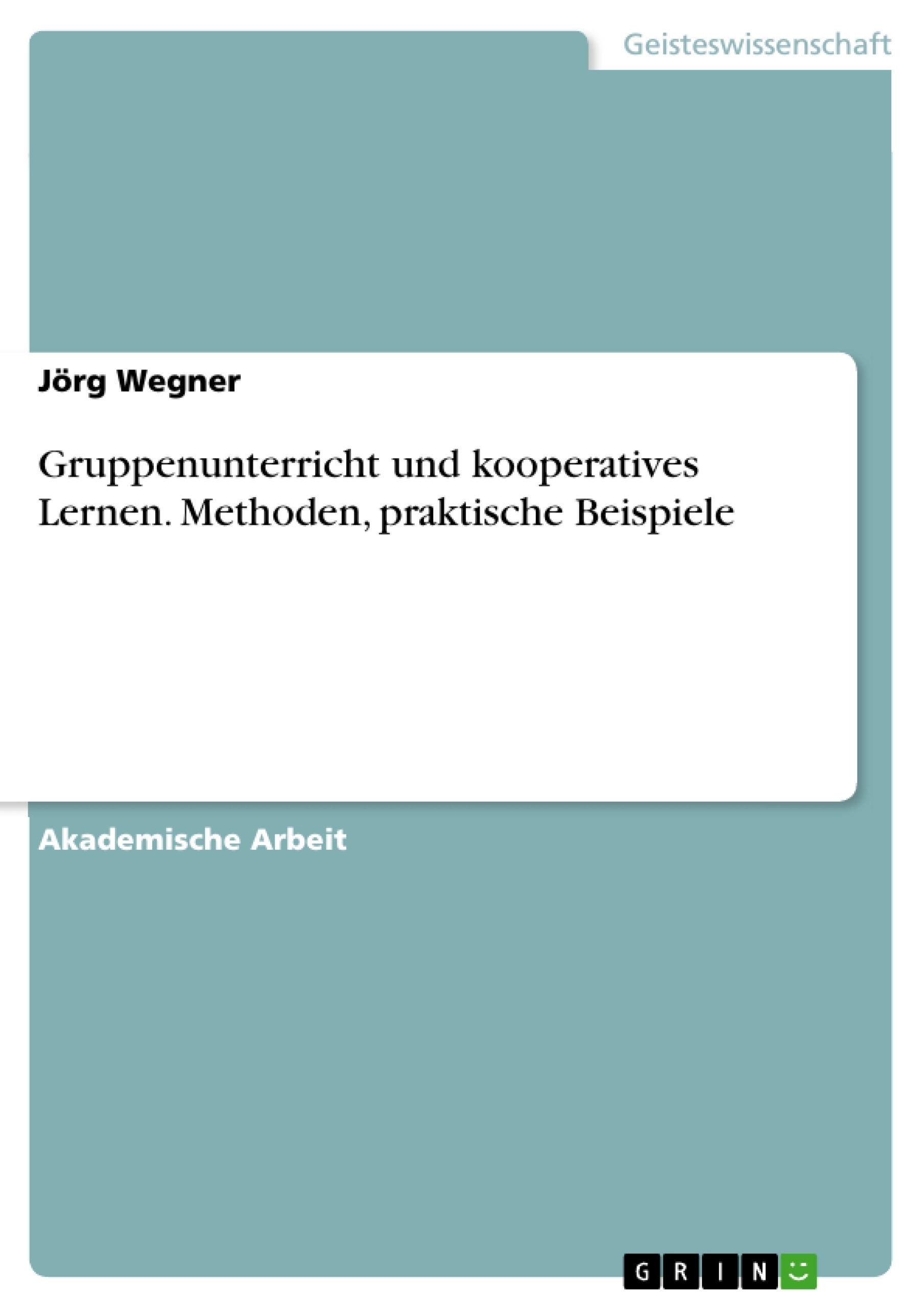Der Schulunterricht und dessen Methoden werden immer wieder von Firmen und Unternehmen kritisiert. Gleichzeitig wird die Forderung nach einer umfassenden Kompetenzvermittlung an die Schule gestellt. In Folge dessen werden „neue“ Unterrichtsmethoden wie z.B. Gruppenunterricht und kooperative Lernformen zur Kompetenzvermittlung und –förderung verlangt. Diese Methoden sind nicht erst in heutiger Zeit auf Drängen der Wirtschaft entstanden und erfunden worden, sondern sind in der Geschichte der Pädagogik wiederzufinden.
Dennoch müssen die heutigen Unterrichtsmethoden neu überdacht werden. Dazu greife ich die Rahmenrichtlinien und Bildungsverordnungen heraus und betrachte den heutigen Unterricht, unter den Gesichtspunkt, ob dieser den Ansprüchen der Wirtschafts- und Arbeitswelt genügt. In diesen Bezug werden unterschiedliche Betrachtungen von Unterricht, Lernen und Unterrichtsgestaltung mit einbezogen.
Der Gedanke vom kooperativen Lernen ist nicht erst in der heutigen Zeit entstanden. Man muss beim Rückblick in die Geschichte den Begriff des kooperativen Lernens weiter fassen und auch Kleingruppenarbeit und Gruppenunterricht betrachten.
Schon in den Reformschulen wurde Gruppenunterricht gehalten. Dies geschah meist, um einen Lehrermangel auszugleichen. In dieser Unterrichtsform wurden die Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt und ältere Schüler übernahmen die Beaufsichtigung und belehrten jüngere Schüler. Ähnliche Aufteilungen findet man auch an Jesuitengymnasien, in denen die Klassen in 10er Gruppen eingeteilt wurden. Auch hier übernahmen ältere Schüler Aufgaben des Lehrers.
Im 18./19. Jahrhundert wurde Gruppenunterricht meist aus organisatorischen Gründen betrieben. Bell und Lancaster kombinierten in Großbritannien leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler, um ein Helferprinzip aus arbeitsökonomischen Gründen zu schaffen. Andere Gründe für Gruppenunterricht zeigte der Franziskaner P.G. Girard im gleichen Jahrhundert. Er versuchte durch die Vermischung von Kindern armer und reicher Eltern soziale Barrieren abzubauen. Gerade an kleinen Schulen mit hohen Schülerzahlen und wenigen Lehrern wurde diese Unterrichtsform in jahrgangsübergreifenden Klassen angewendet. Nur wenige Pädagogen berücksichtigten soziale Aspekte in der Gruppenarbeit, wie z.B. der schon erwähnte P.G. Girard.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Gruppenunterrichts und des kooperativen Lernens
- Betrachtung der Bildungsrichtlinien ….....
- Herkömmliche Methoden im Unterricht ....
- Sichtweisen des Lernens.....
- Veränderungen des Unterrichts und des Lernbegriffs ……………………
- Vergleich der kognitivistischen mit der konstruktivistischen Sichtweise des Lernens
- Kooperatives Lernen…………………..\n
- Was ist kooperatives Lernen?.
- Merkmale und Aspekte des kooperativen Lernens.
- Positive Effekte kooperativen Lernens.
- Kooperatives Lernen im Unterricht....
- Probleme beim kooperativen Lernen…..\n
- Rahmenbedingungen für das kooperative Lernen.
- Motivations- und Anreizstrukturen….....
- Optimale Sitzordnung beim kooperativen Lernen …...\n
- Grundvoraussetzungen für kooperative Lernformen....
- Gruppeneinteilung
- Homogene und heterogene Gruppen
- Gruppengröße......
- Rollen- und Funktionsverteilung.
- Der Fahrplan für eine Gruppenarbeit
- Der Regelkatalog.
- Der Reflexionsbogen.
- Der Zeitrahmen….....
- Zusammenfassung der Rahmenbedingungen.....
- Kognitive Prozesse beim kooperativen Lernen ..
- Kognitiver Konflikt.
- Internalisation kognitiver Prozesse
- Erklären
- Metakognitive Strategien ......
- Reflektieren
- Prozess der Kooperation in Gruppen
- Zusammenfassung der Gruppenprozesse
- Praktische Unterrichtsbeispiele ....
- Strukturierte Kontroverse
- Projekte als kooperative Lernform
- Simulationen einer Juniorerfirma
- Zusammenfassung der Vorbereitung auf die Arbeitswelt ...
- Schlussbemerkung......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gruppenunterricht und dem kooperativen Lernen. Ziel ist es, die historischen Entwicklungen und die pädagogischen sowie kognitiven Grundlagen dieser Unterrichtsformen aufzuzeigen und ihre Bedeutung für die heutige Bildung zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Gruppenunterrichts und des kooperativen Lernens
- Die Bedeutung von Gruppenunterricht und kooperativen Lernformen für die Kompetenzentwicklung
- Die pädagogischen und kognitiven Grundlagen des kooperativen Lernens
- Die Herausforderungen und Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung von kooperativen Lernformen
- Praktische Beispiele und Anwendungsfelder des kooperativen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und beleuchtet die aktuelle Kritik am Schulunterricht sowie die Forderung nach einer umfassenden Kompetenzvermittlung. Im zweiten Kapitel wird die Geschichte des Gruppenunterrichts und des kooperativen Lernens beleuchtet, wobei die Entwicklung von den Reformschulen bis hin zu modernen Ansätzen im 20. Jahrhundert verfolgt wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Rahmenbedingungen für das kooperative Lernen und untersucht die Bedeutung von Motivationsstrukturen, Sitzordnung und Gruppeneinteilung. Kapitel vier beleuchtet die kognitiven Prozesse, die beim kooperativen Lernen eine Rolle spielen, wie z.B. den kognitiven Konflikt und die Internalisation kognitiver Prozesse. Das fünfte Kapitel widmet sich praktischen Unterrichtsbeispielen und stellt verschiedene Methoden wie die strukturierte Kontroverse und die Simulationen einer Juniorerfirma vor.
Schlüsselwörter
Gruppenunterricht, kooperatives Lernen, Kompetenzentwicklung, Bildungsrichtlinien, kognitiver Konflikt, Internalisation, Metakognition, Motivation, Sitzordnung, Gruppeneinteilung, Juniorerfirma, Projektmethode, Simulation.
- Was ist kooperatives Lernen?.
- Quote paper
- Jörg Wegner (Author), 2005, Gruppenunterricht und kooperatives Lernen. Methoden, praktische Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282670