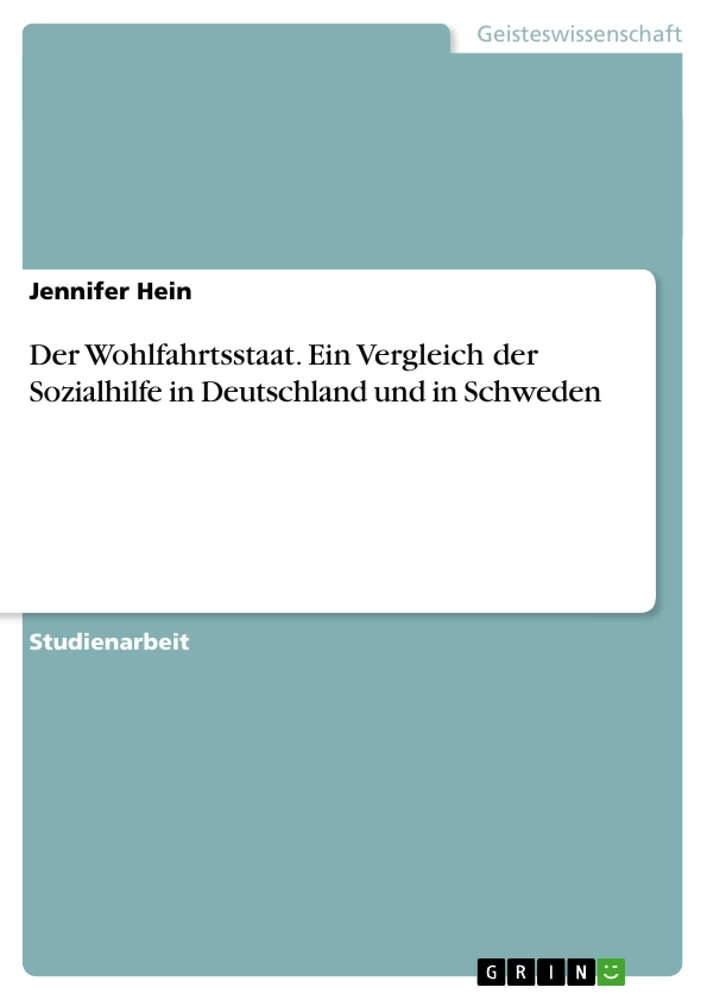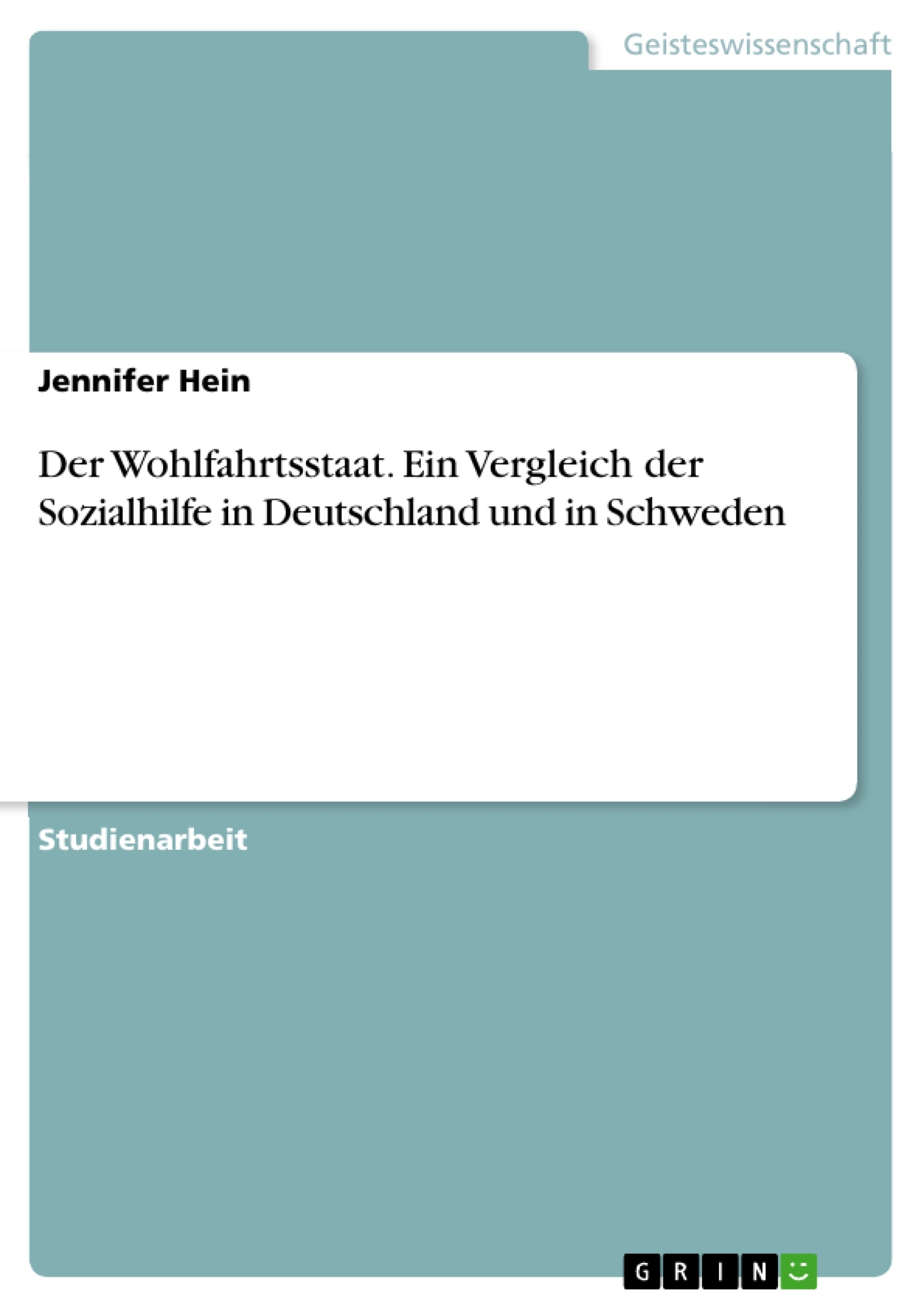Im Vordergrund des Vergleichs stehen die Thesen, dass Schweden als Erfolgsmodell im Bereich der Familien- und Arbeitsmarktpolitik gilt und Deutschland mit seiner zentralstaatlichen Regelung der Sozialhilfe, die geringen Ermessungsspielräume der Ausführer und die ausgeprägte Erwartungssicherheit hervor sticht.
Zu Beginn der Arbeit wird eine Definiton des Begriffs Wohlfahrtsstaat gegeben. Es wird die Unterscheidung zwischen Wohlfahrtsstaat und Sozialstaat getroffen, da diese in Deutschland nicht immer deutlich ist. Danach wird die Sozialhilfe beschrieben, die in Deutschland im Sozialgesetzbuch verankert ist, und die Formen der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden verglichen. Es lassen sich einige Unterschiede zwischen den zwei europäischen Ländern feststellen. Diese werden, nach einer kurzen Analyse der Geschichte der Sozialhilfe des jeweiligen Landes, dargestellt.
Das schwedische Sozialhilfesystem wird von der international vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung, bezüglich der Vollbeschäftigungspolitik, als residual eingestuft, da es im Vergleich zu anderen Wohlfahrtsstaaten, die universell ausgerichtet sind, nur eine geringe Bedeutung hat. Die schwedischen Leistungen werden allerdings als sehr hoch eingeordnet (vgl. Schwarze 2012: 189).
In der Familien- und Arbeitsmarktpolitik gilt das schwedische Modell als Erfolgsmodell. Schon vor 1930 wurden Reformen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik entwickelt, die ihre Grundzüge in der spezifischen Ausrichtung der Frauenbewegung haben, und seit den 60er Jahren ihre Wirkung zeigen. Außerdem kann sich dieses Modell durchsetzten, da ideologische Konflikte, wie sie beispielsweise in Deutschland bestanden, nie stark ausgeprägt waren und die politischen Kräfte schon zu Beginn der Industrialisierung immer versucht haben, den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital zu entschärfen (vgl. Blome et. al. 2008: 338). „Dieses Konsensmodell trägt bis heute und ist einer der Gründe für die lang anhaltende Dominanz sozialde-mokratischer Regierungen“ (Blome et. al. 2008: 338).
Zur Entwicklung der Sozialhilfe in Schweden ist weiterhin zu sagen, dass 1957 die Armenpflege von dem Begriff der Hilfen abgelöst, und die Sozialhilfe in das umfassende Sozial-dienstgesetz integriert wird. Seitdem liegt die operative und finanzielle Verantwortung bei den Kommunen. Seit 1981 besteht in Schweden der Anspruch auf Sozialhilfe. Die Sozialhilfe muss den Bedürftigen einen angemessenen und vernünftigen Lebensstandard sichern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Wohlfahrtsstaat
- Die Sozialhilfe im Vergleich - Deutschland und Schweden
- Die Sozialhilfe in Schweden
- Die Sozialhilfe in Deutschland
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und den Vergleich der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme aufzuzeigen und die jeweiligen Stärken und Schwächen zu beleuchten. Dabei wird der Kontext des Wohlfahrtsstaates berücksichtigt.
- Definition und Abgrenzung von Wohlfahrts- und Sozialstaat
- Entwicklung der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden
- Vergleich der Sozialhilfesysteme beider Länder
- Analyse der Familien- und Arbeitsmarktpolitik in Bezug auf Sozialhilfe
- Bewertung der jeweiligen Modelle im europäischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Sicherung in Europa ein und hebt die demografischen Herausforderungen in Deutschland und den Vergleich mit Schweden hervor. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf den Wohlfahrtsstaat, die Sozialhilfe und den Ländervergleich Deutschland-Schweden, wobei die unterschiedlichen Ansätze der Sozialhilfepolitik und die jeweiligen Stärken und Schwächen im Mittelpunkt stehen.
Der Wohlfahrtsstaat: Dieses Kapitel definiert den Wohlfahrtsstaat und grenzt ihn vom Sozialstaat ab. Es erläutert die Verantwortlichkeit des Staates für die Sicherung eines Mindestmaßes an Wohlfahrt und die verschiedenen Politiken und Maßnahmen, die dazu eingesetzt werden. Der Wohlfahrtsstaat wird als ein komplexes Gefüge beschrieben, das in westlichen Ländern mit Demokratie und Kapitalismus verwoben ist, und die Rolle der Sozialhilfe innerhalb dieses Gefüges wird hervorgehoben. Die Arbeit verweist auf die unterschiedliche Bewertung des deutschen Sozialhilfe-Modells im europäischen Vergleich und stellt Schweden als ein mögliches Gegenbeispiel dar.
Die Sozialhilfe im Vergleich - Deutschland und Schweden: Dieses Kapitel vergleicht die Sozialhilfesysteme Deutschlands und Schwedens. Es wird die Einordnung der jeweiligen Systeme in der internationalen Wohlfahrtsstaatsforschung erläutert, wobei Schweden als ein Erfolgsmodell in der Familien- und Arbeitsmarktpolitik dargestellt wird. Der Text analysiert die historischen Entwicklungen der Sozialhilfe in beiden Ländern und beleuchtet die Unterschiede in der Organisation, Finanzierung und den Leistungen. Es werden die unterschiedlichen Ansätze in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und die Auswirkungen auf die Sozialhilfeempfänger beleuchtet, sowie die Rolle der Kommunen und der Zentralregierung. Der Vergleich zeigt deutlich unterschiedliche Organisationsstrukturen und politische Zielsetzungen auf.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Sozialhilfe, Deutschland, Schweden, Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialversicherung, Vergleich, Erfolgsmodell, Mindeststandard, Zentralstaatlichkeit, Kommunale Selbstverwaltung, Armut, Arbeitslosigkeit.
FAQ: Vergleich der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Sozialhilfesysteme Deutschlands und Schwedens. Sie untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme, beleuchtet deren Stärken und Schwächen und betrachtet sie im Kontext des Wohlfahrtsstaates. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zum Wohlfahrtsstaat, einen detaillierten Vergleich der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden sowie ein Fazit. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Wohlfahrts- und Sozialstaat, die Entwicklung der Sozialhilfe in Deutschland und Schweden, einen detaillierten Vergleich der Systeme beider Länder, die Analyse der Familien- und Arbeitsmarktpolitik in Bezug auf Sozialhilfe und eine Bewertung der jeweiligen Modelle im europäischen Kontext. Es wird auch die Rolle der Kommunen und der Zentralregierung in beiden Ländern betrachtet.
Wie wird der Wohlfahrtsstaat definiert und abgegrenzt?
Das Kapitel "Der Wohlfahrtsstaat" definiert den Wohlfahrtsstaat und grenzt ihn vom Sozialstaat ab. Es erläutert die staatliche Verantwortung für ein Mindestmaß an Wohlfahrt und die dazu eingesetzten Politiken und Maßnahmen. Der Wohlfahrtsstaat wird als ein komplexes Gefüge beschrieben, das in westlichen Ländern mit Demokratie und Kapitalismus verwoben ist, und die Rolle der Sozialhilfe innerhalb dieses Gefüges wird hervorgehoben.
Wie werden die Sozialhilfesysteme Deutschlands und Schwedens verglichen?
Der Vergleich der Sozialhilfesysteme Deutschlands und Schwedens beinhaltet die Einordnung der jeweiligen Systeme in der internationalen Wohlfahrtsstaatsforschung. Schweden wird als ein mögliches Erfolgsmodell in der Familien- und Arbeitsmarktpolitik dargestellt. Die Arbeit analysiert die historischen Entwicklungen, Unterschiede in Organisation, Finanzierung und Leistungen, die Ansätze der aktiven Arbeitsmarktpolitik und deren Auswirkungen, sowie die Rolle der Kommunen und der Zentralregierung. Die unterschiedlichen Organisationsstrukturen und politischen Zielsetzungen werden deutlich herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Sozialhilfe, Deutschland, Schweden, Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialversicherung, Vergleich, Erfolgsmodell, Mindeststandard, Zentralstaatlichkeit, Kommunale Selbstverwaltung, Armut, Arbeitslosigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel Einleitung, Der Wohlfahrtsstaat, Die Sozialhilfe im Vergleich - Deutschland und Schweden und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Vergleichs der Sozialhilfesysteme in Deutschland und Schweden.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Sozialhilfesysteme in Deutschland und Schweden aufzuzeigen und die jeweiligen Stärken und Schwächen zu beleuchten. Dabei wird der Kontext des Wohlfahrtsstaates berücksichtigt.
- Quote paper
- Jennifer Hein (Author), 2013, Der Wohlfahrtsstaat. Ein Vergleich der Sozialhilfe in Deutschland und in Schweden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282669