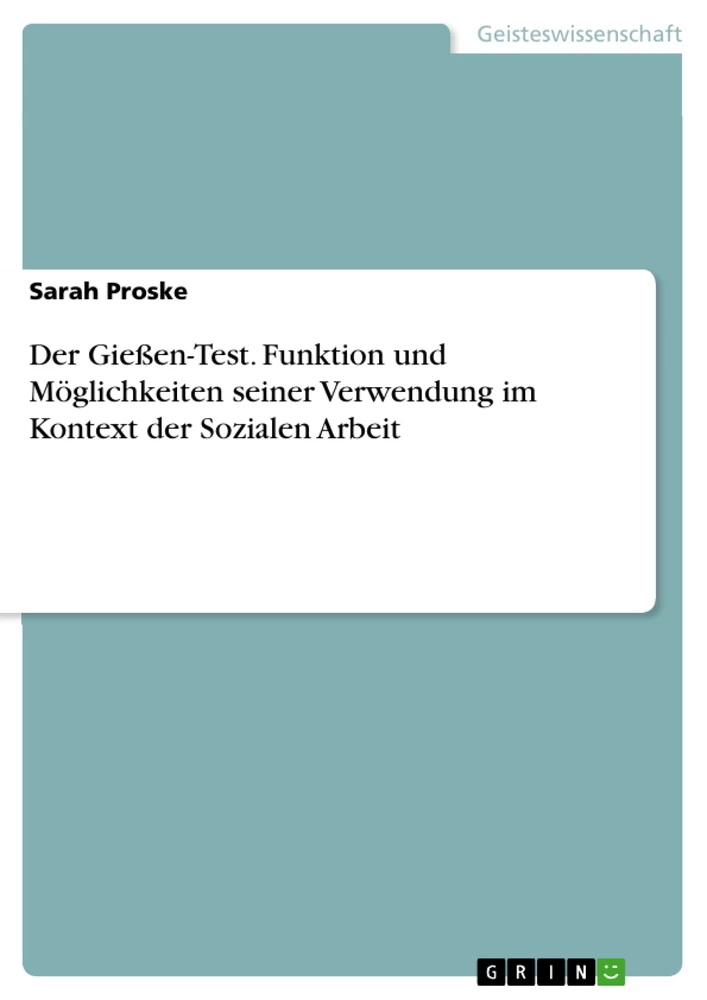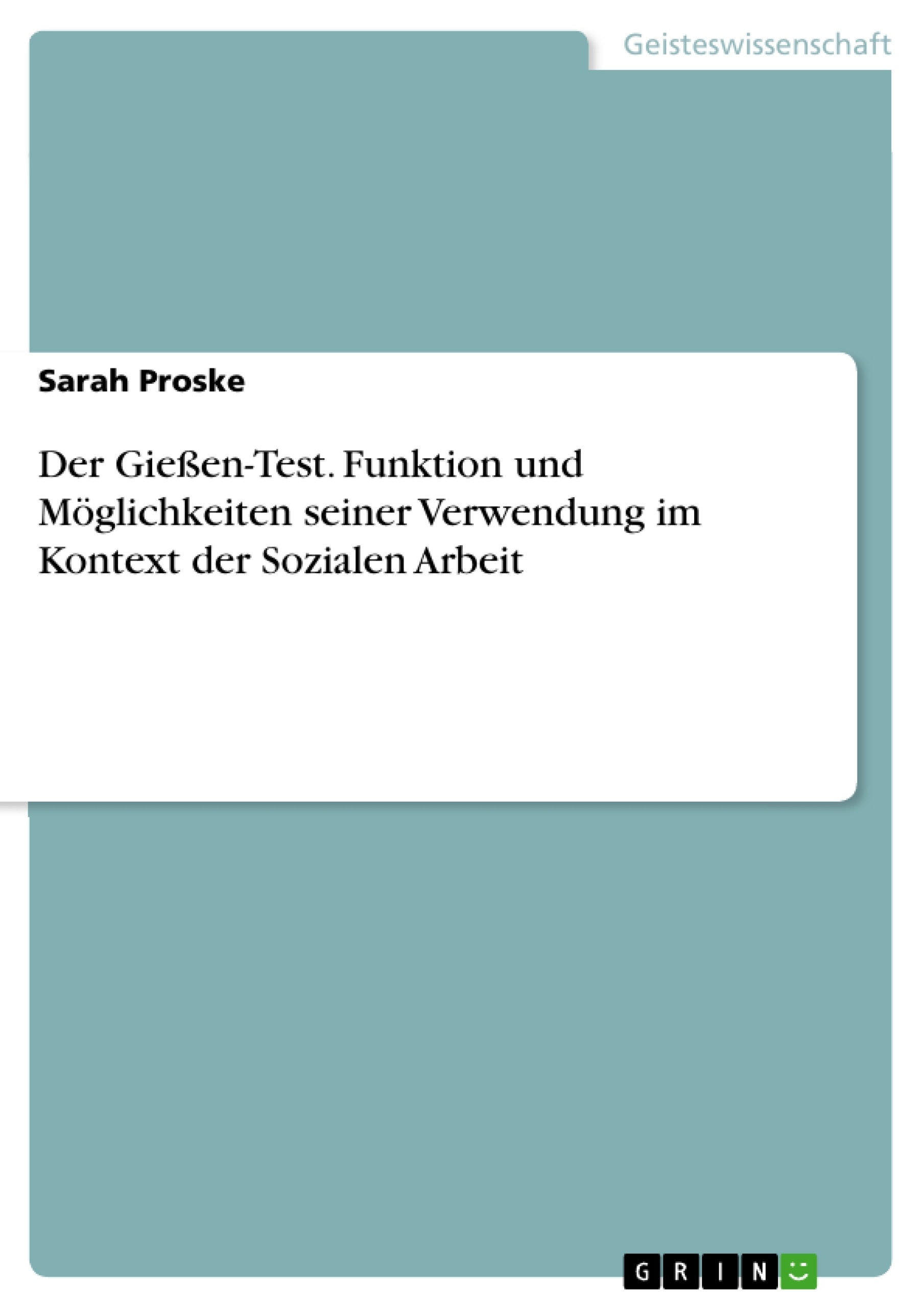Im Berufsfeld der Sozialen Arbeit kann bei Fachkräften oft zu Beginn einer Zusammenarbeit mit den Klienten die Schwierigkeit entstehen, die zahlreichen Ressourcen sowie die Schwächen zu erkennen, die in ihnen stecken. Dabei kann es so einfach sein: Diverse Persönlichkeitstests, darunter auch der Gießen-Test, können Aufschluss über vorhandene Ressourcen von Klienten geben und uns diese schnell erkennen lassen. Außerdem können Schwächen erkannt werden, die es gilt, in der weiteren Arbeit durch die Nutzung der Ressourcen der Klienten zu eliminieren. Wie der Gießen-Test funktioniert und welchen Nutzen er in der Sozialen Arbeit bringt, soll in der folgenden Ausarbeitung der Präsentation vom 8. Juni 2013 an der Fachhochschule Dortmund dargestellt werden.
Dazu wird im ersten Kapitel der Gießen-Test definiert. Es wird kurz auf seine Entwicklung, Entstehung und Standardisierung eingegangen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Anwendungsgebieten, wobei auf verschiedene Gebiete der Individual- und Gruppendiagnostik eingegangen wird.
Der Kern des Gießen-Tests sind die sechs Standardskalen, denen verschiedene Merkmalsbilder eines Klienten zugeordnet werden können. Diese werden im dritten Kapitel näher erläutert, wobei im vierten Kapitel die Auswertung dieser und die Erstellung eines Testprofils erklärt werden. Zuletzt werden im Fazit positive und negative Aspekte des Tests aufgezeigt sowie ein Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt.
Aus Gründen der Komplexität wird im Folgenden auf Gender Mainstreaming verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Konzept und Entstehung
- 1.1 Definition
- 1.2 Entwicklung
- 1.3 Entstehung
- 2. Anwendungsgebiete
- 2.1 Individualdiagnostik
- 2.1.1 Selbstbild
- 2.1.2 Vergleich Selbst- und Fremdbild
- 2.1.3 Vergleich Selbstbild und Idealselbstbild
- 2.2 Gruppendiagnostik
- 2.2.1 Interaktionsdiagnostik
- 2.2.2 Analyse von Durchschnittsmerkmalen in Kollektiven
- 2.1 Individualdiagnostik
- 3. Standardskalen
- 4. Durchführung, Auswertung und Testprofil
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Gießen-Test (GT) und seine Anwendbarkeit in der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, die Funktionsweise des Tests zu erklären und seinen Nutzen für die Erkennung von Ressourcen und Schwächen bei Klienten aufzuzeigen.
- Definition und Entwicklung des Gießen-Tests
- Anwendungsgebiete des GT in der Individual- und Gruppendiagnostik
- Interpretation der Standardskalen und Erstellung eines Testprofils
- Bewertung der Stärken und Schwächen des GT
- Relevanz des GT für die Praxis der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Herausforderungen bei der Ressourcen- und Schwächenanalyse von Klienten in der Sozialen Arbeit. Sie hebt die Bedeutung des Gießen-Tests als Hilfsmittel zur schnellen Erkennung von Ressourcen und Schwächen hervor und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
1. Konzept und Entstehung: Dieses Kapitel definiert den Gießen-Test als Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung von Selbst- und Fremdbild sowie von Idealvorstellungen. Es beschreibt die Entwicklung des Tests von seinen Anfängen mit 16 Items bis zur endgültigen Fassung mit 40 bipolaren Items, die auf einer siebenstufigen Skala bewertet werden. Die Standardisierung des Tests durch verschiedene Stichproben wird ebenfalls erläutert, unterstreicht die wissenschaftliche Fundierung und die Bestrebungen nach Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die wichtige Information über die Zielgruppe (18-60 Jahre mit einem IQ ab 80) und die kurze Bearbeitungszeit von ca. 10-15 Minuten wird ebenfalls hervorgehoben.
2. Anwendungsgebiete: Dieses Kapitel beschreibt die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten des GT in der Individual- und Gruppendiagnostik. In der Individualdiagnostik wird die Erfassung des Selbstbildes, der Vergleich von Selbst- und Fremdbild sowie der Vergleich von Selbst- und Idealselbstbild erläutert. Der Fokus liegt auf der Nutzbarkeit dieser Vergleiche zur Identifizierung von Ressourcen und der Gestaltung von Interventionen. Die Gruppendiagnostik konzentriert sich auf die Analyse von Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern, beispielsweise in Paarbeziehungen oder Familien. Der GT ermöglicht die Aufdeckung von Konfliktstrukturen und die Identifizierung von Ressourcen innerhalb der Gruppeninteraktionen. Die Beispiele aus der systemischen Familientherapie und die Analyse von schichtabhängigen Ehepaarstrukturen veranschaulichen die praktische Anwendung und den Mehrwert des Tests.
3. Standardskalen: Kapitel 3 befasst sich detailliert mit den sechs Standardskalen des GT: Soziale Resonanz, Dominanz, Kontrolle, Grundstimmung, Durchlässigkeit und Soziale Potenz. Für jede Skala werden die zentralen Merkmale und ihre Interpretation beschrieben, wobei jeweils exemplarisch Aspekte einer Seite der bipolaren Skala dargestellt sind. Die Erklärung der Beziehung zwischen den Skalen und psychologischen Konzepten (z.B. Freud's Es und Über-Ich) ermöglicht ein tieferes Verständnis der zugrundeliegenden psychologischen Mechanismen und die Einordnung der Testergebnisse in einen breiteren theoretischen Kontext.
4. Durchführung, Auswertung und Testprofil: In diesem Kapitel wird die Durchführung, Auswertung und die Erstellung des Testprofils im Detail dargestellt. Die einfachen, standardisierten Verfahren zur Auswertung, die Verwendung von Schablonen und die Transformation der Rohwerte in Standardwerte werden anschaulich erläutert. Die Interpretation der Ergebnisse und die Möglichkeiten der elektronischen Auswertung werden ebenfalls angesprochen. Die grafische Darstellung im Profilblatt und die Bedeutung der T-Werte und Prozentränge werden zur besseren Verständlichkeit genutzt.
Schlüsselwörter
Gießen-Test (GT), Selbstbeurteilungsverfahren, Individualdiagnostik, Gruppendiagnostik, Ressourcenmanagement, Standardskalen, Soziale Arbeit, Persönlichkeit, Selbstbild, Fremdbild, Idealselbstbild, Ressourcen, Schwächen, Konfliktstrukturen, psychosoziale Abwehrformen.
Häufig gestellte Fragen zum Gießen-Test (GT)
Was ist der Gießen-Test (GT) und welche Ziele verfolgt er?
Der Gießen-Test (GT) ist ein Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung von Selbst- und Fremdbild sowie Idealvorstellungen. Ziel des Tests ist die schnelle und effiziente Erkennung von Ressourcen und Schwächen bei Individuen und Gruppen, insbesondere im Kontext der Sozialen Arbeit.
Wie ist der GT aufgebaut und entwickelt worden?
Der GT hat sich von einer anfänglichen Version mit 16 Items zu einer endgültigen Fassung mit 40 bipolaren Items entwickelt, die auf einer siebenstufigen Skala bewertet werden. Der Test wurde umfassend standardisiert, um Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Zielgruppe umfasst Personen im Alter von 18-60 Jahren mit einem IQ ab 80. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 10-15 Minuten.
Wo findet der GT Anwendung?
Der GT findet Anwendung in der Individual- und Gruppendiagnostik. In der Individualdiagnostik ermöglicht er die Erfassung des Selbstbildes, den Vergleich von Selbst- und Fremdbild sowie den Vergleich von Selbst- und Idealselbstbild. In der Gruppendiagnostik dient er der Analyse von Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern (z.B. in Paarbeziehungen oder Familien), der Aufdeckung von Konfliktstrukturen und der Identifizierung von Ressourcen innerhalb der Gruppeninteraktionen.
Welche Standardskalen umfasst der GT?
Der GT umfasst sechs Standardskalen: Soziale Resonanz, Dominanz, Kontrolle, Grundstimmung, Durchlässigkeit und Soziale Potenz. Jede Skala beschreibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und ihre Interpretation wird im Detail erläutert. Die Beziehung zwischen den Skalen und psychologischen Konzepten (z.B. Freud's Es und Über-Ich) wird ebenfalls dargestellt.
Wie wird der GT durchgeführt, ausgewertet und wie sieht das Testprofil aus?
Die Durchführung des GT ist standardisiert und einfach. Die Auswertung erfolgt anhand von Schablonen und die Rohwerte werden in Standardwerte transformiert. Die Ergebnisse werden grafisch im Profilblatt dargestellt, wobei T-Werte und Prozentränge zur besseren Interpretation verwendet werden. Elektronische Auswertungsmöglichkeiten werden ebenfalls angeboten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Gießen-Test?
Schlüsselwörter, die den Gießen-Test beschreiben, sind: Gießen-Test (GT), Selbstbeurteilungsverfahren, Individualdiagnostik, Gruppendiagnostik, Ressourcenmanagement, Standardskalen, Soziale Arbeit, Persönlichkeit, Selbstbild, Fremdbild, Idealselbstbild, Ressourcen, Schwächen, Konfliktstrukturen, psychosoziale Abwehrformen.
Für wen ist der Gießen-Test besonders relevant?
Der Gießen-Test ist besonders relevant für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit, die ein schnelles und effizientes Instrument zur Erkennung von Ressourcen und Schwächen bei ihren Klienten benötigen. Die Ergebnisse können zur Gestaltung individueller Interventionen und zur Verbesserung der Behandlungsplanung beitragen.
Welche Vorteile bietet der Gießen-Test?
Der Gießen-Test bietet den Vorteil einer schnellen und einfachen Durchführung und Auswertung. Seine standardisierten Verfahren ermöglichen die objektive Vergleichbarkeit von Ergebnissen. Die umfassende Interpretation der Skalen und die grafische Darstellung im Profilblatt erleichtern das Verständnis der Ergebnisse und deren Anwendung in der Praxis.
- Quote paper
- Sarah Proske (Author), 2013, Der Gießen-Test. Funktion und Möglichkeiten seiner Verwendung im Kontext der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282490