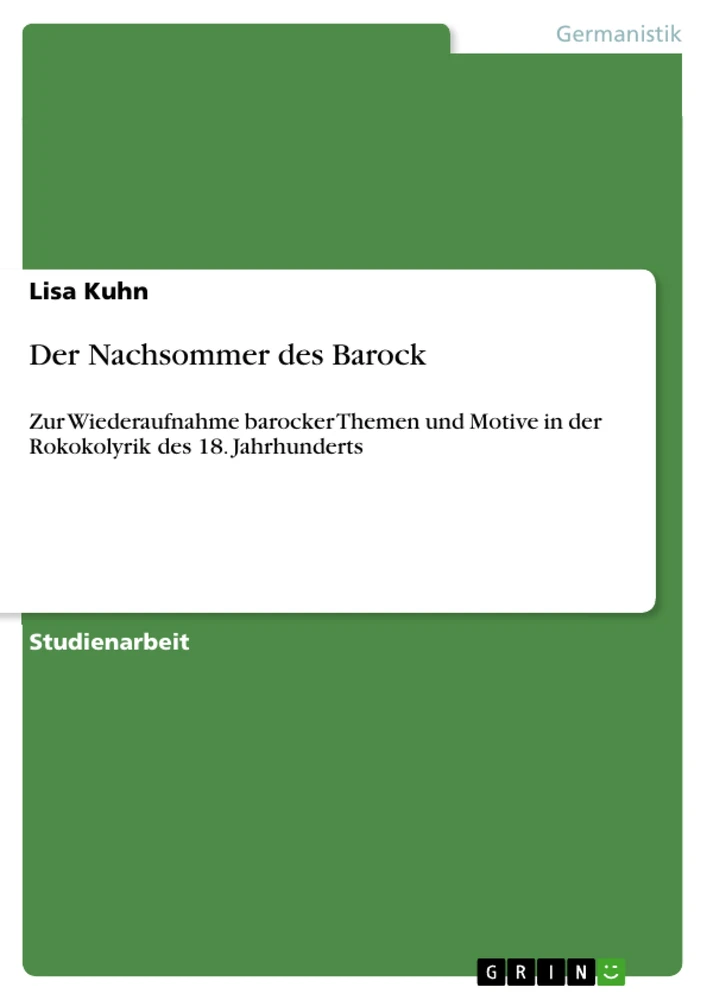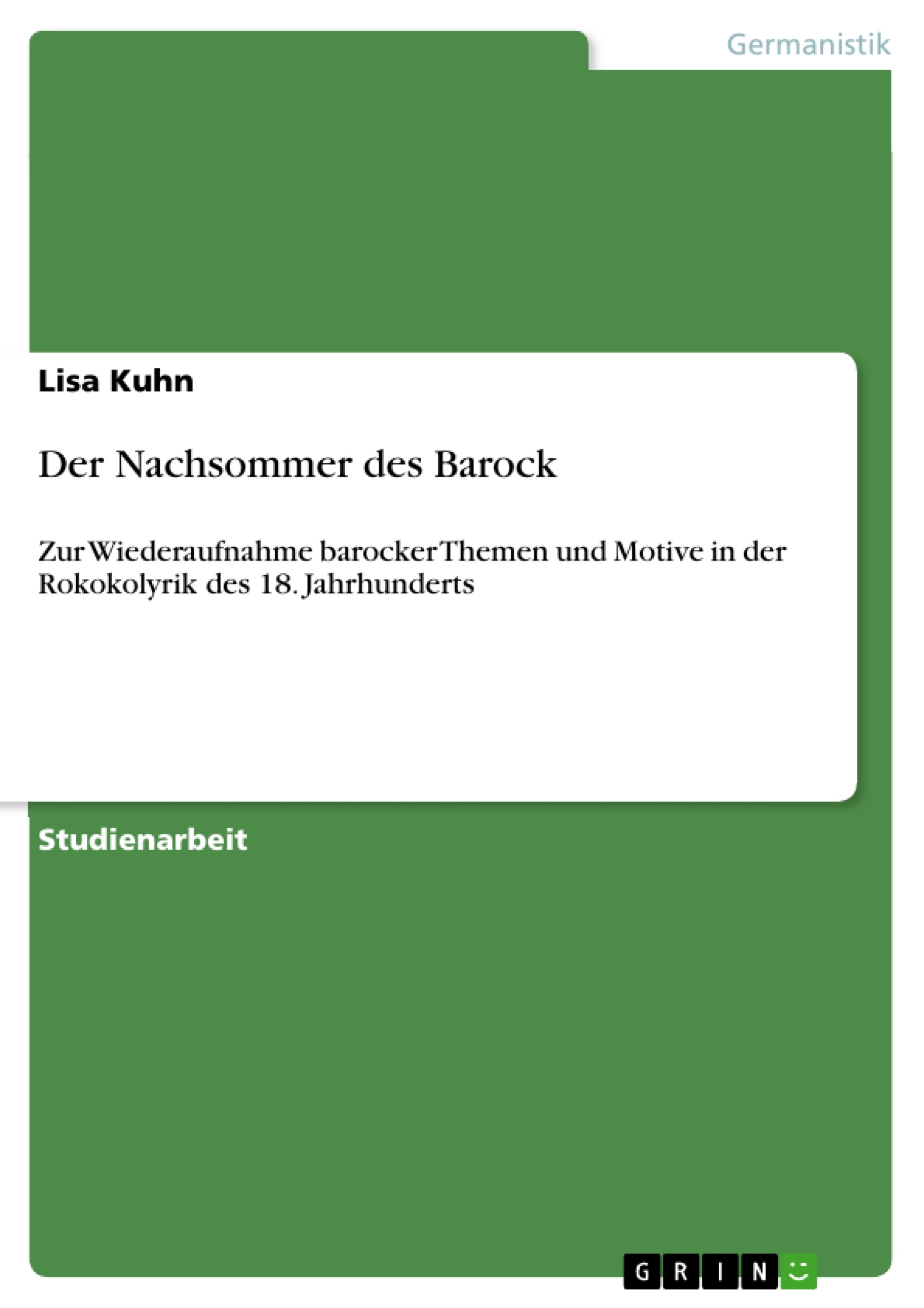Im Zusammenhang mit der deutschen Rokokodichtung stößt man in der Forschungsliteratur auf widersprüchliche Aussagen, wenn es darum geht, den Stil dieser Lyrik zwischen 1740 und 1780 zu beschreiben, um sie von anderen Epochen und deren stilistischen Tendenzen zu unterscheiden. Einerseits wird auf die Gemeinsamkeiten mit der Aufklärungsepoche, in welche die Rokokodichtung eingebettet ist, hingewiesen. Insbesondere die aufkommende „Gegnerschaft gegen den barocken Schwulst“, die vor allem von revolutionären Jungdeutschen geteilt wurde, die sich vom Altmodischen des Ancien Régime loslösen wollten, wird mehrfach betont. Auf der anderen Seite finden sich an Stelle des Begriffs „Rokoko“ Bezeichnungen wie „Nachsommer des Barock“ oder auch „Spät-“ und „Nachbarock“, die auf eine Nähe zur Lyrik des 17. Jahrhunderts schließen lassen. Alfred Anger begründet diese Widersprüchlichkeit damit, „daß es sich bei der deutschen Rokokodichtung um einen typischen Übergangsstil handelt, der vieles Alte bewahrt […], sich aber auch schon dem Neuen öffnet und es selber hervorbringt“, wodurch eine „Brücke zwischen Barock und Goethezeit“ geschaffen wird. Die vorliegende Arbeit soll an dieser Stelle anknüpfen und die Suche nach Verbindungen zwischen Barock- und Rokokodichtung in den Vordergrund stellen. Daher wird im Folgenden der Frage nachgegangen, welche Themen und Motive aus dem 17. Jahrhundert in der Rokokodichtung aufgegriffen werden und auf welche Weise sie womöglich in ihr weiterleben. Hierzu erfolgt eine nähere Betrachtung von Barock und Rokoko, die durch die Analyse zweier stellvertretender Gedichte gestützt wird, um schließlich einen Vergleich ihrer thematischen und motivischen Gemeinsamkeiten ziehen zu können. Bei den ausgewählten Werken handelt es sich zum einen um Martin Opitz´ "Ich empfinde fast ein Grauen" und zum anderen um "Das Gesellschaftliche" von Friedrich von Hagedorn.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Barockdichtung
- Begriffsklärung
- Zeitliche Einordnung
- Historischer Hintergrund
- Weltbild und zentrale Themen des Barock
- Martin Opitz und die Reform der deutschen Dichtkunst
- Analyse der Ode Ich empfinde fast ein Grauen von Martin Opitz
- Entstehungskontext
- Inhaltliche Betrachtung
- Analyse der Form
- Analyse der Sprache
- Zwischenfazit
- Rokokodichtung
- Begriffsklärung
- Zeitliche Einordnung
- Historische Entwicklungen in der Aufklärungsepoche
- Die Dichtung Friedrich von Hagedorns
- Analyse zu Das Gesellschaftliche von Friedrich von Hagedorn
- Inhaltliche Betrachtung
- Analyse der Form
- Analyse der Sprache
- Vergleich der Themen und Motive der beiden Gedichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindungen zwischen Barock- und Rokokodichtung des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert, inwiefern barocke Themen und Motive in der Rokokolyrik weiterleben und aufgegriffen werden. Die Analyse zweier repräsentativer Gedichte dient als Grundlage für einen Vergleich der thematischen und motivischen Gemeinsamkeiten beider Epochen.
- Der Übergangsstil der Rokokodichtung und ihre Beziehung zum Barock
- Analyse der zentralen Themen und Motive des Barock
- Vergleich der Stilmittel und der Sprache in der Barock- und Rokokodichtung
- Die Rolle von Martin Opitz und Friedrich von Hagedorn als repräsentative Dichter
- Identifizierung von thematischen und motivischen Kontinuitäten zwischen Barock und Rokoko
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die kontroversen Beschreibungen der deutschen Rokokodichtung in der Forschung und betont den widersprüchlichen Charakter dieses Übergangsstils, der Elemente des Barock bewahrt, sich aber gleichzeitig dem Neuen öffnet. Die Arbeit fokussiert die Suche nach Verbindungen zwischen Barock und Rokoko und untersucht, wie barocke Themen und Motive in der Rokokodichtung weiterleben. Die Analyse zweier Gedichte soll diesen Vergleich unterstützen.
Barockdichtung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Barockdichtung. Es klärt den Begriff „Barock“ und seine verschiedenen Interpretationen, von der Beschreibung einer unregelmäßig geformten Perle bis hin zu seiner Verwendung als negativ konnotierte Stilbezeichnung im 18. Jahrhundert und seiner späteren positiven Rezeption. Es ordnet die Epoche zeitlich ein, beleuchtet den historischen Hintergrund mit seinen Kriegen, Epidemien und sozialen Unruhen, und beschreibt das Weltbild und die zentralen Themen des Barock, geprägt von der Antithetik von Lebensfreude und Todesbangen, Diesseits und Jenseits, sowie den Leitmotiven „Memento mori“ und „Carpe diem“. Schließlich wird die Bedeutung von Martin Opitz für die Reform der deutschen Dichtkunst behandelt.
Analyse der Ode Ich empfinde fast ein Grauen von Martin Opitz: (Diese Zusammenfassung wurde aufgrund der fehlenden Textinformationen ausgelassen.)
Rokokodichtung: Dieses Kapitel behandelt die Rokokodichtung, indem es den Begriff klärt, die zeitliche Einordnung vornimmt und die historischen Entwicklungen der Aufklärungsepoche beschreibt. Es beleuchtet die Dichtung Friedrich von Hagedorns als Beispiel der Epoche.
Analyse zu Das Gesellschaftliche von Friedrich von Hagedorn: (Diese Zusammenfassung wurde aufgrund der fehlenden Textinformationen ausgelassen.)
Vergleich der Themen und Motive der beiden Gedichte: (Diese Zusammenfassung wurde aufgrund der fehlenden Textinformationen ausgelassen.)
Schlüsselwörter
Barockdichtung, Rokokodichtung, Martin Opitz, Friedrich von Hagedorn, „Memento mori“, „Carpe diem“, Übergangsstil, Aufklärung, Stilvergleich, thematische Kontinuität, Motivische Gemeinsamkeiten, Vergänglichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Barock- und Rokokodichtung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verbindungen zwischen Barock- und Rokokodichtung des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert, inwiefern barocke Themen und Motive in der Rokokolyrik weiterleben und aufgegriffen werden. Der Vergleich zweier repräsentativer Gedichte (Martin Opitz' "Ich empfinde fast ein Grauen" und Friedrich von Hagedorns "Das Gesellschaftliche") dient als Grundlage für den Vergleich der thematischen und motivischen Gemeinsamkeiten beider Epochen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Übergangsstil der Rokokodichtung und ihre Beziehung zum Barock; die Analyse der zentralen Themen und Motive des Barock; einen Vergleich der Stilmittel und der Sprache in der Barock- und Rokokodichtung; die Rolle von Martin Opitz und Friedrich von Hagedorn als repräsentative Dichter; und die Identifizierung von thematischen und motivischen Kontinuitäten zwischen Barock und Rokoko.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Gedichte: "Ich empfinde fast ein Grauen" von Martin Opitz und "Das Gesellschaftliche" von Friedrich von Hagedorn. Die detaillierten Analysen (Inhaltsbetrachtung, Form- und Sprachanalyse) sind im Haupttext enthalten, aber die Zusammenfassungen hier sind aufgrund fehlender Textinformationen ausgelassen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Barockdichtung (inkl. Klärung des Begriffs, zeitlicher Einordnung, historischem Hintergrund, Weltbild, zentralen Themen und Martin Opitz), Analyse von Opitz' Gedicht, Zwischenfazit, Rokokodichtung (inkl. Begriffsklärung, zeitlicher Einordnung, historischer Entwicklungen und Hagedorn), Analyse von Hagedorns Gedicht, Vergleich der Gedichte und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Barockdichtung, Rokokodichtung, Martin Opitz, Friedrich von Hagedorn, „Memento mori“, „Carpe diem“, Übergangsstil, Aufklärung, Stilvergleich, thematische Kontinuität, motivische Gemeinsamkeiten, Vergänglichkeit.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die Rokokodichtung, obwohl sie als Übergangsstil zur Aufklärung gilt, immer noch wesentliche Themen und Motive des Barock aufgreift und weiterentwickelt. Dieser Zusammenhang wird durch den Vergleich der analysierten Gedichte verdeutlicht.
Welche Aspekte des Barocks werden behandelt?
Der Barockabschnitt beleuchtet den Begriff "Barock" in seinen verschiedenen Interpretationen, die zeitliche Einordnung, den historischen Hintergrund (Kriege, Epidemien, soziale Unruhen), das Weltbild (Antithetik von Lebensfreude und Todesbangen, Diesseits und Jenseits) und zentrale Motive wie "Memento mori" und "Carpe diem". Die Bedeutung von Martin Opitz für die Reform der deutschen Dichtkunst wird ebenfalls behandelt.
Welche Aspekte des Rokoko werden behandelt?
Der Rokokoabschnitt klärt den Begriff "Rokoko", ordnet ihn zeitlich ein, beschreibt die historischen Entwicklungen der Aufklärungsepoche und beleuchtet die Dichtung Friedrich von Hagedorns als Beispiel für diese Epoche.
- Quote paper
- Lisa Kuhn (Author), 2013, Der Nachsommer des Barock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282469