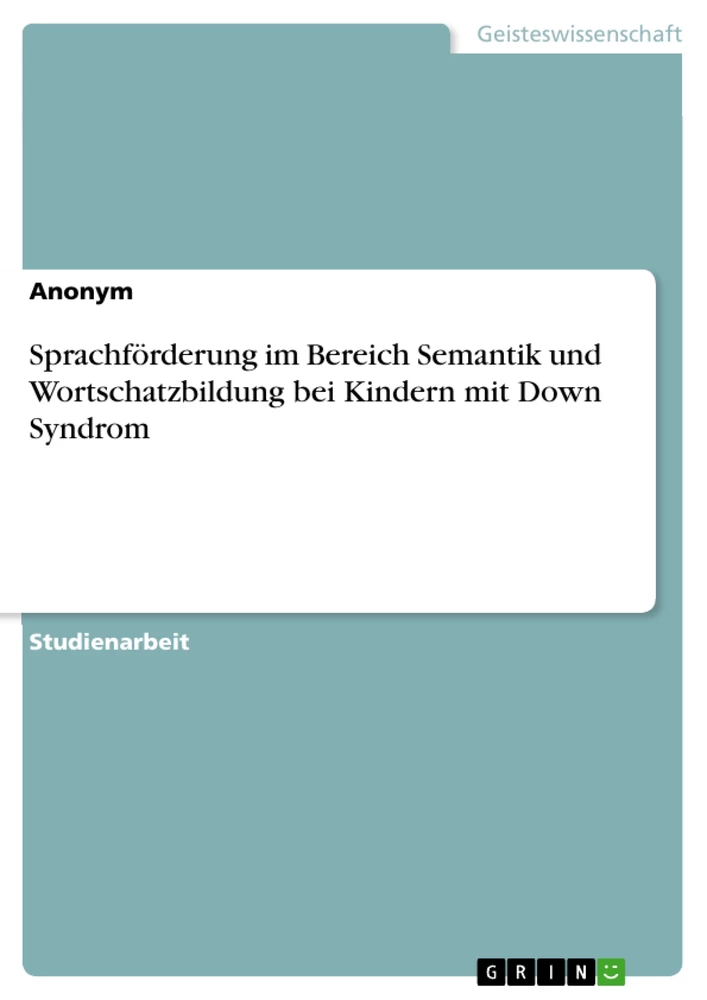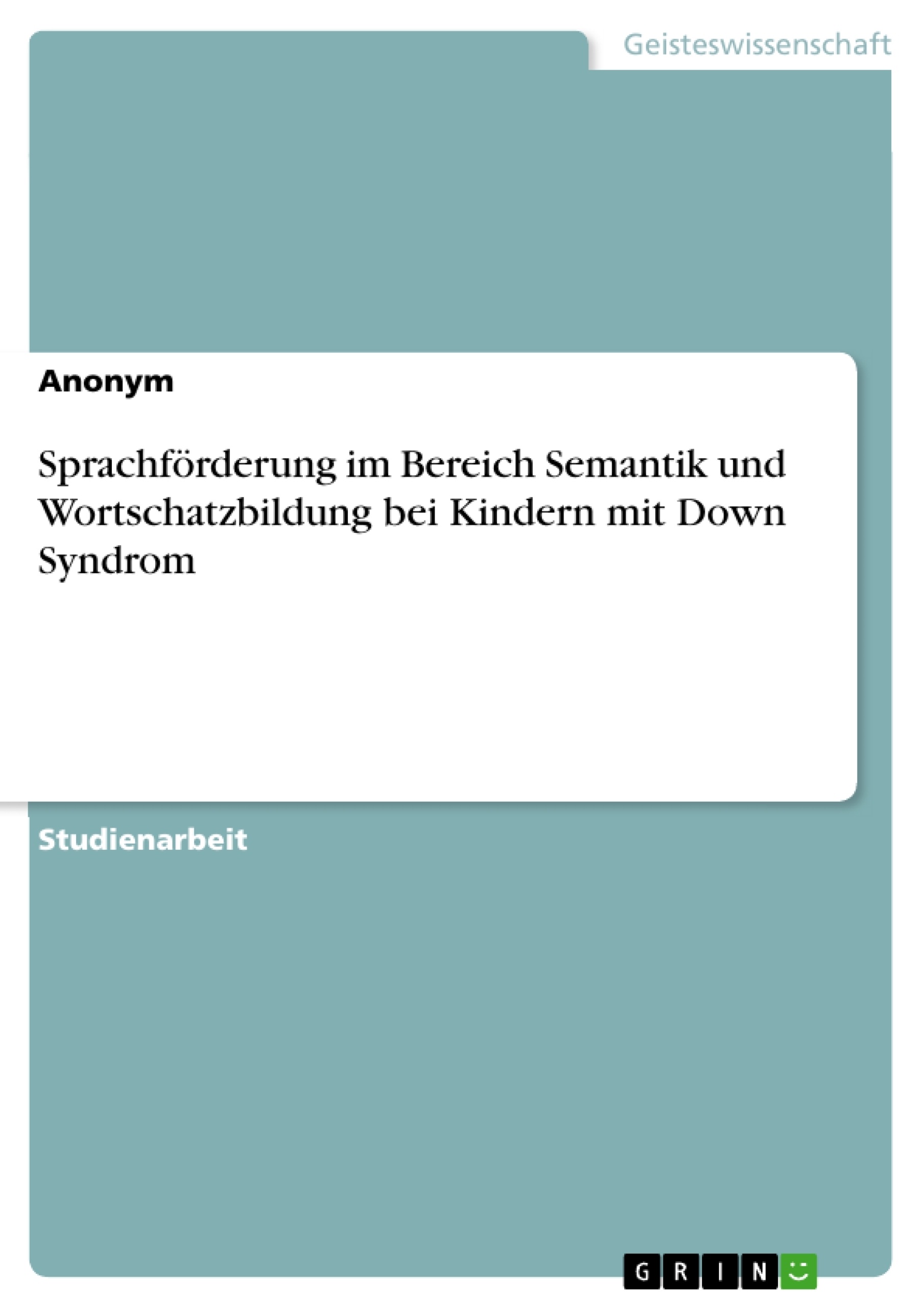Sprache ist das zentrale Kommunikationsmittel des Menschen. Doch wie geht man damit um, wenn körperliche und/oder geistige Einschränkungen die Möglichkeiten des Erwerbs und der Anwendung von Sprache erschweren?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werden im folgendem die Grundlagen des Spracherwerbs dargestellt. Dabei werden die drei wichtigsten Ebenen des Spracherwerbs sowie biologische Voraussetzungen und soziale Einflüsse erläutert.
Des Weiteren wird eine Form der körperlich- und geistigen Einschränkung, die des Down-Syndroms, beschrieben, welche eine inhaltliche Grundlage für das weitere Verständnis dieser Arbeit schafft.
Beeinträchtigungen sowie deren Folgen im Sprachentwicklungsprozess, welche mit dem Down-Syndrom einhergehen können, werden in den im Anschluss beschriebenen Förderprogrammen berücksichtigt.
Im Zuge des Inklusionsgedanken ist das Ziel dieser Arbeit theoretisches Hintergrundwissen über die Besonderheit der Sprachförderung bei Kindern mit Down Syndrom zu erlangen, um dies als Grundlage für ein zukünftiges Projekt in diesem Bereich zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Spracherwerb
- Die Stufen kindlicher Sprachentwicklung
- Die prosodisch-phonologische Ebene
- Die semantisch-lexikalische Ebene
- Die morphologisch-syntaktische Ebene
- Voraussetzungen und Einflussfaktoren des Spracherwerbs
- Biologische Voraussetzungen
- Der Einfluss der sozialen Interaktion
- Die Stufen kindlicher Sprachentwicklung
- Förderung von Kindern mit Down Syndrom
- Das Down Syndrom
- Sprachentwicklung beim Down Syndrom
- Orofaziale Beeinträchtigungen
- Sprachstörungen
- Förderansätze
- Gebärdenunterstützende Kommunikation
- Psychomotorische Sprachentwicklungsförderung
- Das Down Syndrom
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, theoretisches Hintergrundwissen über die Besonderheiten der Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom zu vermitteln. Dies dient als Grundlage für zukünftige Projekte in diesem Bereich und berücksichtigt den Inklusionsgedanken. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge des Spracherwerbs und die Herausforderungen, die sich durch das Down-Syndrom ergeben.
- Grundlagen des Spracherwerbs (phonetisch-phonologische, semantisch-lexikalische und morphologisch-syntaktische Ebene)
- Biologische und soziale Voraussetzungen für den Spracherwerb
- Sprachentwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom und damit verbundene Beeinträchtigungen
- Geeignete Förderansätze für Kinder mit Down-Syndrom
- Der Einfluss von Orofazialen Beeinträchtigungen auf die Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sprachförderung bei Kindern mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Umgang mit solchen Einschränkungen im Spracherwerb und der Sprachverwendung. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und benennt die Grundlagen des Spracherwerbs, das Down-Syndrom und entsprechende Förderprogramme als inhaltliche Schwerpunkte.
Der Spracherwerb: Dieses Kapitel beschreibt die menschliche Fähigkeit zum Spracherwerb und die dafür notwendigen kognitiven, biologischen und sozialen Voraussetzungen. Es unterteilt den Spracherwerb in drei Ebenen: die phonetisch-phonologische Ebene (Lautstruktur und Betonung), die semantisch-lexikalische Ebene (Wort-, Satz- und Inhaltsbedeutung) und die morphologisch-syntaktische Ebene (Wort- und Satzbildung). Der wechselseitige Einfluss dieser Ebenen und deren enge Verknüpfung werden hervorgehoben. Die Bedeutung der Prosodischen Ebene, wie Rhythmus und Melodie in der Sprache, wird im Detail untersucht. Es wird dargelegt wie diese bereits in frühen Stadien der kindlichen Entwicklung eine Rolle spielt.
Förderung von Kindern mit Down Syndrom: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Down-Syndrom, seinen Auswirkungen auf die Sprachentwicklung und möglichen Förderansätzen. Es beschreibt die typischen sprachlichen Schwierigkeiten bei Kindern mit Down-Syndrom, wie sie durch orofaziale Beeinträchtigungen und die generelle Sprachentwicklungsverzögerung bedingt sind. Der Fokus liegt auf der Bedeutung frühzeitiger und gezielter Förderung, wobei gebieten Unterstützende Kommunikation und psychomotorische Förderprogramme als Beispiele genannt werden.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Sprachentwicklung, Down-Syndrom, Sprachförderung, Inklusion, phonetisch-phonologische Ebene, semantisch-lexikalische Ebene, morphologisch-syntaktische Ebene, orofaziale Beeinträchtigungen, Gebärdenunterstützende Kommunikation, psychomotorische Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den theoretischen Grundlagen des Spracherwerbs und den spezifischen Herausforderungen und Förderansätzen für Kinder mit Down-Syndrom.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Grundlagen des Spracherwerbs (phonetisch-phonologische, semantisch-lexikalische und morphologisch-syntaktische Ebene), biologische und soziale Voraussetzungen für den Spracherwerb, Sprachentwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom und damit verbundene Beeinträchtigungen (inklusive orofazialer Beeinträchtigungen), geeignete Förderansätze (wie Gebärdenunterstützende Kommunikation und psychomotorische Sprachförderung), und der Inklusionsgedanke.
Welche Ebenen des Spracherwerbs werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet drei Ebenen des Spracherwerbs: die phonetisch-phonologische Ebene (Lautstruktur und Betonung), die semantisch-lexikalische Ebene (Wort-, Satz- und Inhaltsbedeutung) und die morphologisch-syntaktische Ebene (Wort- und Satzbildung). Der wechselseitige Einfluss dieser Ebenen wird hervorgehoben.
Welche Herausforderungen stellen sich bei der Sprachentwicklung von Kindern mit Down-Syndrom?
Kinder mit Down-Syndrom zeigen oft typische sprachliche Schwierigkeiten, die durch orofaziale Beeinträchtigungen (Beeinträchtigungen im Mund- und Gesichtsbereich) und eine generelle Sprachentwicklungsverzögerung bedingt sind. Das Dokument beschreibt diese Herausforderungen im Detail.
Welche Förderansätze werden für Kinder mit Down-Syndrom empfohlen?
Das Dokument empfiehlt frühzeitige und gezielte Förderung. Als Beispiele werden Gebärdenunterstützende Kommunikation und psychomotorische Förderprogramme genannt. Die Bedeutung einer individuellen und angepassten Förderung wird betont.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, theoretisches Hintergrundwissen über die Besonderheiten der Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom zu vermitteln. Dies soll als Grundlage für zukünftige Projekte in diesem Bereich dienen und den Inklusionsgedanken berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Sprachentwicklung, Down-Syndrom, Sprachförderung, Inklusion, phonetisch-phonologische Ebene, semantisch-lexikalische Ebene, morphologisch-syntaktische Ebene, orofaziale Beeinträchtigungen, Gebärdenunterstützende Kommunikation, psychomotorische Sprachförderung.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Spracherwerb und der Förderung von Kindern mit Down-Syndrom, und abschließend einem Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Sprachförderung im Bereich Semantik und Wortschatzbildung bei Kindern mit Down Syndrom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282468