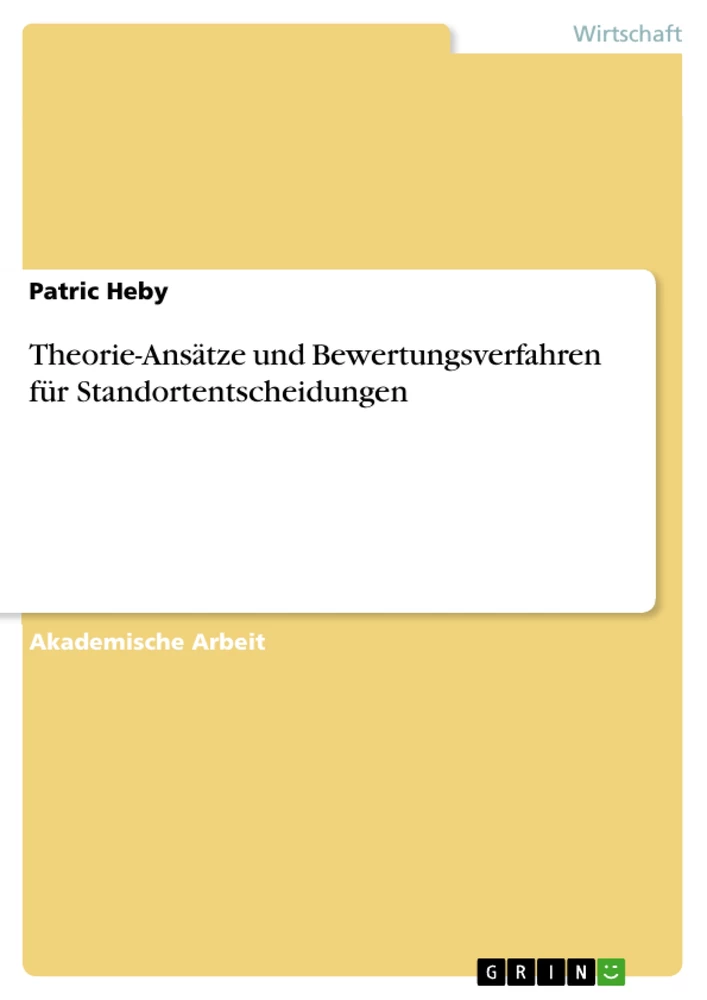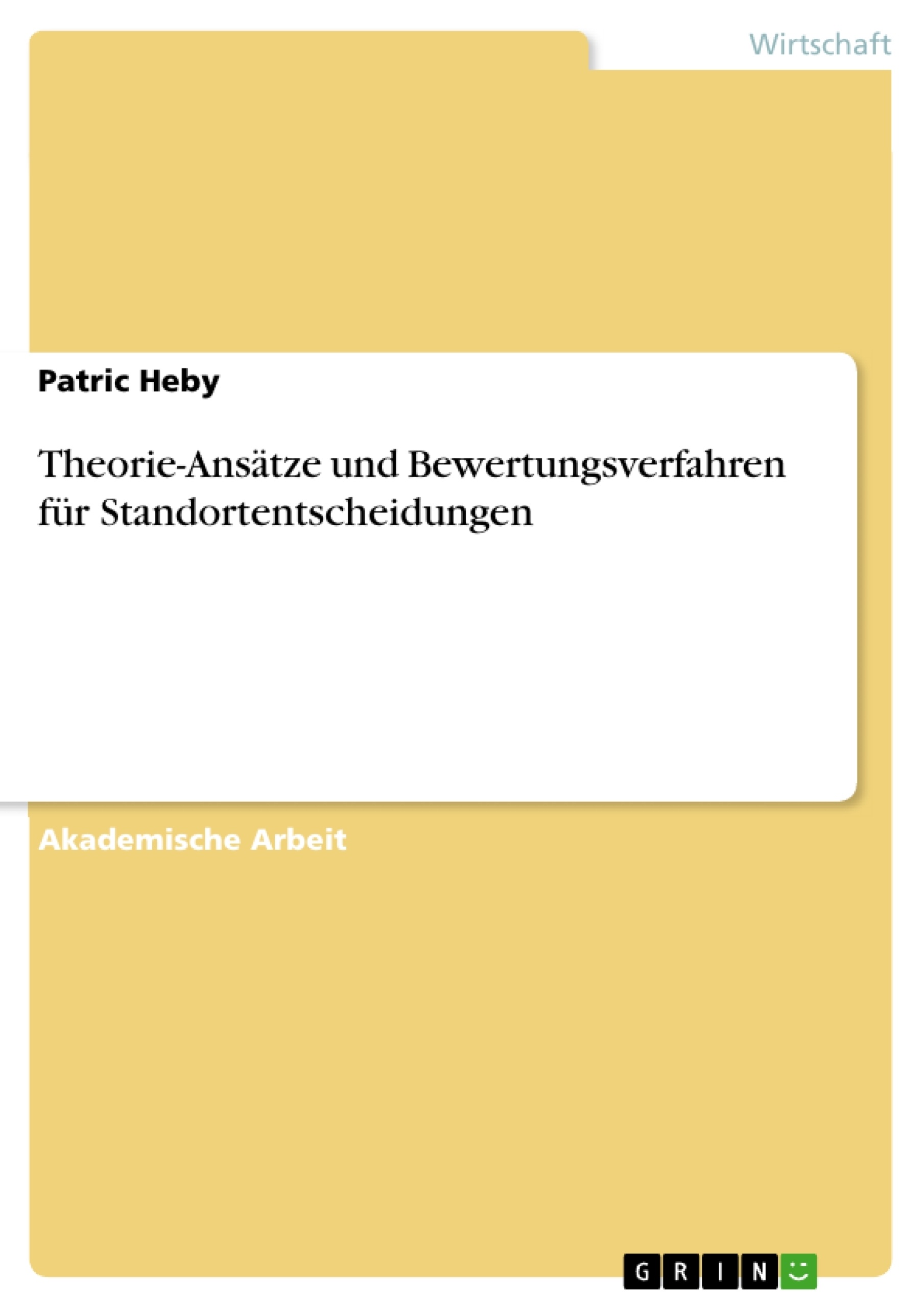Die Standortbestimmungslehre hat ihren Ursprung in der „reinen Theorie des Standortes“ von Alfred Weber. Er führt in seiner Theorie der industriellen Standortwahl den Begriff des Standortfaktors in die Analyse der einzelbetrieblichen Standortwahl ein und zeigt, dass sich die Wahl eines Betriebsstandortes aus dem Zusammenwirken von Standortfaktoren erklären lässt.
Der „Standortfaktor ist einer seiner Art nach scharf abgegrenzter Vorteil, der für eine wirtschaftliche Tätigkeit dann eintritt, wenn sie sich an einem bestimmten Ort oder auch generell an Plätzen bestimmter Art vollzieht“. Ein Faktor ist für die Standortwahl aber nur von Bedeutung, wenn er sich in den Kosten oder Erlösen des Unternehmens monetär oder nicht monetär auswirkt und in Verfügbarkeit, Qualität und/oder Preis räumlich differiert. Daraus ergeben sich für Unternehmen an verschiedenen Standorten jeweils unterschiedliche Bedingungen, die bei einer Standortwahl berücksichtigt werden müssen.
Bei dem System von Weber „handelt es sich um ein statisches und geschlossenes Modell, das sich auf wenige Standortfaktoren konzentriert und die Betrachtung auf die entscheidungsrelevanten Determinanten Transportkosten und Arbeitskosten, sowie die Agglomerationsvorteile und –nachteile einengt. Absatzfaktoren werden im System von Weber völlig ausgeklammert, da das Absatzproblem als bereits gelöst betrachtet wird.“
Auf Grundlage der Arbeit von Weber entwickelte Behrens eine „allgemeine Standortbestimmungslehre“. Ziel dieser Standorttheorie ist die systematische Analyse möglichst aller relevanten Standortfaktoren, von denen betriebliche Standortentscheidungen abhängen. „Gemäß dem betriebswirtschaftlichen Rentabilitätsprinzip berücksichtigt Behrens sowohl kosten- als auch ertragsrelevante Standortfaktoren und ermöglicht dadurch auch den Einbezug der Leistungs- bzw. Absatzseite der Unternehmung. Er unterscheidet in seiner Systematik grundlegend zwischen gütereinsatzbezogenen Faktoren von Beschaffung und Transformation sowie absatzbezogenen Standortfaktoren.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verschiedene Theorieansätze für Standortentscheidungen
- 2.1. Die traditionelle Standorttheorie nach Weber und Behrens
- 2.2 Die monopolistische Theorie der Direktinvestition
- 2.3. Der Ansatz von Tesch
- 2.4. Eklektische Theorie von Dunning
- 2.5. Das EPRG-Modell von Perlmutter und seine Erweiterung durch Meffert
- 2.6. Die Theorie des nationalen Diamanten von Porter
- 2.7. Übersicht über die Standortfaktoren
- 3. Investitionsmotive bei der Standortentscheidung
- 4. Bewertungsverfahren für die Standortentscheidung
- 4.1. Verfahren der Investitionsrechnung
- 4.1.1. Die statischen Investitionsrechnungsverfahren
- 4.1.2. Die dynamischen Investitionsrechnungsverfahren
- 4.1.3. Beurteilung der Investitionsrechnungsverfahren im Zusammenhang mit Standortentscheidungen
- 4.2. Qualitative Bewertungsverfahren
- 4.2.1. Checklisten
- 4.2.2. Nutzwertanalyse
- 4.2.3. Country-Ratings
- 5. Kritische Analyse der Theorien und Bewertungsverfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Theorieansätze und Bewertungsverfahren für Standortentscheidungen, insbesondere im Kontext der Globalisierung und ihrer Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Sie analysiert die Entwicklung von traditionellen Standorttheorien bis hin zu modernen Ansätzen, die die internationalen Aspekte von Investitionsentscheidungen berücksichtigen.
- Traditionelle und moderne Standorttheorien
- Investitionsmotive bei der Standortwahl
- Quantitative und qualitative Bewertungsverfahren
- Der Einfluss der Globalisierung auf Standortentscheidungen
- Kritisches Abwägen verschiedener Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, der sich durch die zunehmende Globalisierung und deren Auswirkungen auf KMU auszeichnet. Die zunehmende Konkurrenz, die Sättigung traditioneller Märkte und der Wunsch nach globaler Präsenz zwingen Unternehmen dazu, ihre Standorte neu zu bewerten und möglicherweise ins Ausland zu expandieren. Diese Einleitung setzt den Rahmen für die folgenden Kapitel, die sich mit verschiedenen Theorien und Methoden zur Standortanalyse auseinandersetzen.
2. Verschiedene Theorieansätze für Standortentscheidungen: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Übersicht verschiedener Theorieansätze zur Standortwahl. Es beginnt mit der traditionellen Standorttheorie nach Weber und Behrens, die sich auf Transport- und Arbeitskosten sowie Agglomerationsvorteile konzentriert. Anschließend werden modernere Ansätze wie die monopolistische Theorie der Direktinvestition, die eklektische Theorie von Dunning und das EPRG-Modell von Perlmutter vorgestellt, die die internationalen Dimensionen der Standortwahl berücksichtigen. Das Kapitel bietet einen Vergleich der verschiedenen Ansätze und hebt deren Stärken und Schwächen hervor, um ein umfassendes Verständnis der theoretischen Grundlagen zu liefern. Besonders wird der Wandel von rein nationalen Betrachtungsweisen hin zu international ausgerichteten Theorien herausgestellt.
3. Investitionsmotive bei der Standortentscheidung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Beweggründe von Unternehmen bei der Entscheidung für einen bestimmten Standort. Es geht über die rein kostenorientierten Ansätze hinaus und berücksichtigt strategische Faktoren, die den Erfolg einer Investition beeinflussen. Hierbei werden qualitative und quantitative Aspekte der Investitionsmotive umfassend beleuchtet, um ein ganzheitliches Bild der Entscheidungsprozesse zu erstellen. Das Kapitel unterstreicht die Komplexität der Entscheidung, indem es diverse Faktoren integriert, die sowohl ökonomischer als auch politischer Natur sein können.
4. Bewertungsverfahren für die Standortentscheidung: Dieses Kapitel widmet sich den Methoden, mit denen Unternehmen potentielle Standorte bewerten. Es werden sowohl quantitative Verfahren der Investitionsrechnung (statisch und dynamisch) als auch qualitative Verfahren wie Checklisten, Nutzwertanalyse und Country-Ratings vorgestellt. Die Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile jeder Methode und zeigt auf, wie diese im Kontext der Standortwahl angewendet werden können und welche spezifischen Vorteile und Nachteile die jeweiligen Verfahren haben. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf einem kritischen Vergleich und einer Hilfestellung für eine fundierte Entscheidungsfindung.
5. Kritische Analyse der Theorien und Bewertungsverfahren: Dieses Kapitel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit den in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Theorien und Methoden. Es analysiert die Grenzen und Annahmen der verschiedenen Ansätze und diskutiert deren Anwendbarkeit in der Praxis. Der kritische Blick auf die Modelle und Methoden soll dazu beitragen, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze zu verstehen und zu bewerten.
Schlüsselwörter
Standortentscheidung, Standorttheorie, Weber, Behrens, Direktinvestition, Globalisierung, Investitionsrechnung, Qualitative Bewertungsverfahren, KMU, Internationalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Standortentscheidungen - Eine umfassende Analyse
Welche Theorieansätze werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht eine Vielzahl von Theorieansätzen zur Standortentscheidung, beginnend mit den traditionellen Ansätzen von Weber und Behrens (fokussiert auf Transport- und Arbeitskosten sowie Agglomerationsvorteile) bis hin zu modernen Ansätzen. Dazu gehören die monopolistische Theorie der Direktinvestition, der Ansatz von Tesch, die eklektische Theorie von Dunning, das EPRG-Modell von Perlmutter (und dessen Erweiterung durch Meffert) und die Theorie des nationalen Diamanten von Porter. Die Arbeit vergleicht diese Ansätze und hebt deren Stärken und Schwächen hervor, wobei der Wandel von nationalen zu internationalen Perspektiven besonders betont wird.
Welche Investitionsmotive werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet nicht nur kostenorientierte Ansätze, sondern auch strategische Faktoren, die den Erfolg einer Investition beeinflussen. Sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Investitionsmotive werden umfassend beleuchtet, um ein ganzheitliches Bild der Entscheidungsprozesse zu erstellen. Die Komplexität der Entscheidung wird durch die Integration ökonomischer und politischer Faktoren unterstrichen.
Welche Bewertungsverfahren werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt sowohl quantitative Verfahren der Investitionsrechnung (statische und dynamische Verfahren) als auch qualitative Verfahren. Zu den letzteren gehören Checklisten, die Nutzwertanalyse und Country-Ratings. Die Vor- und Nachteile jeder Methode werden analysiert, und es wird gezeigt, wie diese im Kontext der Standortwahl angewendet werden können. Der Schwerpunkt liegt auf einem kritischen Vergleich zur Unterstützung einer fundierten Entscheidungsfindung.
Wie wird die Globalisierung in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die zunehmende Globalisierung und deren Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als zentralen Kontext. Die zunehmende Konkurrenz, die Sättigung traditioneller Märkte und der Wunsch nach globaler Präsenz werden als treibende Kräfte für die Neubewertung von Standorten und die Expansion ins Ausland dargestellt. Die Arbeit analysiert, wie die Globalisierung die traditionellen und modernen Standorttheorien beeinflusst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) legt den Kontext fest; Kapitel 2 präsentiert verschiedene Theorieansätze; Kapitel 3 fokussiert auf Investitionsmotive; Kapitel 4 beschreibt Bewertungsverfahren; und Kapitel 5 bietet eine kritische Analyse der vorgestellten Theorien und Methoden. Ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Standortentscheidungen auseinandersetzen, insbesondere für Unternehmen, die ihre internationale Expansionsstrategie planen. Sie ist besonders nützlich für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die sich mit den Herausforderungen der Globalisierung konfrontiert sehen. Die Arbeit bietet sowohl theoretisches Hintergrundwissen als auch praktische Hilfestellung für die Entscheidungsfindung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Standortentscheidung, Standorttheorie, Weber, Behrens, Direktinvestition, Globalisierung, Investitionsrechnung, Qualitative Bewertungsverfahren, KMU, Internationalisierung.
- Quote paper
- Patric Heby (Author), 2004, Theorie-Ansätze und Bewertungsverfahren für Standortentscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282446