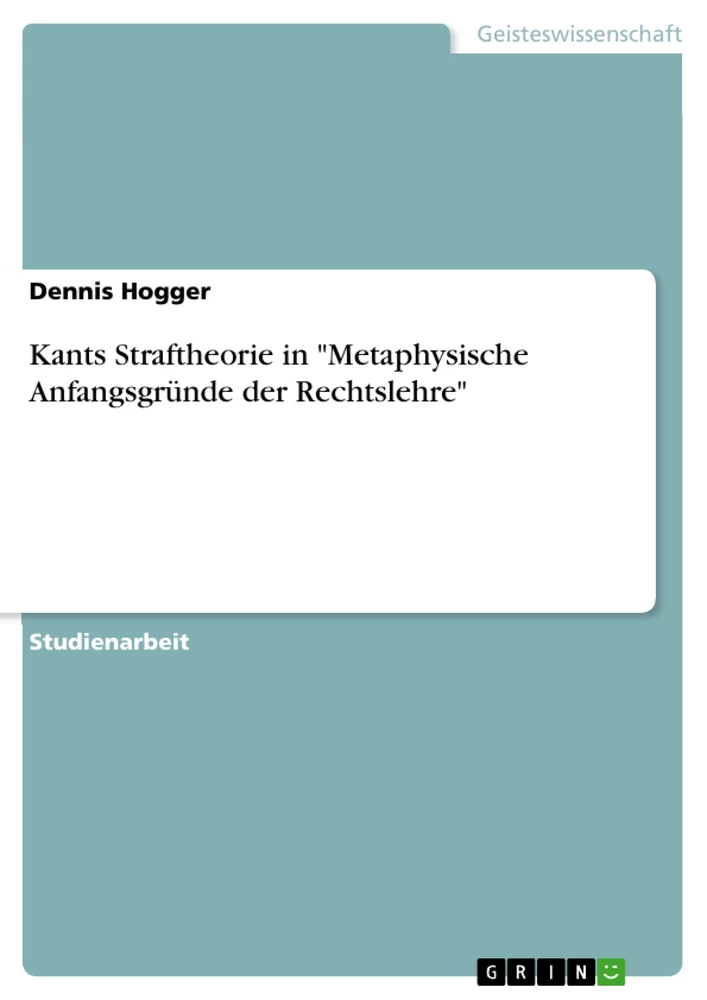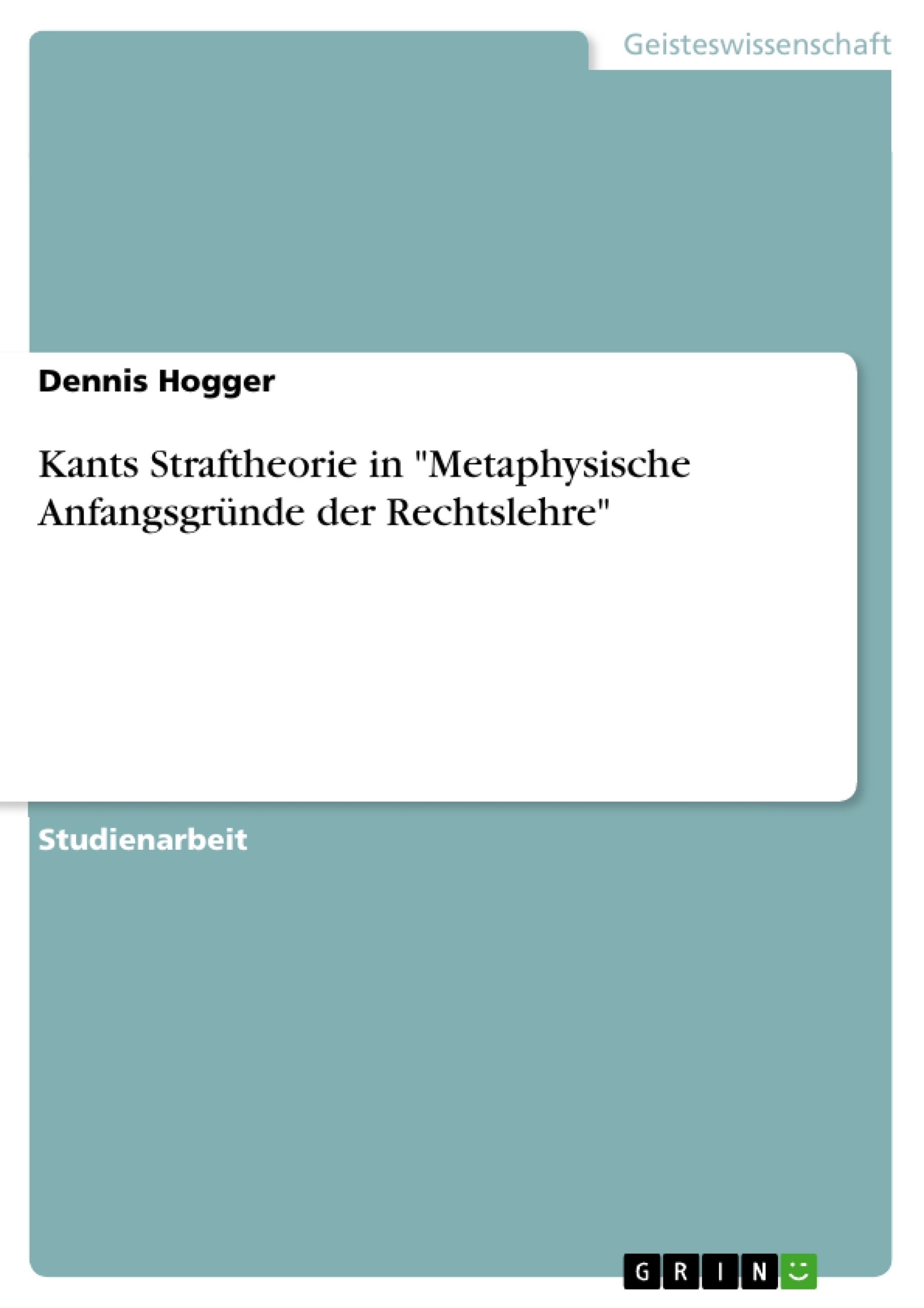„Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat, Schade um Schade, Auge und Auge, Zahn um Zahn; wie er hat einen Menschen verletzt, so soll man ihm wieder tun.“ (Lev 24,19f.)
Dieser berühmte Satz aus dem Alten Testament stellt anschaulich das Rechtsverständnis des frühen israelitischen Volkes dar. Der riesige Fortschritt in der Rechtsgeschichte, der mit den Strafgesetzen in den Büchern Mose gemacht wurde, wird heute nicht bezweifelt. Dennoch ist man natürlich von diesem archaischen Strafverständnis, das Strafe als einfache Vergeltung des Verbrochenen ansieht, abgerückt. Die Strafe im heutigen Rechtsstaat hat mit den primitiven Gesetzen des Alten Testaments nichts mehr zu tun, und diese Entwicklung sieht man auch einstimmig als positiv an.
Demgegenüber verwundert es, wenn man von einem der wichtigsten Denker aller Zeiten, dem Philosophen Immanuel Kant, noch Ende des 18. Jahrhunderts eine Straftheorie präsentiert bekommt, die dem Rechtsverständnis des Alten Testaments an Radikalität gleichkommt. In seiner Metaphysik der Sitten, Teil 1: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre propagiert Kant ein Strafrecht, das allein auf die Vergeltung des Verbrechens gerichtet ist, und jeden darüber hinaus gehenden Zweck der Strafe, wie die Resozialisierung des Täters oder die Abschreckung, ablehnt. Hinzu kommt noch, dass das alttestamentalische Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ von Kant übernommen wird: Als Strafmaß setzt er fest, dass der Täter genau das erleiden solle, was er verbrochen hat.
Dass Kants Straftheorie so kontraintuitiv klingt, sollte aber kein Grund sein, sie zu ignorieren, sondern vielmehr, sie genauer in den Blick zu nehmen. Das soll in dieser Arbeit geschehen. Die Frage, die dabei im Vordergrund stehen soll, ist zunächst einmal die, welche Behauptungen Kant überhaupt aufstellt. Ohne diesen wichtigsten Schritt wird man kaum in der Lage sein, seine Theorie einer sachlichen Analyse und Kritik zu unterziehen. Darauf aufbauend soll untersucht werden, wie sich Kants Straftheorie rechtfertigen lässt, wie sie interpretiert worden ist, und wie man sie kritisieren kann (wobei letzterer Punkt nur eine untergeordnete Rolle spielen wird).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Strafzweck: Kants tatorientierte Straftheorie
- Täterorientierung, Tatorientierung, Ergebnisorientierung: Zur Systematik der Straftheorie
- Eine Begründung für Kants (reine) Tatorientierung
- Ansätze anderer Straftheorien bei Kant
- Das Strafmaß: Kants Begründung des Wiedervergeltungsrechts (ius talionis)
- Definition des ius talionis
- Rechtfertigung des ius talionis
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Immanuel Kants Straftheorie, die sich durch ihre Radikalität auszeichnet und dem alttestamentarischen Rechtsverständnis ähnelt. Sie konzentriert sich auf die Klärung von Kants zentralen Behauptungen und deren Begründung. Die Arbeit analysiert Kants tatorientierte Straftheorie und untersucht die Rechtfertigung seiner Position im Kontext seiner Philosophie.
- Kants tatorientierte Straftheorie im Vergleich zu anderen Straftheorien
- Die Begründung der reinen Tatorientierung bei Kant
- Die Rolle des kategorischen Imperativs in Kants Straftheorie
- Kants Ablehnung von Resozialisierung und Abschreckung als Strafziele
- Das Strafmaß bei Kant und das Prinzip des "Auge um Auge, Zahn um Zahn"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Kants Straftheorie vor, die sich durch ihre Ähnlichkeit zum alttestamentarischen "Auge um Auge, Zahn um Zahn"-Prinzip auszeichnet und im Gegensatz zum modernen Rechtsverständnis steht. Sie hebt die Kontroverse um Kants Theorie hervor und kündigt die Untersuchung der zentralen Behauptungen und deren Rechtfertigung an. Das Hauptproblem der Arbeit liegt in der Knappheit der Quellen, was eine Auseinandersetzung mit anderen Interpretationen erfordert. Die Arbeit teilt Kants Straftheorie in Strafzweck und Strafmaß auf.
Der Strafzweck: Kants tatorientierte Straftheorie: Dieses Kapitel beginnt mit einer systematischen Darstellung verschiedener straftheoretischer Ansätze: Täterorientierung (Resozialisierung), Tatorientierung (Vergeltung) und Ergebnisorientierung (Abschreckung). Kant vertritt eine reine Tatorientierung, die Strafe einzig aufgrund der begangenen Tat rechtfertigt, unabhängig von Zielen der Resozialisierung oder Abschreckung. Die Begründung hierfür findet sich in Kants kategorischem Imperativ, der den Menschen als Zweck an sich und nicht als Mittel zum Zweck betrachtet. Die Diskussion verdeutlicht, warum Kant keine Vereinigungstheorie vertritt und die Instrumentalisierung des Täters ablehnt. Der Abschnitt analysiert den Zusammenhang zwischen Kants Straftheorie und dem kategorischen Imperativ, wobei die unterschiedliche Formulierung beider hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Kant, Straftheorie, Tatorientierung, Vergeltung, kategorischer Imperativ, ius talionis, Strafzweck, Strafmaß, Resozialisierung, Abschreckung, Metaphysik der Sitten, Rechtslehre.
Häufig gestellte Fragen zu: Immanuel Kants Straftheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Immanuel Kants Straftheorie, die sich durch ihre Radikalität und Ähnlichkeit zum alttestamentarischen Rechtsverständnis auszeichnet. Der Fokus liegt auf der Klärung von Kants zentralen Behauptungen und deren Begründung innerhalb seiner Philosophie.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Kants tatorientierte Straftheorie im Vergleich zu anderen Ansätzen (Täter- und Ergebnisorientierung). Sie beleuchtet die Begründung der reinen Tatorientierung durch den kategorischen Imperativ, Kants Ablehnung von Resozialisierung und Abschreckung als Strafziele und das Strafmaß nach dem Prinzip des "Auge um Auge, Zahn um Zahn" (ius talionis).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Strafzweck (Kants tatorientierte Straftheorie), ein Kapitel zum Strafmaß (ius talionis) und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt Kants Straftheorie und hebt die Herausforderungen aufgrund der Knappheit der Quellen hervor. Das Kapitel zum Strafzweck differenziert zwischen Täter-, Tatorientation und Ergebnisorientierung und analysiert Kants Begründung im Kontext des kategorischen Imperativs. Das Kapitel zum Strafmaß befasst sich mit der Definition und Rechtfertigung des ius talionis.
Was ist Kants zentrale These zur Straftheorie?
Kant vertritt eine reine Tatorientierung. Die Strafe wird einzig und allein durch die begangene Tat gerechtfertigt, unabhängig von Zielen wie Resozialisierung oder Abschreckung. Der Täter wird nicht als Mittel zum Zweck betrachtet, sondern als Zweck an sich (kategorischer Imperativ).
Welche Rolle spielt der kategorische Imperativ in Kants Straftheorie?
Der kategorische Imperativ ist zentral für Kants Straftheorie. Er begründet die reine Tatorientierung, indem er die Instrumentalisierung des Täters verbietet und den Menschen als Zweck an sich betrachtet. Die Arbeit hebt jedoch auch die unterschiedliche Formulierung des kategorischen Imperativs in diesem Kontext hervor.
Was ist das ius talionis und wie rechtfertigt Kant es?
Das ius talionis ist das Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Die Arbeit untersucht die Definition und Rechtfertigung dieses Prinzips bei Kant im Kontext seines Strafmaßes. Die genaue Rechtfertigung wird im entsprechenden Kapitel detailliert analysiert.
Welche anderen Straftheorien werden im Vergleich zu Kants Theorie behandelt?
Die Arbeit vergleicht Kants tatorientierte Straftheorie mit der Täterorientierung (fokussiert auf Resozialisierung) und der Ergebnisorientierung (fokussiert auf Abschreckung). Diese Gegenüberstellung dient dazu, Kants Position und deren Begründung besser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kant, Straftheorie, Tatorientierung, Vergeltung, kategorischer Imperativ, ius talionis, Strafzweck, Strafmaß, Resozialisierung, Abschreckung, Metaphysik der Sitten, Rechtslehre.
- Quote paper
- Dennis Hogger (Author), 2014, Kants Straftheorie in "Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282402