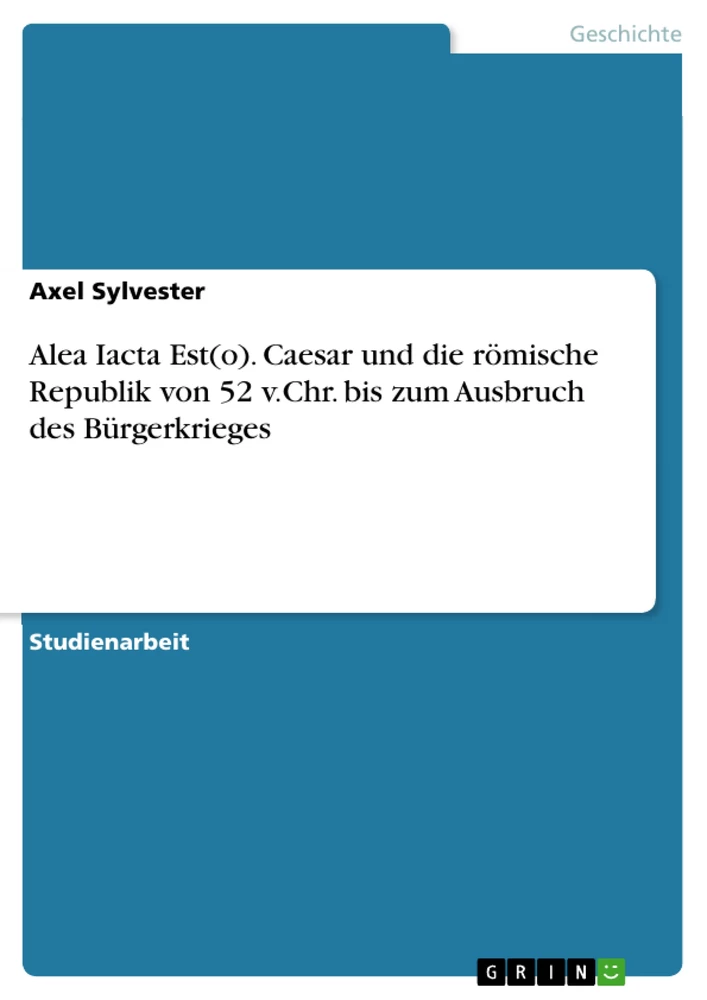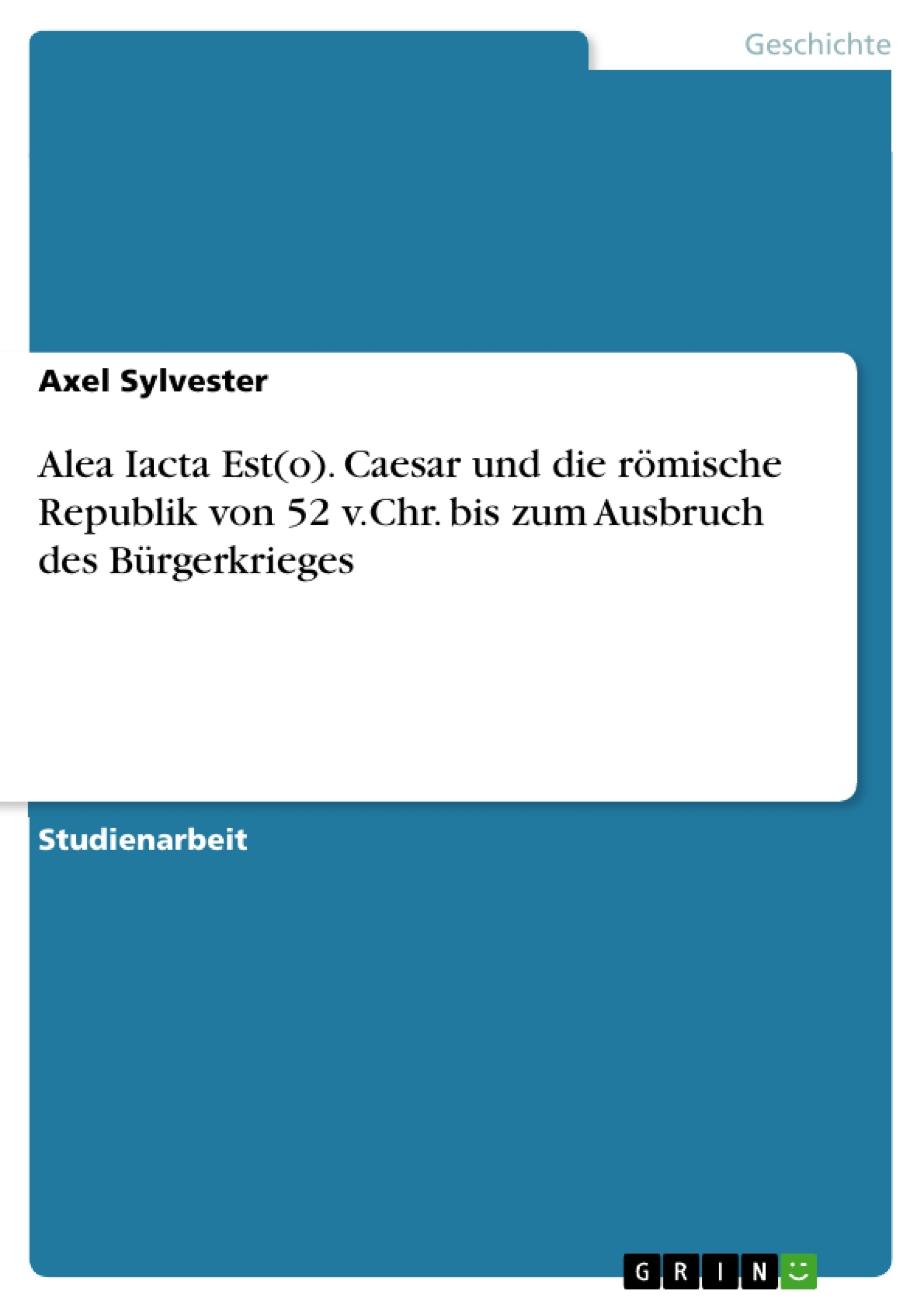Jeder dürfte wohl schon einmal von dem heute etwas abgewandelten Sprichwort, „die Würfel sind gefallen“, welches dem berühmten römischen Feldherren und Politiker Gaius Julius Caesar zugesprochen wird, Gebrauch gemacht haben. Es steht in direktem historischem Zusammenhang zu einem weiteren Sprichwort: „den Rubicon überschreiten“. Der griechische Geschichtsschreiber Plutarch und sein römischer Kollege Sueton zeichneten uns das Bild, aus dem diese Sprichwörter hervorgegangen sind. Mit den Worten: „der Würfel ist gefallen!“ überschritt Caesar mit seinen Soldaten Anfang Januar des Jahres 49 v.Chr. den Grenzfluss Rubicon und machte damit den letzten Schritt in den römischen Bürgerkrieg. Inwieweit jedoch die korrigierte Version: „Der Würfel soll geworfen sein!“ sich besser in die historische Betrachtung einfügt, soll ein Aspekt dieser Arbeit sein. Außerdem folgt die Seminararbeit der Kernfrage: Wie kam es dazu, dass Caesar gegen die bestehende Ordnung in Rom rebellierte und am Ende Römer gegen Römer zu Felde zogen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Caesars Probleme 52/51 v.Chr. – Vercingetorix in Gallien und Gegenwind aus Rom
- Die Lage in Gallien: Das letzte Aufbegehren!?
- Die innenpolitische Lage in Rom 52/51
- Auf dem Weg zum Bürgerkrieg – 50/49
- Auf der Suche nach Kompromissen - das Jahr 50
- Die letzten Verhandlungen…
- Rubicon Der letzte Schritt in den Bürgerkrieg
- Abschließende Betrachtung zum Ausbruch des Bürgerkrieges.
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, wie es zum Ausbruch des römischen Bürgerkriegs kam, insbesondere mit der Rolle Caesars in diesem Prozess. Die Arbeit analysiert die Ereignisse von 52 v.Chr. bis zum Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 49 v.Chr. und untersucht dabei die Herausforderungen, denen Caesar in Gallien und Rom gegenüberstand.
- Der Vercingetorix-Aufstand in Gallien und seine Bedeutung für Caesars politische Karriere
- Die innenpolitische Lage in Rom und die Spannungen zwischen Caesar, Pompeius und dem Senat
- Die Suche nach Kompromissen und die Eskalation der Konflikte zwischen Caesar und Pompeius
- Die Rolle des Rubicon-Übergangs als entscheidender Schritt in den Bürgerkrieg
- Die Bedeutung der Quellen für die Rekonstruktion der Ereignisse und die Interpretation der historischen Situation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt die zentrale Frage nach den Ursachen des römischen Bürgerkriegs. Sie beleuchtet die Bedeutung des Sprichworts „Alea iacta est“ und die Rolle Caesars in der römischen Republik. Die Einleitung stellt außerdem die wichtigsten Quellen und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar.
Das erste Kapitel befasst sich mit den Problemen, denen Caesar im Jahr 52/51 v.Chr. gegenüberstand. Es analysiert den Vercingetorix-Aufstand in Gallien und die innenpolitische Lage in Rom. Das Kapitel beleuchtet die Spannungen zwischen Caesar und Pompeius sowie die Rolle des Senats in der Eskalation der Konflikte.
Das zweite Kapitel untersucht die Ereignisse von 50/49 v.Chr. und die Suche nach Kompromissen zwischen Caesar und Pompeius. Es analysiert die letzten Verhandlungen und den entscheidenden Schritt Caesars, den Rubicon zu überschreiten. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung dieses Schritts für den Ausbruch des Bürgerkriegs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gaius Julius Caesar, die römische Republik, den Bürgerkrieg, den Vercingetorix-Aufstand, Gallien, Pompeius, der Senat, der Rubicon, die Quellenlage und die historische Interpretation.
- Arbeit zitieren
- B.Ed. Axel Sylvester (Autor:in), 2012, Alea Iacta Est(o). Caesar und die römische Republik von 52 v.Chr. bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282384