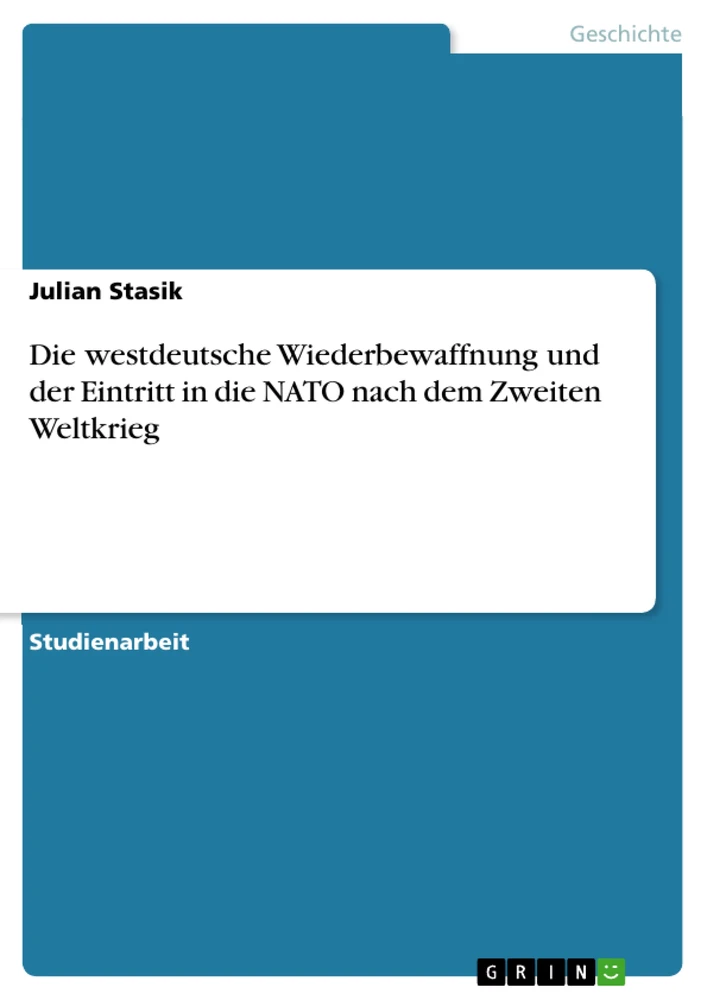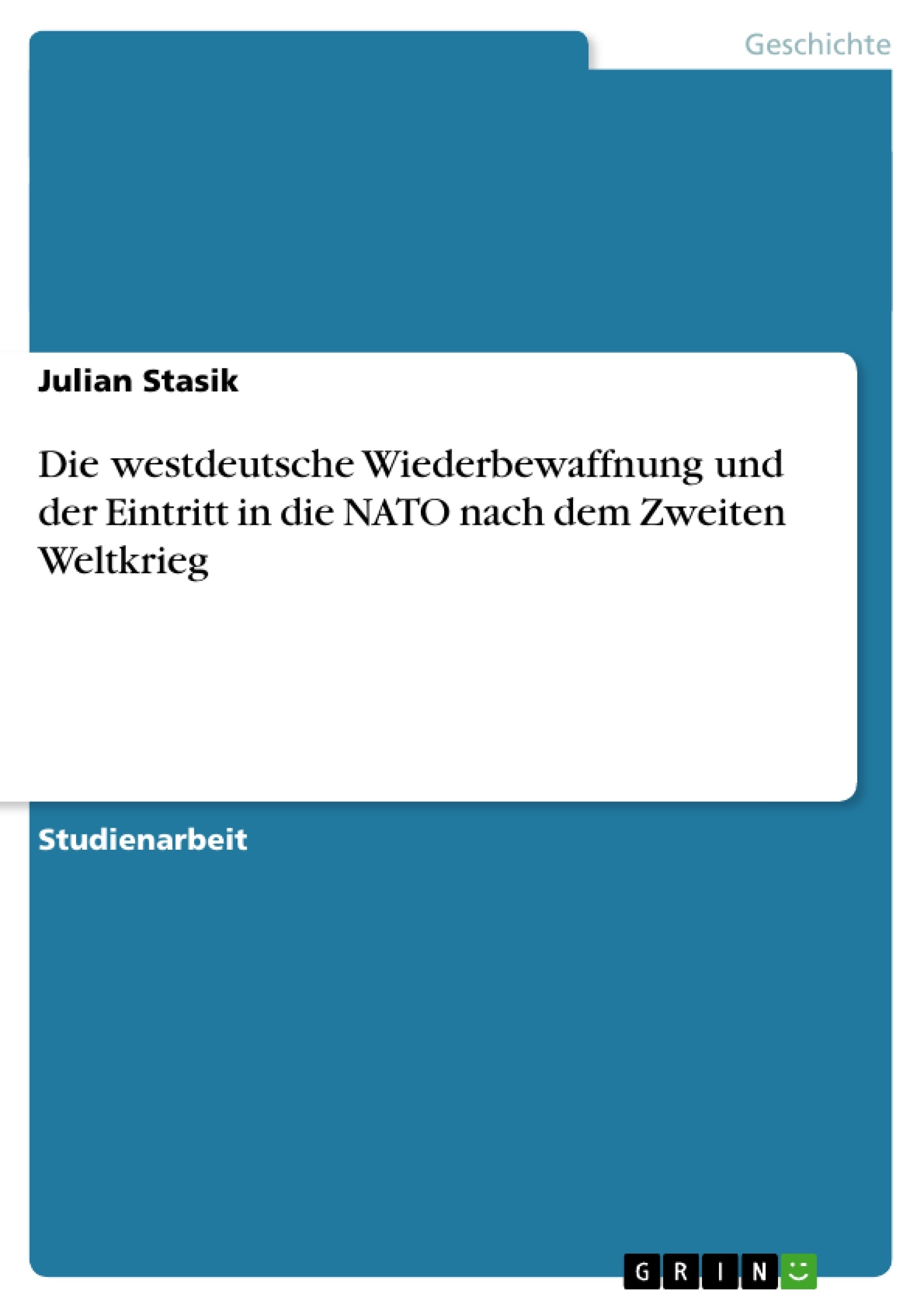Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland war in der internationalen Gemeinschaft nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges ein sehr sensibles Thema, da dieser gerade einmal fünf Jahre zurücklag als die Debatte um eine deutsche Remilitarisierung merklich an Fahrt aufnahm. Folglich war in den ersten Jahren nach Kriegsende weder von deutscher noch von alliierter Seite ein Vorschlag nach einer Wiederbewaffnung zu hören. Dieses änderte sich schlagartig als im Juni 1950 der Koreakrieg ausbrach. Dieser Krieg im Fernen Osten war der erste große Meilenstein des Kalten Krieges und außerdem der erste Stellvertreterkrieg der Geschichte. Durch die von der Sowjetunion unterstützte Invasion Nordkoreas in das von den Amerikanern unterstützte Südkorea entstand in der Welt die Furcht, die Sowjetunion könne eine ähnliche Invasion über Westdeutschland auf ganz Westeuropa planen. Aufgrund dieser Tatsache war die militärische Situation Westdeutschlands plötzlich von allen beteiligten Parteien neu zu bewerten. Für die Alliierten zum Beispiel war die neugegründete Bundesrepublik enorm wichtig als Puffer vor der Sowjetunion. Diese Stellung lässt sich sowohl politisch als auch geographisch erklären. Folglich gab es in den Jahren nach dem Kriegsausbruch in Korea zahlreiche Konferenzen auf denen intensiv das Für und Wider einer westdeutschen Aufrüstung debattiert wurde.
Der Fokus dieser Hausarbeit liegt daher auf Frankreich, den USA und der Bundesrepublik (hier im speziellen auf Bundeskanzler Konrad Adenauer), welche als politische Akteure unterschiedliche Ziele in der Wiederbewaffnungsdebatte hatten und natürlich auch andere Pläne verfolgten, um diese Ziele zu verwirklichen. Die Betrachtung der Ziele der USA und Frankreich als korporative Akteure und die Ziele Konrad Adenauers als individuellen Akteur als Gegenpol dient dazu, zwei Aspekte der akteurszentrierte Politikwissenschaft in der Hausarbeit zu beleuchten.
Dieser akteurszentrierten Herangehensweise wird die Fragestellung „Wie war eine westdeutsche Wiederaufrüstung so wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges möglich und welche Ziele verfolgten die beteiligten Akteure in jener Debatte?“ sowie die These „Die Regierungen von USA und Frankreich waren bezüglich der westdeutschen Wiederaufrüstung korporative Akteure, welche ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgten“ zugrunde gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Akteurszentrierte Politikwissenschaft:
- Lage Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg sowie der Weg in die NATO:
- Die deutsche Wiederaufrüstung und der Weg in die NATO:
- Beteiligte Akteure außerhalb der BRD und deren Ziele in der Wiederbewaffnungsdebatte:
- Beteiligte Akteure innerhalb der BRD und deren Ziele in der Wiederbewaffnungsdebatte:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der westdeutschen Wiederbewaffnung und dem Eintritt in die NATO nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Fokus liegt dabei auf den Zielen der beteiligten Akteure, insbesondere den USA, Frankreich und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die Arbeit analysiert die Debatte um die Remilitarisierung Westdeutschlands unter Anwendung der akteurszentrierten Politikwissenschaft, insbesondere die Rolle von korporativen und individuellen Akteuren.
- Die Rolle des Koreakriegs als Auslöser für die Wiederbewaffnungsdebatte
- Die Interessen der USA und Frankreichs in Bezug auf die deutsche Wiederbewaffnung
- Die Ziele von Bundeskanzler Adenauer und die Herausforderungen der innerdeutschen Debatte
- Die Auswirkungen der Wiederbewaffnung auf die Westintegration und die deutsche Sicherheit
- Die Anwendung der akteurszentrierten Politikwissenschaft zur Analyse der Entscheidungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Einleitung und stellt die Fragestellung sowie die These der Hausarbeit vor. Das zweite Kapitel erläutert die akteurszentrierte Politikwissenschaft und definiert die Begriffe individueller, kollektiver und korporativer Akteure. Im dritten Kapitel wird die Lage Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben, wobei die Situation nach der Kapitulation, die wirtschaftlichen Herausforderungen und der Einfluss des Marshall-Plans auf den Wiederaufbau thematisiert werden. Der Koreakrieg als Wendepunkt in der westdeutschen Politik wird ebenfalls behandelt und seine Bedeutung für die Wiederbewaffnungsdebatte hervorgehoben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Zielen der beteiligten Akteure in der Wiederbewaffnungsdebatte. Dabei werden die Ziele der USA, Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland untersucht. Der Fokus liegt auf der Rolle von Konrad Adenauer als individueller Akteur und die Bedeutung der innerdeutschen Debatte um die Wiederbewaffnung. Der Abschnitt behandelt auch die Ziele der SPD als Oppositionskraft.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: westdeutsche Wiederbewaffnung, NATO-Beitritt, Koreakrieg, akteurszentrierte Politikwissenschaft, korporative Akteure, individuelle Akteure, Bundeskanzler Konrad Adenauer, USA, Frankreich, Westintegration, Sicherheit, innerdeutsche Debatte, SPD, Pluralismus.
- Quote paper
- Julian Stasik (Author), 2014, Die westdeutsche Wiederbewaffnung und der Eintritt in die NATO nach dem Zweiten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282269