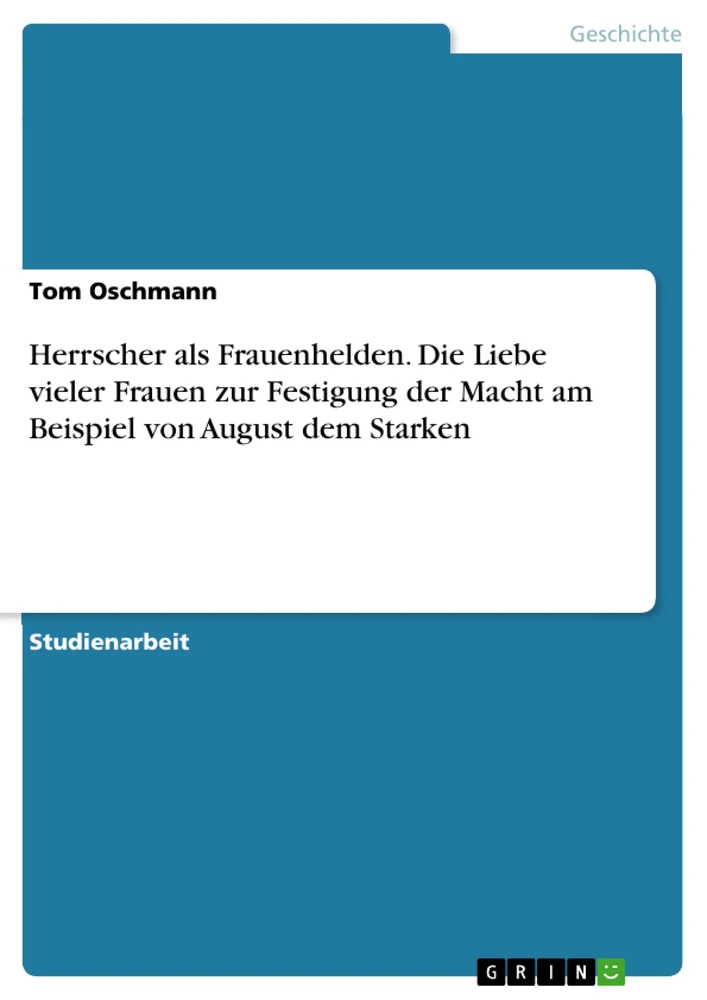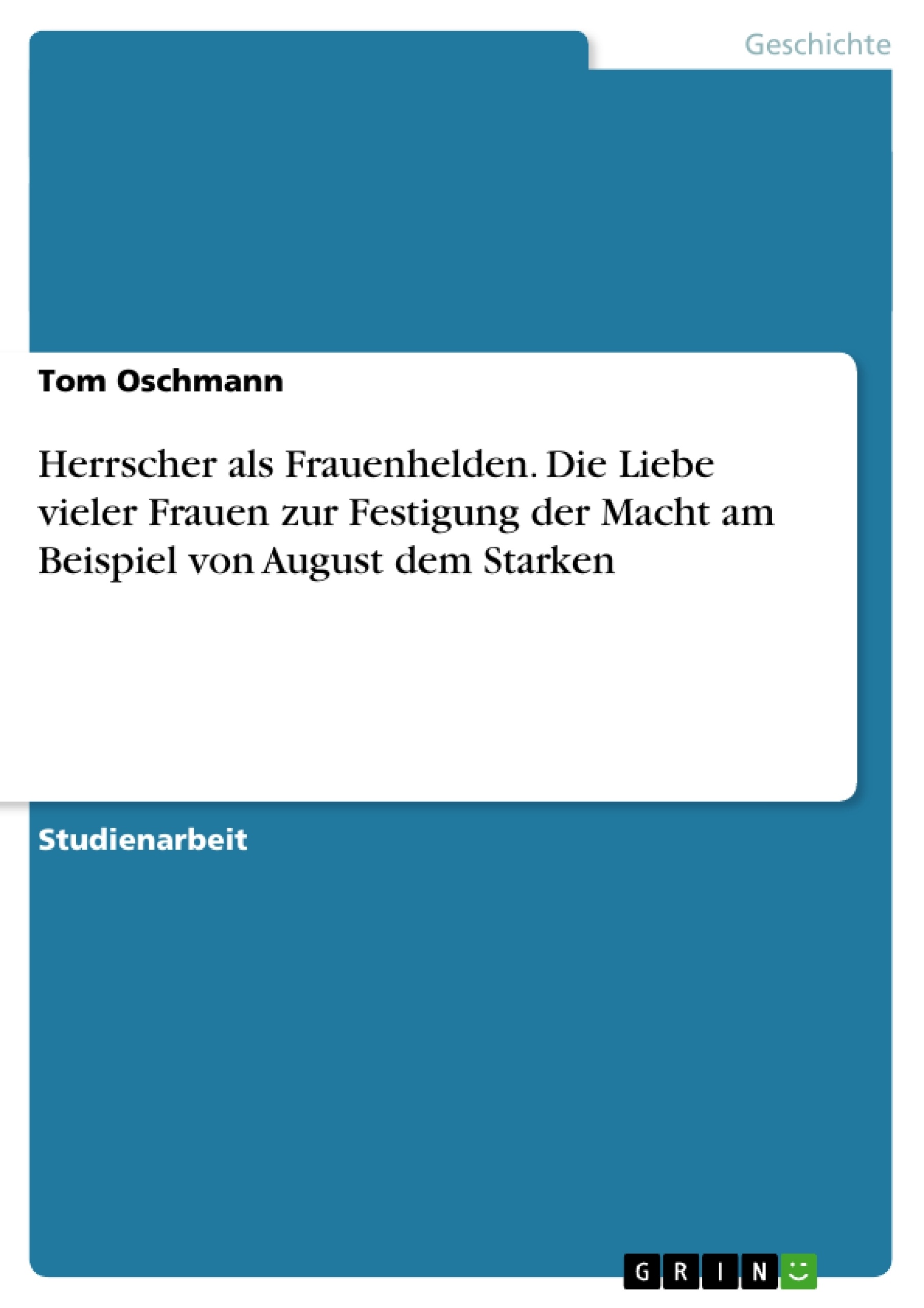Die Macht eines Herrschers drückte sich in der Frühen Neuzeit für viele in kriegerischen Aktivitäten aus. Dieser Fakt ist ein wesentliches Merkmal um seine eigene politische Macht zu manifestieren. Antje Stannek sieht als weiteren Punkt zur Festigung der politischen Macht: „In höfischen Gesellschaften manifestiert sich die politische Virilität eines Herrschers ganz direkt in seiner sexuellen Potenz.“ Die Herausbildung dieser Männlichkeit beginnt dabei schon mit den Kavallierstouren im Ausland, wo junge Adlige ihre ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machten. Ein Herrscher hatte, auch nachdem er verheiratet war, noch Geliebte, sogenannte Mätressen, denen er sich widmete und die er der Öffentlichkeit präsentierte. In der Frühen Neuzeit galten besonders der französische König Henry IV. und auch August der Starke, König von Polen, als Frauenhelden, ihnen wurden unzählige Affären angedichtet.
In der Literatur finden sich explizit zu dem Thema „Herrscher als Frauenhelden und dieser Einfluss auf die politische Macht“ sehr wenig gesonderte Werke. Katherine B. Crawfords Aufsatz „The Politics of Promiscuity: Masculinity and Heroic Representation at the Court of Henry IV.“ zählt zu diesen wenigen Werken. Das Thema wird meistens nur angerissen und als solches nicht wirklich beachtet. Gerade die deutschsprachige Literatur weist zu diesem Themenbereich keinerlei spezielle Werke auf.
Anhand des Beispiels August des Starken versucht die vorliegende Hausarbeit die punktuellen Sachverhalte der Literatur zusammenzuführen und einen Standpunkt zu diesem Thema herauszuarbeiten. Der Aufsatz versucht folgende Fragestellungen zu beantworten: „Herrscher als Frauenhelden, wann ist ein Herrscher ein Frauenheld?“, „Zeigt sich die sexuelle Potenz darin, dass ihm die Frauen zu Füßen liegen?“, „Wie ist das Verhalten der Frauen?“ und „Wie drückt sich die sexuelle Potenz für die Umwelt des Herrschers aus?“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Friedrich August und die Frauen
- August der Starke und seine Mätressen
- Darstellung der Potenz - Feste am sächsischen Hof
- Die Grundsätze der Religionen und ihre Beachtung für August
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Liebesleben Augusts des Starken, um zu erforschen, inwiefern die Darstellung eines „Frauenhelden“ zur Festigung seiner politischen Macht beitrug. Die Arbeit untersucht, wie Augusts zahlreiche Affären in den Kontext der damaligen gesellschaftlichen Normen und Erwartungen eingebettet waren.
- Augusts Image als „Frauenheld“ und seine Auswirkungen auf sein politisches Ansehen
- Die Rolle von Mätressen am sächsischen Hof und ihre öffentliche Repräsentation
- Die Beziehung zwischen Augusts Liebesleben und seinen politischen Zielen
- Der Einfluss der religiösen Moralvorstellungen auf die private Lebensführung des Herrschers
- Die Konstruktion von Männlichkeit und Potenz in der Frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die historische Bedeutung des Themas „Herrscher als Frauenhelden“ im Kontext der Frühen Neuzeit. Kapitel 2 widmet sich der Biographie Augusts des Starken und untersucht seinen Ruf als Frauenheld im Detail. Dabei werden sowohl die Fakten als auch die Legenden rund um seine zahlreichen Affären betrachtet. Kapitel 3 analysiert die Rolle der Feste am sächsischen Hof und die Präsentation der Potenz des Herrschers in diesem Kontext. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den religiösen Normen und der Frage, inwieweit Augusts Verhalten mit den Moralvorstellungen der Zeit konform ging. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
August der Starke, Frauenheld, Mätresse, politische Macht, Herrschaftsabsicherung, frühe Neuzeit, gesellschaftliche Normen, Moral, Religion, Potenz, Männlichkeit, Repräsentation, Feste, Karneval.
- Quote paper
- Tom Oschmann (Author), 2011, Herrscher als Frauenhelden. Die Liebe vieler Frauen zur Festigung der Macht am Beispiel von August dem Starken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282217