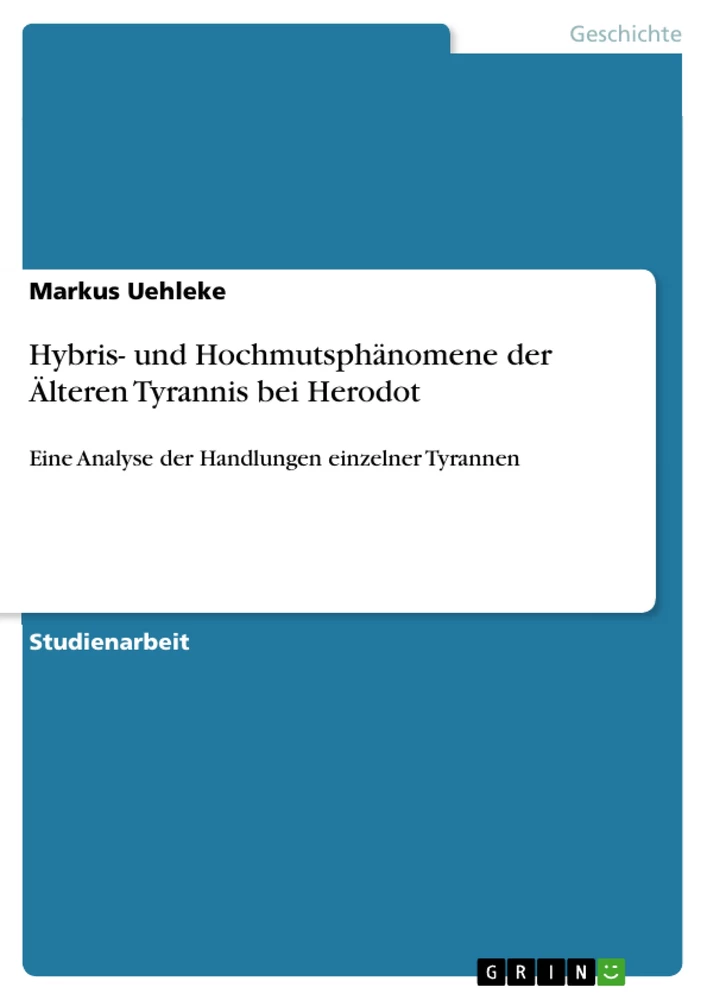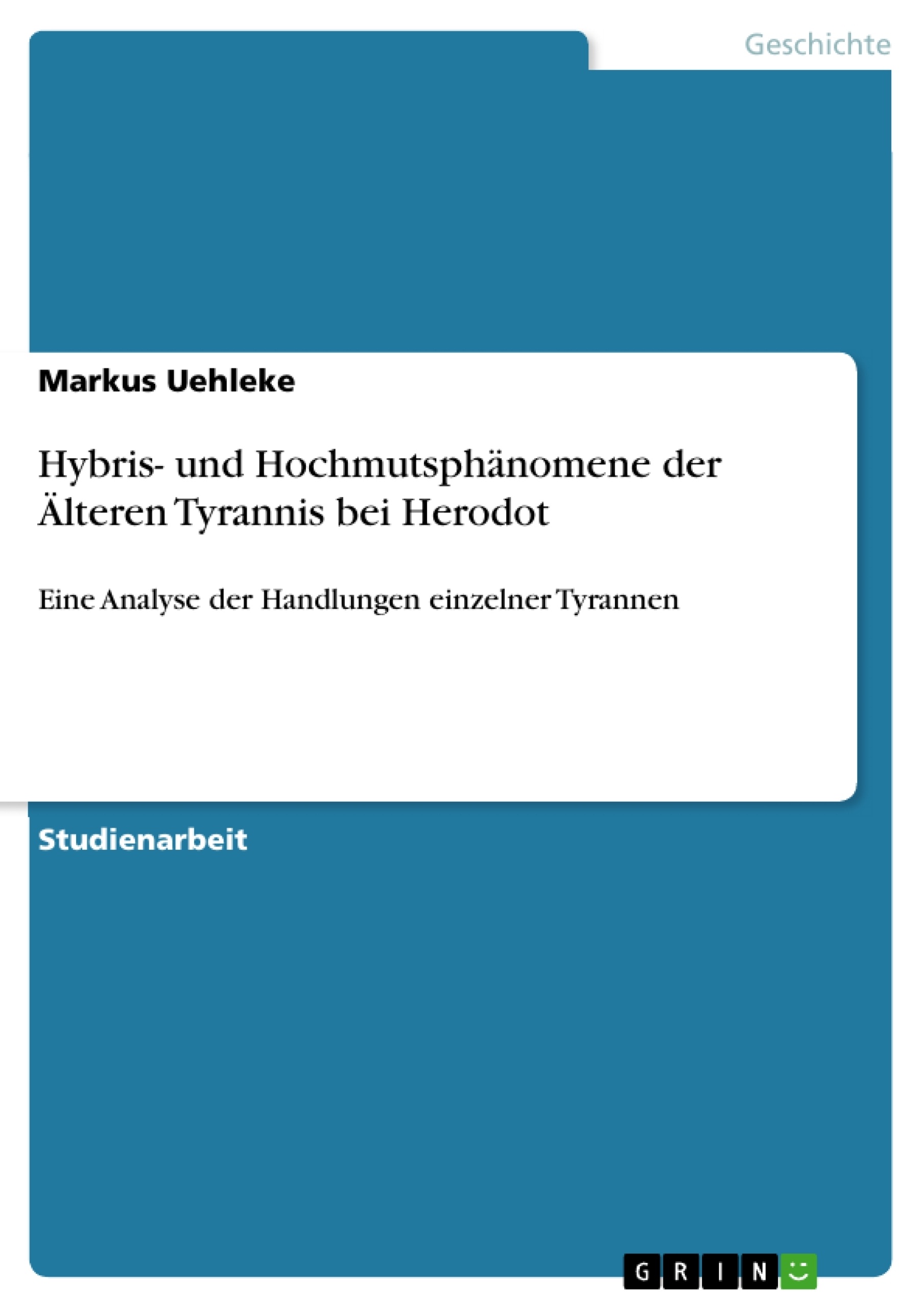Der Begriff „Tyrann“ hat im Laufe der Jahrhunderte eine Wandlung auf mehreren Ebenen erfahren. Was eigentlich den Inhaber eines griechisch-antiken Ausnahmeamtes bezeichnete, ist heute zu einer Herabwürdigung des Charakters eines Menschen geworden. Dass der Tyrann der Antike dabei bereits in der zeitgenössischen Literatur neben seinem politischen Wirken vor allem aber persönlich beurteilt worden ist, kann kein Zufall sein, wenn man annimmt, dass es zur Errichtung einer Tyrannis eines ganz speziellen Charakters bedarf. Die vorliegende Arbeit hat es sich zum zwar nicht zum Ziel gemacht, eine solche Charakterologie zu entwerfen, stattdessen versucht sie aber, den Begriff der Tyrannis an seinen nähesten Quellen und ersten Bedeutungswandlungen zu untersuchen. Trotz der Anreicherung historischer Zeugnisse bleibt die Methode dieses Versuches weitestgehend phänomenologisch, d.h. es werden zunächst einige in Wesen, Bedeutung und Intention abgrenzende Begriffsbestimmungen vorangestellt, um deutlich zu machen, in welchen Zusammenhängen die geeigneten Charakterattribute zu verwenden seien. Daran schließt sich eine Aufteilung der untersuchten Begriffe in jene, die tatsächlich auf die antiken Tyrannen zutreffend sein mögen und in jene, die möglicherweise auf eine intentionalisierte und daher ahistorische Überlieferung zurückzuführen sein könnten. Dabei ist allein schon die Frage bemerkenswert, wieso es überhaupt zu einer fast durchweg negativ-anekdotenhaften Überlieferung gekommen war, wenn gleich nicht alle antiken Autoren ein negatives Gesamtbild der Tyrannen zeichnen, was natürlich im Hauptteil dieser Arbeit noch zu zeigen sein wird. Um die Aufteilung in ein historisch zutreffendes oder eventuell ahistorisches Begriffsverständnis vorzunehmen, wird es von zudem Interesse sein, einen Blick auf die damaligen ethischen Selbstanforderungen der Aristokratie zu werfen. So könnte diese Arbeit letztlich unter dem Forschungsaspekt stehen, zu zeigen, dass das Bild des Tyrannen nicht zufällig äußerst ambivalent überliefert worden ist, da wohl ebenso in der Antike bestimmte, im Hauptteil zu untersuchende Persönlichkeitsmerkmale, einem ethischen und gesellschaftlichen Urteil unterlegen haben müssen und es gerade diese Unentschiedenheit ist, inwiefern gewisse Charakterattribute als tugendhaft oder moralisch verwerflich anzusehen seien, die auch die ambivalente Überlieferung bedingen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Intention und Methodik
- Hauptteil
- B. Philosophischer Teil
- I. Begriffsbestimmung des Hochmuts
- I.1 Der Hochmut und seine Abgrenzungen
- I.2 Mögliche Antonymbestimmung
- I.3 Synonymbestimmung und mögliche Steigerung
- II. Die aristotelische Ethik über die Hochgesinntheit
- II.1 Warum der Hochmut erstrebenswert ist
- II.2 Der Zusammenhang der aristotelischen Ethik und Staatstheorie
- II.3 Konklusion und Rückbezug zur Forschungsfrage
- C. Historischer Teil
- III. Transfer des philosophischen Teils auf die Historien
- III.1 Überleitung und Intention
- III.2 Peisistratos
- III.3 Aristagoras
- III.4 Histiaios
- III.5 Exkurs zu Herodots politischen Tendenzen
- III.6 Kypselos
- III.7 Periandros
- Zusammenfassung/Schluss
- D. Auswertung und Ausblick
- E. Quellen- und Literaturverzeichnis
- Entwicklung des Begriffs „Tyrann“ in der Antike
- Charaktereigenschaften von Tyrannen
- Hochmut als Charaktermerkmal
- Ethische Normen der Antike
- Ambivalenz des Tyrannenbildes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Begriffs „Tyrann“ in der Antike und untersucht, wie dieser Begriff in der Literatur der Zeit verwendet wurde. Sie analysiert die Charaktereigenschaften von Tyrannen, insbesondere den Hochmut, und setzt diese in Beziehung zu den ethischen Normen der damaligen Zeit. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ambivalenz des Tyrannenbildes in der Antike zu erklären und die Bedeutung des Hochmuts als Charaktermerkmal zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Intention und Methodik der Arbeit vor. Sie erläutert, dass der Begriff „Tyrann“ im Laufe der Zeit eine Wandlung erfahren hat und dass die Arbeit den Begriff an seinen ursprünglichen Quellen untersucht. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob es möglich ist, die Charaktereigenschaften von Menschen aus der Antike zu beschreiben, ohne in Anachronismen zu verfallen. Sie argumentiert, dass menschliche Charaktere, zumindest in ihren Stereotypen, über eine gewisse Konsistenz verfügen, die es ermöglicht, sie auch in vergangenen Zeiten zu beschreiben.
Der philosophische Teil der Arbeit befasst sich mit der Begriffsbestimmung des Hochmuts. Er grenzt den Hochmut von anderen Begriffen wie Stolz, Übermut, Eigendünkel und Eitelkeit ab. Der Abschnitt untersucht die möglichen Antonyme des Hochmuts und stellt fest, dass der Begriff der Kleinmut am treffendsten das Gegenteil des Hochmuts bezeichnet. Der Abschnitt analysiert auch die Synonyme des Hochmuts und stellt fest, dass der Begriff der „Hochgesinntheit“ am besten geeignet ist, den Hochmut zu beschreiben.
Der historische Teil der Arbeit untersucht die Anwendung des Begriffs „Tyrann“ auf historische Persönlichkeiten. Er analysiert die Charaktereigenschaften von Tyrannen wie Peisistratos, Aristagoras, Histiaios, Kypselos und Periandros und setzt diese in Beziehung zu den ethischen Normen der damaligen Zeit. Der Abschnitt untersucht auch die politischen Tendenzen des Historikers Herodot und analysiert, wie er die Tyrannen in seinen Werken darstellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff „Tyrann“, Hochmut, Hybris, Aristotelische Ethik, Hochgesinntheit, Kleinmut, Herodot, Antike, Charaktereigenschaften, ethische Normen, Ambivalenz, Stereotypen, Anachronismen, differentielle Psychologie, lexikalische Hypothese, Phänomenologie, historische Quellen, politische Tendenzen.
- Quote paper
- Markus Uehleke (Author), 2010, Hybris- und Hochmutsphänomene der Älteren Tyrannis bei Herodot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281992