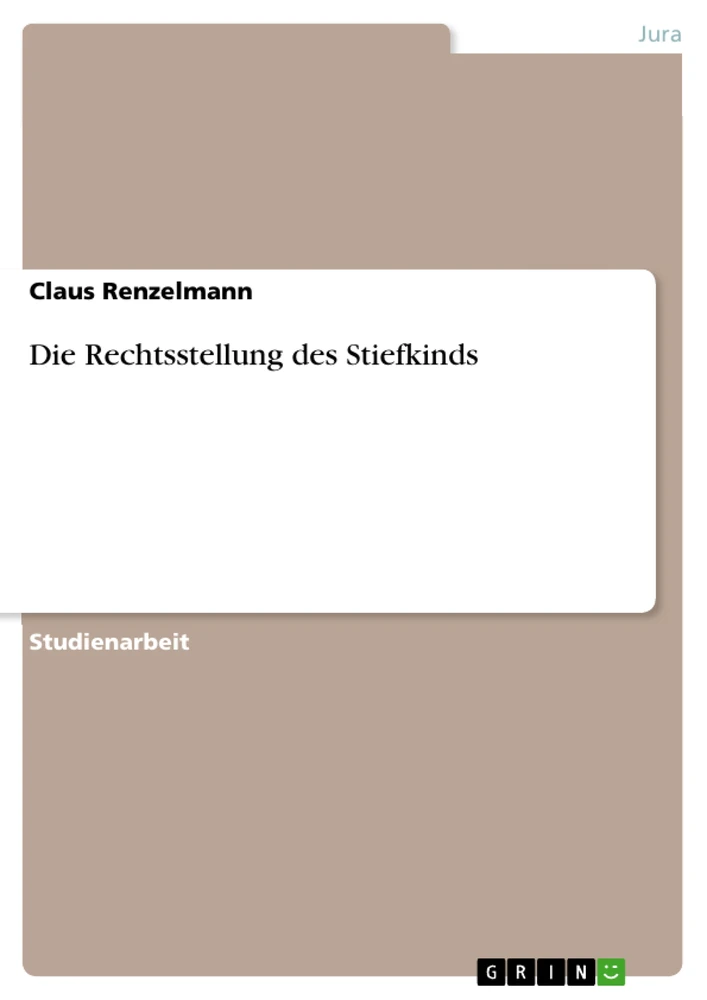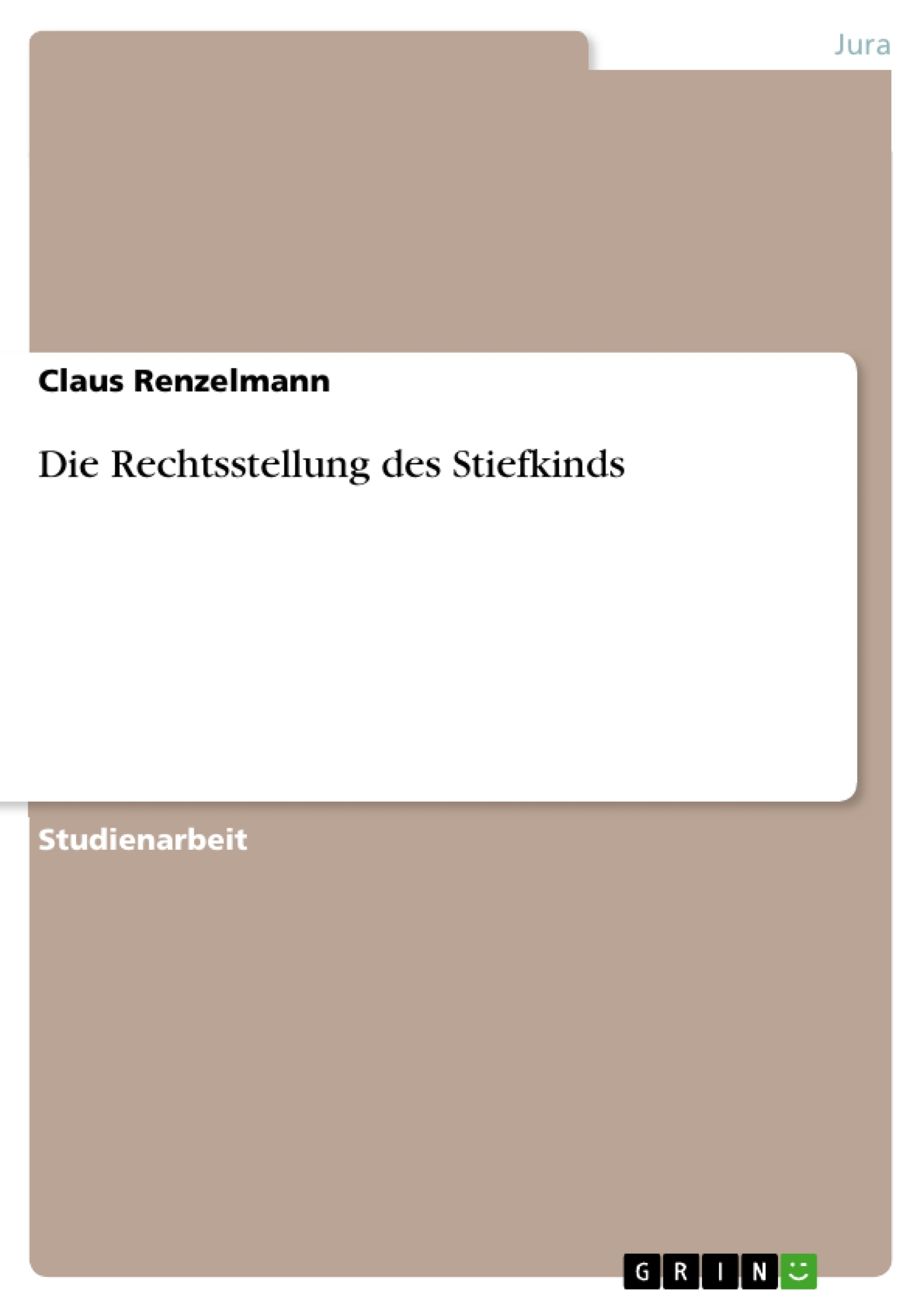Das Bürgerliche Gesetzbuch gibt keine Legaldefinition für das Stiefkind oder das Stiefkindverhältnis. Nicht einmal der Begriff „Stiefkind“ taucht im BGB auf. Die Rechtsliteratur versteht unter Stiefkindern solche Kinder, die nur zu einem Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis stehen, zum anderen aber nicht. Die Arbeit untersucht die Rechtsstellung der Stiefkinder durch sämtliche Rechtsgebiete.
Inhaltsverzeichnis
- A) Begriff und Problemstellung
- I) Begrifflichkeiten im Stiefkindverhältnis
- 1) Schwägerschaft
- 2) Faktische Elternschaft
- 3) Stiefkind gleich Scheidungskind
- 4) Stiefkind im allgemeinen Sprachgebrauch
- 5) Stiefkind als juristischer Begriff
- a) Ehe des sorgeberechtigten und des Stiefelternteils
- b) Eltern-Kind-Verhältnis
- aa) Eheliches Kind
- bb) Adoptivkind
- cc) Halbwaisen und Scheidungswaisen
- dd) Nichteheliches Kind
- c) Zeitliche Begrenzung
- aa) Erreichen der Volljährigkeit
- bb) Auflösung der Stiefehe
- d) Lebensgemeinschaft von Stiefkind und Stiefelternteil
- e) Ergebnis
- II) Problemstellung
- 1) Prüfungsumfang
- 2) Schrifttum zum Stiefkind
- 3) Aktuelle Problematik
- B) Das Stiefkind im System des Bürgerlichen Rechts
- I) Sorgerecht
- II) Unterhaltsrecht
- III) Erbrecht
- IV) Sonstige Bürgerlich-rechtliche Auswirkungen
- C) Das Stiefkindverhältnis aus strafrechtlicher Sicht
- I) Elterliches Züchtigungsrecht
- II) Garantenstellung
- III) §§ 174, 180 StGB
- IV) Weitere Modifikationen
- D) Das Stiefkind im öffentlichen Recht
- I) Steuerrecht
- II) Namensrecht - die Problematik der Einbenennung
- III) Sozialrecht
- IV) Prozeßrecht
- E) Zusammenfassung
- I) Bestehender Rechtszustand
- II) Rechtspolitischer Handlungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die rechtliche Stellung des Stiefkindes im deutschen Rechtssystem. Ziel ist es, die bestehenden Rechtslücken und Problematiken aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Aspekte aus verschiedenen Perspektiven, sowohl zivil- als auch straf- und öffentlich-rechtlich.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Stiefkindverhältnisses
- Sorgerecht, Unterhaltsrecht und Erbrecht des Stiefkindes
- Strafrechtliche Relevanz des Stiefkindverhältnisses
- Öffentlich-rechtliche Aspekte (Steuerrecht, Namensrecht, Sozialrecht)
- Diskussion bestehender Rechtslücken und Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
A) Begriff und Problemstellung: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den Begriff "Stiefkind" präzisiert und verschiedene Perspektiven (Sprachgebrauch, juristische Definition) beleuchtet. Es werden die zentralen Herausforderungen und die bestehende Rechtsunsicherheit hinsichtlich der rechtlichen Stellung des Stiefkindes herausgestellt, welche die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel bildet. Die unterschiedlichen Definitionen und die damit verbundene Problematik des fehlenden einheitlichen juristischen Begriffs werden ausführlich erörtert. Die Kapitel 1 und 2 bieten einen umfassenden Überblick über die bestehenden Diskussionspunkte und den Forschungsstand zum Thema.
B) Das Stiefkind im System des Bürgerlichen Rechts: Dieser Abschnitt analysiert die rechtliche Position des Stiefkindes im BGB, insbesondere in Bezug auf Sorgerecht, Unterhaltsrecht und Erbrecht. Die verschiedenen Möglichkeiten der Sorgerechtsübertragung auf den Stiefelternteil werden detailliert untersucht, ebenso wie die rechtlichen Grundlagen des Unterhaltsanspruches und die erbrechtlichen Ansprüche. Die Ausführungen betrachten sowohl die gesetzliche Lage als auch verschiedene Lösungsansätze, die in der Literatur diskutiert werden. Das Kapitel geht auch auf sonstige zivilrechtliche Auswirkungen ein, wie z.B. die rechtsgeschäftliche Vertretung durch den Stiefelternteil.
C) Das Stiefkindverhältnis aus strafrechtlicher Sicht: Dieses Kapitel widmet sich der strafrechtlichen Relevanz des Stiefkindverhältnisses. Es untersucht die Frage der Garantenstellung des Stiefelternteils und beleuchtet relevante Straftatbestände im Kontext der Beziehung zwischen Stiefkind und Stiefelternteil. Die Diskussion umfasst die Aspekte des elterlichen Züchtigungsrechts und weiterer möglicher strafrechtlicher Implikationen.
D) Das Stiefkind im öffentlichen Recht: Hier werden die öffentlich-rechtlichen Aspekte der Stiefkindstellung behandelt. Die Kapitel befassen sich mit steuerrechtlichen Fragen (Erbschaftssteuer, Einkommenssteuer), dem Namensrecht (inkl. Einbenennungsproblematik und Rechtsprechung des BVerwG) und verschiedenen sozialrechtlichen Aspekten (Hilfe zum Lebensunterhalt, Kindergeld, Renten-, Unfall- und Krankenversicherung). Die komplexen Interaktionen zwischen Stiefkind und öffentlichen Institutionen werden umfassend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Stiefkind, Sorgerecht, Unterhaltsrecht, Erbrecht, Bürgerliches Recht, Strafrecht, Öffentliches Recht, Stiefelternteil, Adoption, Namensrecht, Sozialrecht, Rechtslücken, Rechtsprechung, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Das Stiefkind im deutschen Recht
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die rechtliche Stellung des Stiefkindes im deutschen Rechtssystem. Sie beleuchtet die bestehenden Rechtslücken und Problematiken und diskutiert mögliche Lösungsansätze. Die Arbeit betrachtet zivil-, straf- und öffentlich-rechtliche Aspekte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Stiefkindverhältnisses, Sorgerecht, Unterhaltsrecht und Erbrecht des Stiefkindes, strafrechtliche Relevanz des Stiefkindverhältnisses, öffentlich-rechtliche Aspekte (Steuerrecht, Namensrecht, Sozialrecht) und die Diskussion bestehender Rechtslücken und Lösungsansätze.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel: A) Begriff und Problemstellung (Definition, Problemstellung, Forschungsstand); B) Das Stiefkind im System des Bürgerlichen Rechts (Sorgerecht, Unterhaltsrecht, Erbrecht, weitere zivilrechtliche Auswirkungen); C) Das Stiefkindverhältnis aus strafrechtlicher Sicht (Garantenstellung, Straftatbestände, Züchtigungsrecht); D) Das Stiefkind im öffentlichen Recht (Steuerrecht, Namensrecht, Sozialrecht, Prozessrecht); E) Zusammenfassung (bestehendes Recht, rechtspolitischer Handlungsbedarf). Jedes Kapitel ist in Unterkapitel und -punkte weiter unterteilt (siehe Inhaltsverzeichnis).
Wie wird der Begriff "Stiefkind" definiert?
Die Arbeit untersucht den Begriff "Stiefkind" aus verschiedenen Perspektiven: allgemeiner Sprachgebrauch, juristische Definition (Berücksichtigung der Ehe des sorgeberechtigten und Stiefelternteils, des Eltern-Kind-Verhältnisses, der zeitlichen Begrenzung, der Lebensgemeinschaft). Die unterschiedlichen Definitionen und die damit verbundene Problematik des fehlenden einheitlichen juristischen Begriffs werden ausführlich erörtert.
Welche zivilrechtlichen Aspekte werden behandelt?
Im zivilrechtlichen Teil werden das Sorgerecht, das Unterhaltsrecht und das Erbrecht des Stiefkindes detailliert analysiert. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Sorgerechtsübertragung auf den Stiefelternteil, die rechtlichen Grundlagen des Unterhaltsanspruches und die erbrechtlichen Ansprüche beleuchtet. Die Ausführungen betrachten die gesetzliche Lage und diskutieren verschiedene Lösungsansätze aus der Literatur.
Welche strafrechtlichen Aspekte werden behandelt?
Der strafrechtliche Teil untersucht die Garantenstellung des Stiefelternteils und beleuchtet relevante Straftatbestände im Kontext der Beziehung zwischen Stiefkind und Stiefelternteil. Die Diskussion umfasst Aspekte des elterlichen Züchtigungsrechts und weitere mögliche strafrechtliche Implikationen.
Welche öffentlich-rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Der öffentlich-rechtliche Teil befasst sich mit steuerrechtlichen Fragen (Erbschaftssteuer, Einkommenssteuer), dem Namensrecht (inkl. Einbenennungsproblematik und Rechtsprechung des BVerwG) und verschiedenen sozialrechtlichen Aspekten (Hilfe zum Lebensunterhalt, Kindergeld, Renten-, Unfall- und Krankenversicherung).
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Zusammenfassung fasst den bestehenden Rechtszustand zusammen und diskutiert den rechtspolitischen Handlungsbedarf. Es werden die aufgedeckten Rechtslücken und die Notwendigkeit möglicher Gesetzesänderungen oder anderer Lösungsansätze beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Stiefkind, Sorgerecht, Unterhaltsrecht, Erbrecht, Bürgerliches Recht, Strafrecht, Öffentliches Recht, Stiefelternteil, Adoption, Namensrecht, Sozialrecht, Rechtslücken, Rechtsprechung, Lösungsansätze.
- Quote paper
- Claus Renzelmann (Author), 1996, Die Rechtsstellung des Stiefkinds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281775