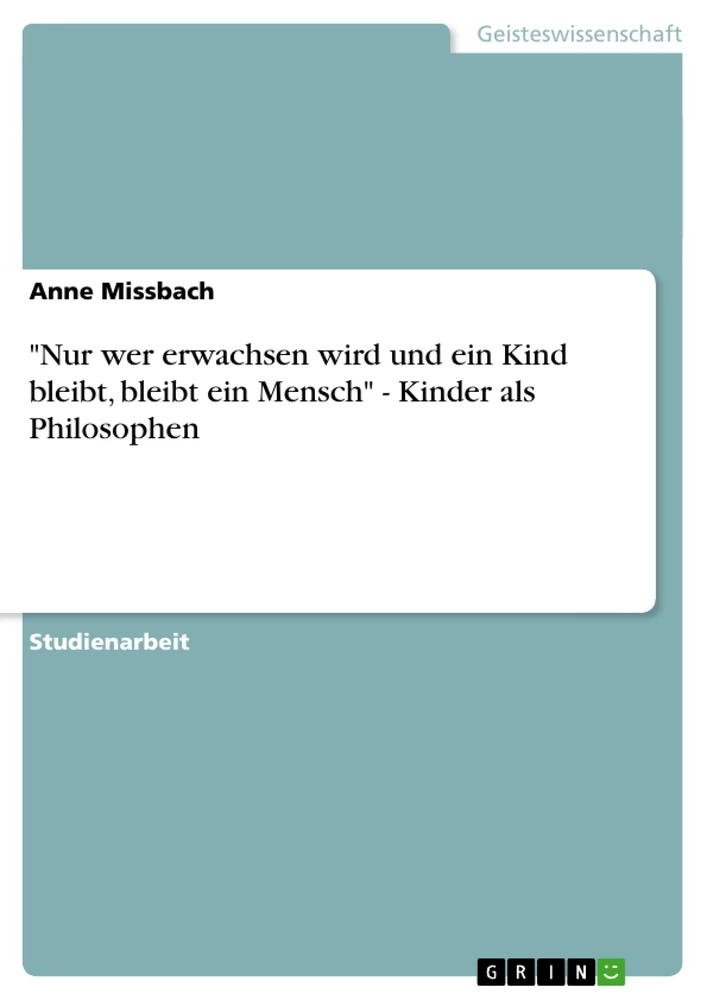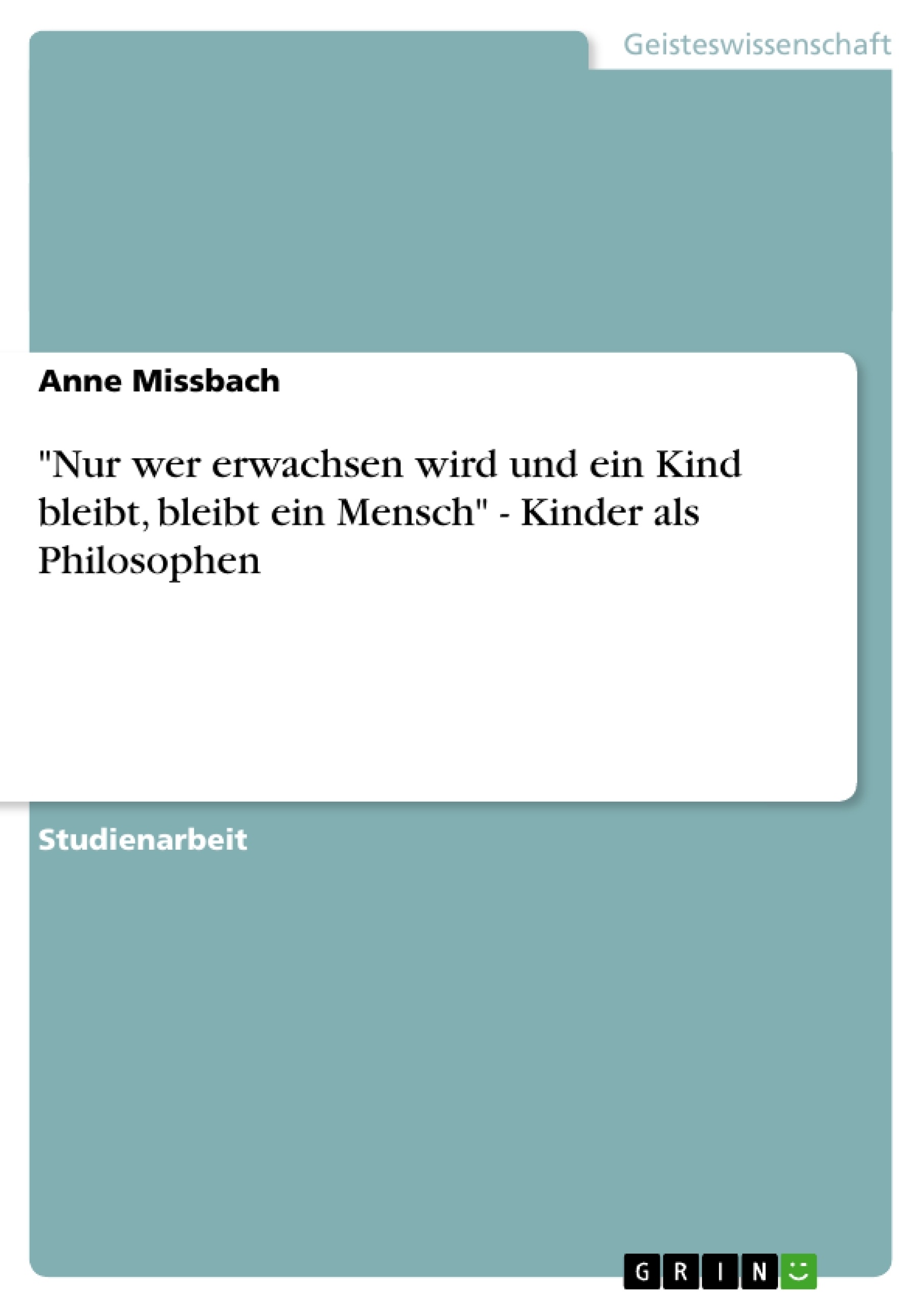Die folgenden Überlegungen werden damit eingeleitet, was philosophieren bedeutet.
Kinder können das besonders gut und bringen das Potential dazu mit, weswegen sie förderungswert sind. Dazu bedarf es aber einerseits der Erkenntnis von Seiten der Erwachsenen, dass in Kindern kleine Philosophen stecken und zum anderen der Überwindung von tradierten Erziehungs- und Sozialisationsmustern.
Trotz der Vorteile, die ein Ausbauen der kindlichen Philosophie mit sich bringen würde, sieht die Praxis so aus, dass Erwachsene all zu oft auf ihren „Wissensvorsprung“ beharren und die kindliche Neugier im Keim ersticken.
Auf Begründungen der Aussage, dass Kinder Philosophen sind, folgen zwei Beispiele kindlicher Naivität, die konkret zeigen, was das Geniale der „Kinderphilosophen“ ausmacht.
Kapitel 5 ordnet Piagets entwicklungspsychologische Theorie der kognitiven Entwicklung kritisch ein. Piaget ist an „Normalvarianten“ interessiert, während unkonventionelle Antworten der Kinder für die Philosophie einen größeren Reiz darstellen.
Kapitel 6 zeigt neben Fehlverhalten und Problemen der Erwachsenen auch soziologische Aspekte auf, die förderlich oder eben auch hinderlich für den kindlichen Erkundungsdrang sein können.
Ein weiterer Abschnitt der Arbeit wird durch Aufgreifen des Buches „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupery gebildet, welches Parallelen zur Thematik beinhaltet. Das poetische Prosawerk enthält die Botschaft an den Leser, den Kindern mehr Beachtung zu schenken und lässt deren Genialität auf kreative Weise erscheinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Philosophieren? Was ist das?
- Warum Kinder per se bessere Philosophen sind
- Beispiele kindlichen Staunens
- kognitive Grenzen
- Pragmatische Gesichtspunkte
- Exkurs: „Der kleine Prinz“
- Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die philosophischen Fähigkeiten von Kindern und argumentiert, dass Kinder aufgrund ihrer natürlichen Neugier, ihres Staunens und ihrer Offenheit für neue Ideen bessere Philosophen sein können als Erwachsene. Die Arbeit analysiert, wie kindliche Naivität und unkonventionelle Denkweisen einen wichtigen Beitrag zum philosophischen Diskurs leisten können.
- Das philosophische Potential von Kindern
- Die Bedeutung von Neugier und Staunen für philosophisches Denken
- Die Rolle der kindlichen Naivität und Unkonventionalität
- Kritik an traditionellen pädagogischen Ansätzen, die die kindliche Neugier unterdrücken
- Das Beispiel des „Kleinen Prinzen“ als Metapher für kindliche Genialität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Grundthese der Arbeit vor, dass Kinder aufgrund ihrer natürlichen Neugier und ihrer Fähigkeit zum kritischen Denken bessere Philosophen sein können als Erwachsene. Es wird die Notwendigkeit einer Veränderung in pädagogischen Ansätzen gefordert, um die kindliche Philosophie zu fördern.
- Philosophieren? Was ist das?: In diesem Kapitel werden die grundlegenden Elemente des Philosophierens erläutert. Es wird betont, dass das Philosophieren Fragen stellt, hinterfragt, staunt, neugierig ist und kritisch denkt. Die Fähigkeit zum Philosophieren wird als ein wichtiges Werkzeug für die Persönlichkeitsentwicklung und die kritische Auseinandersetzung mit der Welt betrachtet.
- Warum Kinder per se bessere Philosophen sind: Dieses Kapitel untersucht, warum Kinder aufgrund ihrer natürlichen Neugier, ihres Staunens und ihrer Offenheit für neue Ideen bessere Voraussetzungen für das Philosophieren haben. Es wird argumentiert, dass die Unkonventionalität und Naivität von Kindern eine wertvolle Ressource für die philosophische Diskussion darstellt.
- Beispiele kindlichen Staunens: Dieses Kapitel liefert konkrete Beispiele aus dem Alltag, die die philosophische Neugier und Kreativität von Kindern veranschaulichen. Diese Beispiele sollen zeigen, wie Kinder in der Lage sind, einfache Fragen zu stellen, die tiefgreifende philosophische Implikationen haben.
- kognitive Grenzen: In diesem Kapitel wird die Theorie der kognitiven Entwicklung von Jean Piaget kritisch betrachtet. Es wird argumentiert, dass Piagets Fokus auf „Normalvarianten“ die Unkonventionalität von Kindern, die für die Philosophie von großer Bedeutung ist, übersieht.
- Pragmatische Gesichtspunkte: Dieses Kapitel untersucht die soziologischen Aspekte, die das Philosophieren von Kindern fördern oder behindern können. Es werden sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen eines eigenständigen und kritischen Denkens in der heutigen Gesellschaft diskutiert.
- Exkurs: „Der kleine Prinz“: Dieses Kapitel analysiert Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ als Beispiel für die Wichtigkeit, die kindliche Perspektive ernst zu nehmen. Die Geschichte des kleinen Prinzen wird als Metapher für die Genialität und Weisheit von Kindern interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kindliche Philosophie, Neugier, Staunen, Unkonventionalität, Naivität, Kritische Denken, Pädagogische Ansätze, Philosophische Methoden, Jean Piaget, „Der kleine Prinz“, Antoine de Saint-Exupéry.
- Quote paper
- Anne Missbach (Author), 2004, "Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, bleibt ein Mensch" - Kinder als Philosophen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28142