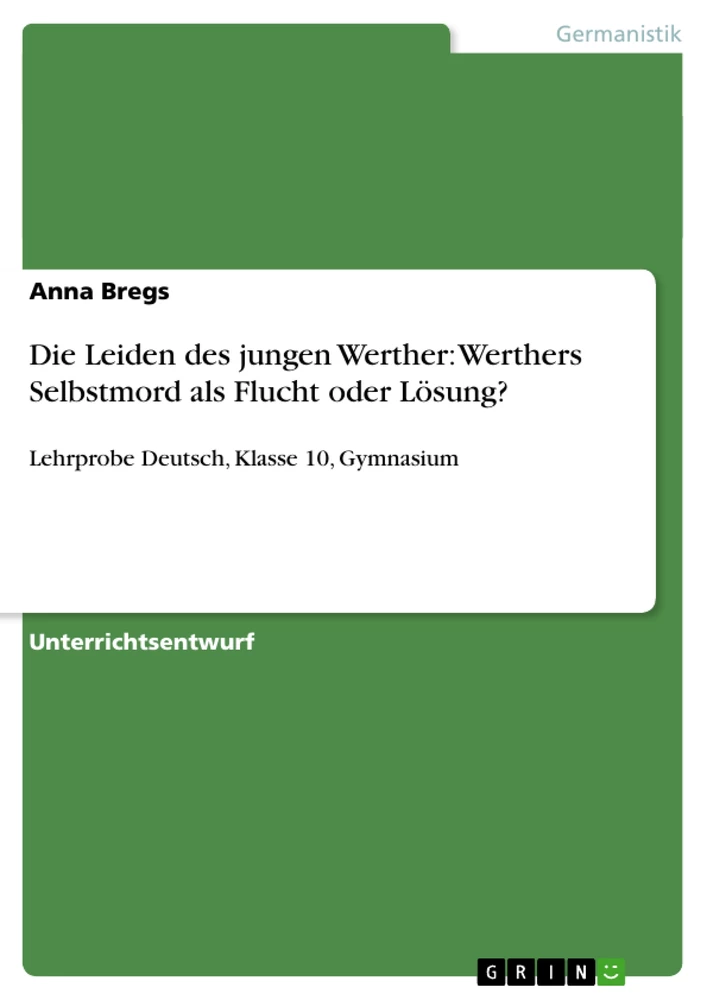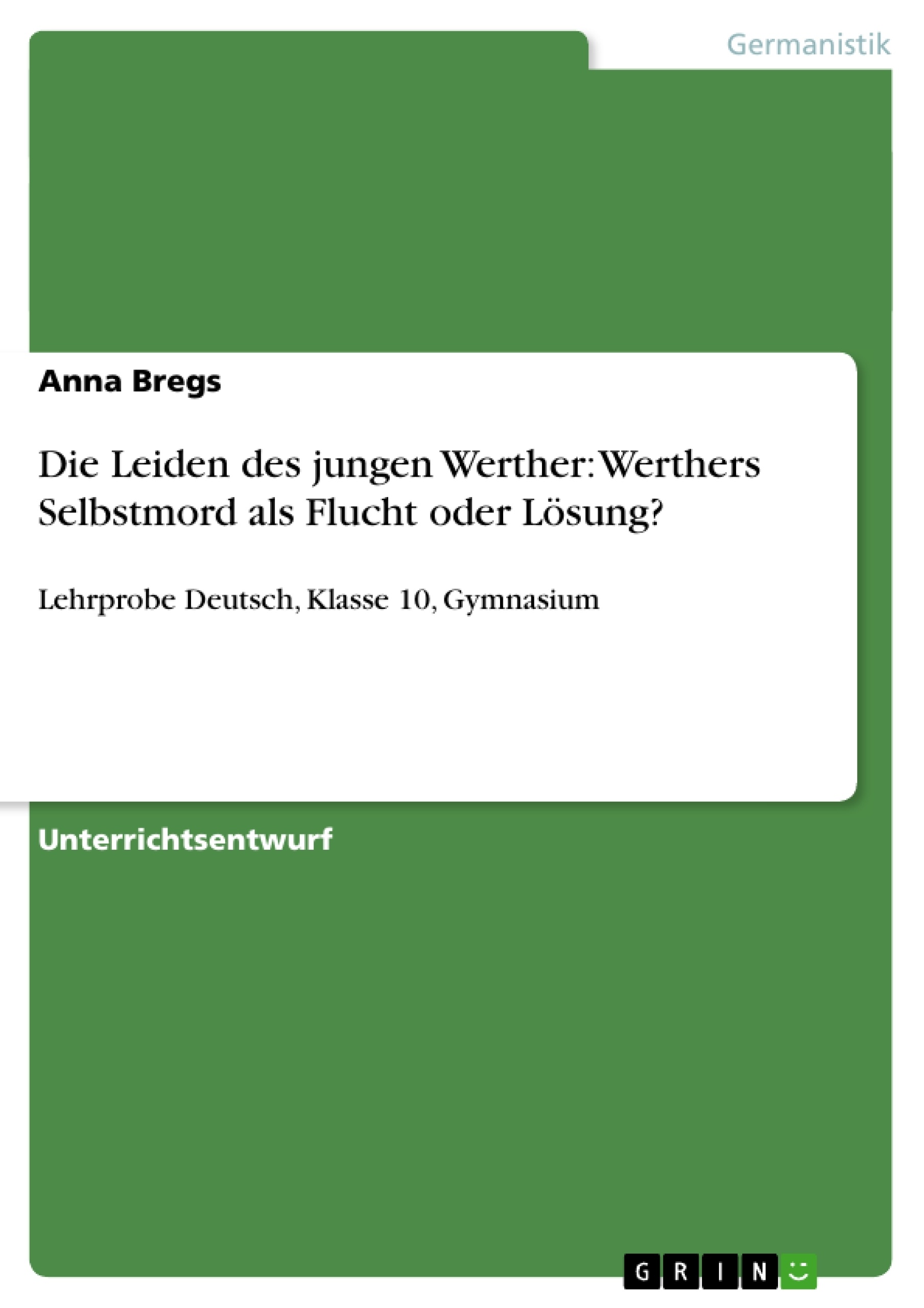Im Vordergrund der Stunde steht die Förderung der Kompetenzen aus den Arbeitsbereichen Schreiben und Lesen, die miteinander verknüpft sind.
In der ersten Erarbeitungsphase erwerben die Schüler Wissen über Anzeichen von Suizidgefährdeten, indem sie einen nichtliterarischen Text (Flyer) nutzen und dessen Inhalt und Aussage auf Textausschnitte des literarischen Textes übertragen („Inhalt und Aussage eines Textes erfassen können“, „Wahrnehmungsfähigkeit erweitern, bestimmte Verhaltensweisen kennenlernen und deuten“ --> Persönlichkeitsbildung). Die Schüler erkennen die Bandbreite von Werthers Selbstmordanzeichen.
Durch das gestaltende Interpretieren in Form eines Briefes von Wilhelm an Werthers Mutter setzen sich die Schüler mit den Motiven von Werthers Selbstmord auseinander („Interpretation und produktiver Umgang mit Texten“, Charakterisierung Werthers unter dem Aspekt des Selbstmordes) und erkennen die Vielschichtigkeit (Scheitern in der Liebe, in der Gesellschaft und im Beruf). Dazu ist es nötig, dass die Schüler das bereits erworbene Wissen zu den Themen unter dem Aspekt des Selbstmordes zusammenführen, was zu einer Vertiefung führt.
Die Schüler beschäftigen sich auf der Grundlage ihrer Ergebnisse mit der Frage, ob sein Selbstmord unausweichlich war. Es soll deutlich werden, dass Werthers Selbstmord aufgrund seines Charakters unvermeidlich ist und von ihm als Stürmer und Dränger als Akt der Befreiung gesehen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Analyse des Lehr- und Lernfeldes
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Ziele der Unterrichtsstunde
- Methodische Analyse
- Literaturangaben
- Tabellarischer Unterrichtsverlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtsplanung zielt darauf ab, die Schüler*innen der Klasse 10c im Umgang mit dem komplexen Thema Selbstmord im Kontext von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ zu schulen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Lesekompetenz, der Fähigkeit zur Textinterpretation und der Förderung der Schreibkompetenz. Die Schüler*innen sollen die vielschichtigen Ursachen von Werthers Suizid verstehen und ihren persönlichen Umgang mit diesem sensiblen Thema reflektieren.
- Analyse von Suizidindikatoren in literarischen und nicht-literarischen Texten
- Interpretation der Motive von Werthers Selbstmord
- Vergleich der gesellschaftlichen Ansichten zum Thema Selbstmord in Vergangenheit und Gegenwart
- Förderung der Empathie und des sensiblen Umgangs mit dem Thema Selbstmord
- Verknüpfung von literarischer Analyse mit sozialer Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Analyse des Lehr- und Lernfeldes: Dieser Abschnitt beschreibt die Klassensituation (16 Schülerinnen, 8 Schüler), den Leistungsstand der Schüler*innen als mittelmäßig und heterogen, die positive Unterrichtsatmosphäre und die vorhandene technische Ausstattung (Overheadprojektor, Computer mit Beamer, Tafel). Er dient als Grundlage für die didaktische Planung.
Sachanalyse: Die Sachanalyse befasst sich mit Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Sie fasst die Handlung zusammen: Werthers Flucht aus der bürgerlichen Gesellschaft, seine unerfüllte Liebe zu Lotte, sein berufliches Scheitern und seine letztendlich suizidale Handlung. Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit der Ursachen für Werthers Selbstmord, die über die unerfüllte Liebe hinausgehen und seine Unfähigkeit zur Integration in die Gesellschaft und seine Unzufriedenheit im Berufsleben beinhalten. Die Analyse verweist auf relevante Textstellen und zitiert literaturwissenschaftliche Arbeiten, um die Interpretation zu stützen.
Didaktische Analyse: Dieser Teil der Planung rechtfertigt die Behandlung des Werther im Unterricht durch den Bezug auf den Lehrplan und den Deutschfachschaftsbeschluss. Er beschreibt die Positionierung der Stunde innerhalb der Unterrichtseinheit (achte von zehn Stunden), die Notwendigkeit von Vorarbeiten und den Bezug zu vorherigen Stunden (z.B. Vergleich der Charaktere Werther und Albert). Die didaktische Analyse betont die Sensibilität des Themas Selbstmord und die Notwendigkeit eines achtsamen Umgangs damit im Unterricht.
Ziele der Unterrichtsstunde: Die Ziele der Stunde konzentrieren sich auf die Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen. Die Schüler*innen sollen Suizidindikatoren erkennen und diese auf Werther übertragen, einen Brief aus der Perspektive Wilhelms verfassen und die Vielschichtigkeit von Werthers Selbstmordmotiven verstehen. Persönlichkeitsbildung durch Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit und das Kennenlernen von Verhaltensweisen werden ebenfalls als Ziele genannt.
Methodische Analyse: Die methodische Analyse beschreibt den geplanten Unterrichtsverlauf detailliert. Es werden verschiedene Methoden eingesetzt, wie z.B. die Punktemethode zum Einstieg, Einzel- und Partnerarbeit, Präsentationen und ein Tafelbild zur Systematisierung der Ergebnisse. Die Auswahl der Methoden zielt darauf ab, alle Schüler*innen zu aktivieren und ihre individuellen Lernbedürfnisse zu berücksichtigen. Die Verwendung eines Flyers der Initiative Tabu Suizid e.V. soll den Schüler*innen einen Zugang zu dem Thema ermöglichen.
Tabellarischer Unterrichtsverlauf: Dieser Abschnitt fasst den geplanten Stundenverlauf in einer übersichtlichen Tabelle zusammen, welche die einzelnen Phasen (Begrüßung/Einstieg, Erarbeitungsphasen 1 & 2, Ergebnissicherung 1 & 2, Transfer/Vertiefung und Hausaufgabe) mit entsprechenden Inhalten, Sozialformen und Materialien auflistet.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werther, Johann Wolfgang von Goethe, Selbstmord, Suizid, Sturm und Drang, Epoche, Interpretation, Textanalyse, Gesellschaft, Liebe, Selbstverwirklichung, Schüleraktivität, Didaktik, Methoden, Empathie, Sensibilität.
Häufig gestellte Fragen zu: Unterrichtsplanung "Die Leiden des jungen Werther"
Was ist der Gegenstand dieser Unterrichtsplanung?
Diese Unterrichtsplanung beschreibt eine Unterrichtsstunde zum Thema Selbstmord im Kontext von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" für die Klasse 10c. Sie beinhaltet eine detaillierte Analyse des Lehr- und Lernfeldes, eine Sachanalyse des Werks, die didaktische Konzeption, die Lernziele, die methodische Umsetzung und einen tabellarischen Stundenverlauf.
Welche Ziele werden mit dieser Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Stunde zielt auf die Entwicklung der Lesekompetenz, Textinterpretationsfähigkeit und Schreibkompetenz der Schüler*innen ab. Sie sollen Suizidindikatoren erkennen, die Motive von Werthers Selbstmord verstehen, einen Brief aus der Perspektive einer Figur verfassen und ihren Umgang mit dem sensiblen Thema Selbstmord reflektieren. Die Förderung von Empathie und sozialer Kompetenz sind ebenfalls zentrale Ziele.
Welche Methoden werden in der Unterrichtsstunde eingesetzt?
Die Planung sieht verschiedene Methoden vor, darunter die Punktemethode zum Einstieg, Einzel- und Partnerarbeit, Präsentationen und die Nutzung eines Tafelbildes zur Systematisierung. Ein Flyer der Initiative Tabu Suizid e.V. soll den Schüler*innen einen Zugang zum Thema ermöglichen. Die Methodenwahl zielt auf die Aktivierung aller Schüler*innen und die Berücksichtigung individueller Lernbedürfnisse.
Wie ist der Stundenverlauf strukturiert?
Der tabellarische Stundenverlauf gliedert die Stunde in Phasen: Begrüßung/Einstieg, Erarbeitungsphasen 1 & 2, Ergebnissicherung 1 & 2, Transfer/Vertiefung und Hausaufgabe. Jede Phase beinhaltet Angaben zu Inhalten, Sozialformen und Materialien.
Welche Aspekte von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" werden behandelt?
Die Sachanalyse konzentriert sich auf Werthers Flucht aus der bürgerlichen Gesellschaft, seine unerfüllte Liebe zu Lotte, sein berufliches Scheitern und seinen Suizid. Die Analyse untersucht die vielschichtigen Ursachen des Selbstmords, die über die unerfüllte Liebe hinausgehen und seine Unfähigkeit zur Integration in die Gesellschaft sowie seine berufliche Unzufriedenheit beinhalten.
Wie wird das sensible Thema Selbstmord im Unterricht behandelt?
Die Planung betont die Sensibilität des Themas und den notwendigen achtsamen Umgang damit. Der Einsatz des Flyers von Tabu Suizid e.V. und die Fokussierung auf Empathie und Reflexion sollen den Schüler*innen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema ermöglichen.
Welche Vorarbeiten sind für die Stunde notwendig?
Die didaktische Analyse verweist auf die Notwendigkeit von Vorarbeiten und den Bezug zu vorherigen Stunden, zum Beispiel den Vergleich der Charaktere Werther und Albert. Konkrete Vorarbeiten werden in der Planung jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Unterrichtsplanung?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Die Leiden des jungen Werther, Johann Wolfgang von Goethe, Selbstmord, Suizid, Sturm und Drang, Epoche, Interpretation, Textanalyse, Gesellschaft, Liebe, Selbstverwirklichung, Schüleraktivität, Didaktik, Methoden, Empathie, Sensibilität.
Für welche Schülergruppe ist diese Unterrichtsplanung konzipiert?
Die Unterrichtsplanung ist für die Klasse 10c konzipiert, die aus 16 Schülerinnen und 8 Schülern mit einem mittelmäßigen und heterogenen Leistungsstand besteht. Die Unterrichtsatmosphäre wird als positiv beschrieben.
Wo findet man weitere Informationen zu diesem Thema?
Weitere Informationen könnten in der zitierten Literatur (die in der vollständigen Planung aufgeführt ist, aber hier nicht im Detail angegeben wird) und bei der Initiative Tabu Suizid e.V. gefunden werden.
- Quote paper
- Anna Bregs (Author), 2014, Die Leiden des jungen Werther: Werthers Selbstmord als Flucht oder Lösung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280957