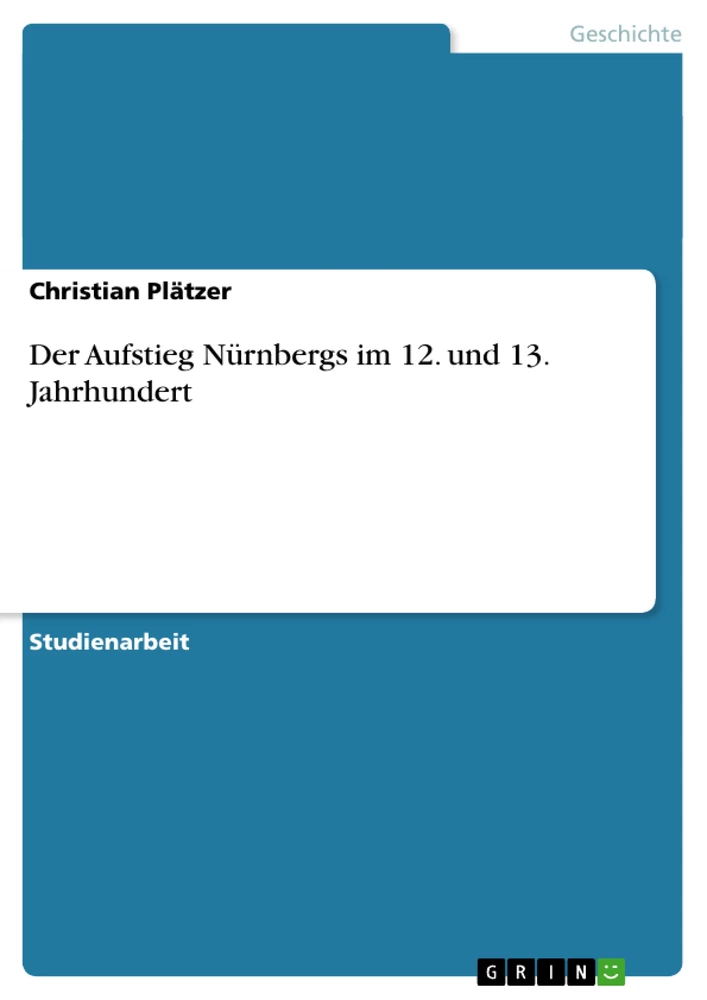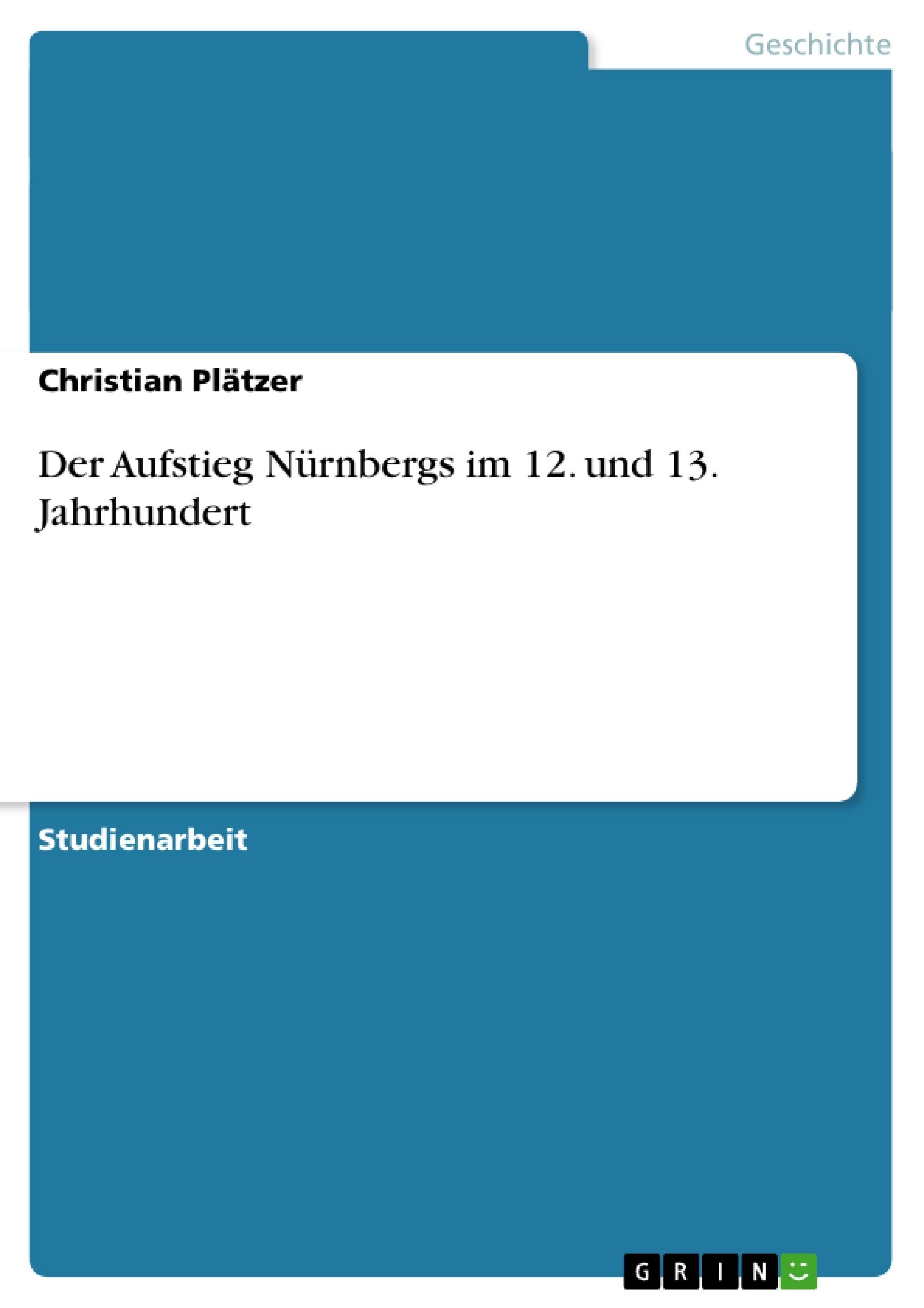Nürnberg ist eine typische Gründungsstadt aus "wilder Wurzel". Anders als etwa Regensburg, Augsburg, Köln oder Mainz kann die Stadt nicht auf ein reiches römisches Erbe zurückblicken, das über einen frühen Bischofssitz Kontinuität bis ins Mittelalter fand. Für die Anlage der Burg und der ersten Siedlung wählte Heinrich III. einen Ort in karger Umgebung, ohne alten kirchlichen Mittelpunkt und fernab von großen Flüssen, die doch die wichtigsten Verkehrswege der damaligen Zeit darstellten. Begünstigt wurde die Siedlung nur durch ihre Lage im Schnittpunkt wichtiger Landstraßen, die von den alten rheinischen Kulturräumen nach Osten und von Norden kommend weiter nach Italien führten. Der schon fast sagenhaft anmutende Aufstieg der Stadt innerhalb weniger Jahrhunderte zu einer der wichtigsten Metropolen des Reiches ist damit freilich noch nicht zu erklären. Vom Zeitpunkt seiner Gründung an war die Entwicklung Nürnbergs eng mit den politischen Ereignissen des Reiches verbunden. Hierin liegt wohl die eigentliche Bedeutung der frühen Nürnberger Stadtgeschichte. Durch kluges Taktieren ihrer Bürger konnte sich die Stadt von ihrer anfänglichen Rolle als Spielball konkurrierender Mächte zur freien Reichsstadt emanzipieren. Diese Arbeit stellt den Versuch dar, die wichtigen Ereignisse des 12. und 13. Jahrhunderts zusammenzufassen, welche die Basis für diesen Prozeß bildeten. Das regionale Geschehen in Nürnberg und seinem Umland soll in den größeren Zusammenhang der Reichsgeschichte gestellt werden, deren politische Vorgänge den Aufstieg der Stadt maßgeblich gefördert haben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1. Einleitung
- 2. Nürnberg als Element staufischer Territorialstaatspolitik
- Die geostrategische Lage in Ostfranken
- Die Verkehrslage
- Die Verwaltung des Reichslandes
- 3. Die Entwicklung der Stadt bis 1240
- Nürnberg als Residenz- und Pfalzort
- Nürnberg als Handelsplatz
- Der Erhalt der Immunität
- Der Freiheitsbrief von 1219
- 4. Erste Schritte zur städtischen Autonomie
- Der Streit zwischen Kaiser und Papst
- Nürnberg unter dem Interdikt
- Die neue Städtepolitik der Staufer
- Die Gefährdung der Freiheit durch den Wegfall der Zentralgewalt
- 5. Rückschläge während des Interregnums...
- 6. Die Konsolidierung des Reichsgutes durch Rudolf von Habsburg.
- Die Wahlverhandlungen von 1273
- Das Auscheiden des Butiglers aus der Verfassungsstruktur
- Die Anlage des ersten Amtsbuches
- 7. Schlußbemerkung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert und untersucht die politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die zu seiner Entwicklung zur Reichsstadt führten.
- Die Rolle Nürnbergs in der staufischen Territorialstaatspolitik
- Die Entwicklung Nürnbergs zum Handelsplatz und Residenzort
- Die ersten Schritte zur städtischen Autonomie
- Die Auswirkungen des Interregnums auf Nürnberg
- Die Konsolidierung des Reichsgutes durch Rudolf von Habsburg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkung beleuchtet die einzigartige Entstehungsgeschichte Nürnbergs und setzt die Entwicklung der Stadt in den Kontext der Reichsgeschichte.
Das erste Kapitel behandelt die Gründung Nürnbergs durch Kaiser Heinrich III. im 11. Jahrhundert und stellt sie in den Zusammenhang der Reichskirchenpolitik dieser Zeit.
Das zweite Kapitel analysiert die Rolle Nürnbergs als Element staufischer Territorialstaatspolitik. Es beschreibt die geostrategische Lage der Stadt in Ostfranken, die Verkehrslage und die Verwaltung des Reichslandes.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung Nürnbergs zur Stadt bis 1240. Es behandelt Nürnbergs Rolle als Residenz- und Pfalzort, als Handelsplatz und beleuchtet die Erlangung der Immunität sowie den Freiheitsbrief von 1219.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den ersten Schritten Nürnbergs zur städtischen Autonomie. Es untersucht den Streit zwischen Kaiser und Papst, die Auswirkungen des Interdikts auf die Stadt sowie die neue Städtepolitik der Staufer.
Das fünfte Kapitel behandelt die Rückschläge während des Interregnums und die Bündnispolitik Nürnbergs.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Konsolidierung des Reichsgutes durch Rudolf von Habsburg. Es analysiert die Wahlverhandlungen von 1273, das Auscheiden des Butiglers aus der Verfassungsstruktur und die Anlage des ersten Amtsbuches.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert wichtige Aspekte der Nürnberger Stadtgeschichte im 12. und 13. Jahrhundert, darunter die staufische Territorialstaatspolitik, die Entwicklung Nürnbergs zum Handelsplatz und Residenzort, die ersten Schritte zur städtischen Autonomie, das Interregnum und die Konsolidierung des Reichsgutes durch Rudolf von Habsburg.
- Quote paper
- Christian Plätzer (Author), 1995, Der Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28083