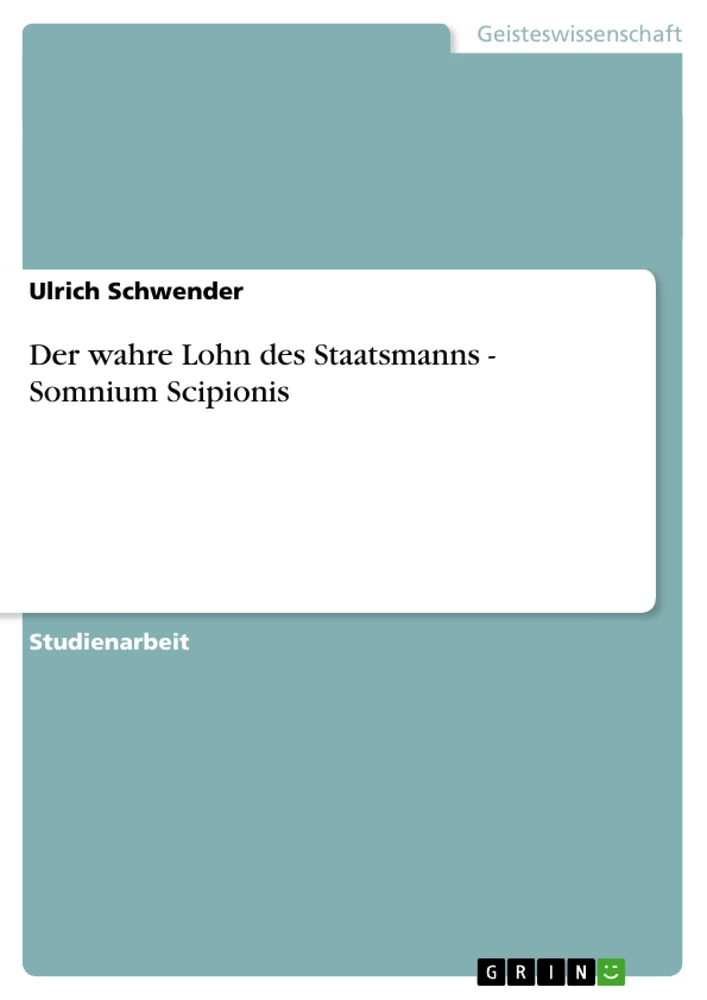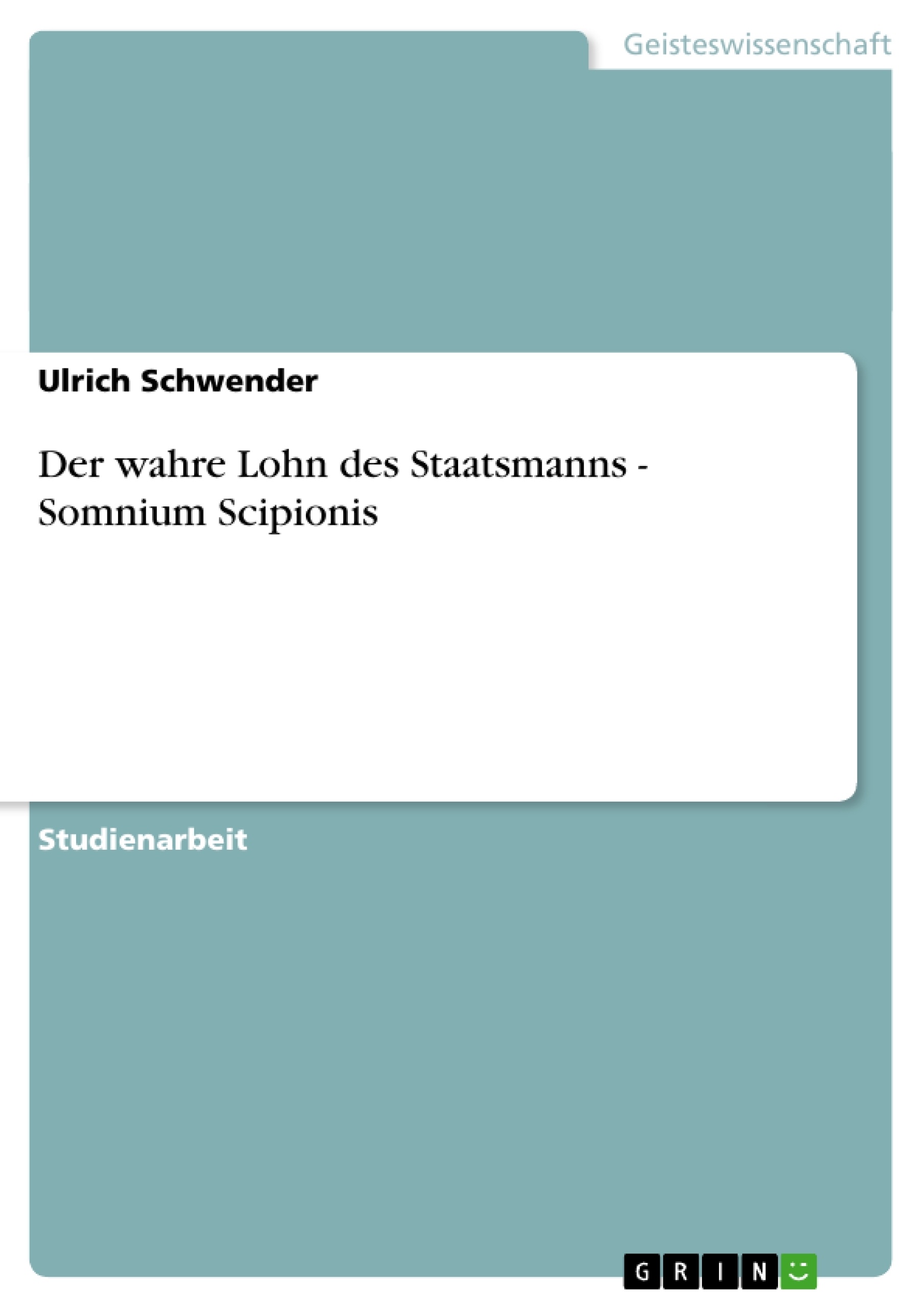Einleitung
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Somnium Scipionis in Buch VI, 9-29 von Ciceros Werk de re publica. Der Traum ist jedoch nicht im Palimpsest des Werkes, sondern in einem Kommentar des Macrobius erhalten1 und wird von Büchner als „Krönung des Werkes“ bezeichnet.
Scipio erzählt seinen Gesprächsteilnehmern im Jahre 129 v. Chr. einen Traum, den er 20 Jahre zuvor erlebt hat. Laelius, ein Freund des Scipio, hat ihm dazu die Gelegenheit gegeben, indem er darüber geklagt hat, dass dem Scipio Nasica keine Statuen zum Lohn für die Beseitigung des Tyrannen errichtet worden sind. Scipio antwortet in VI, 8, dass auf der Erde solchen Staatsmännern die conscientia ipsa factorum egregiorum genug sei. Irdische Belohnungen seien in Größe und Qualität beschränkt, im Gegensatz zu denjenigen, die es bonis reum publicarum [...] rectoribus im Himmel gebe. Über jenseitige Belohnungen war schon von Platon berichtet worden. Aber sein ER- Mythos war ab indoctis3 verlacht worden, worauf Cicero auf die Frage des Laelius nach diesen Belohnungen sich für die Form des Traumes entscheidet, damit nicht die Argumente dieser Leute, nämlich dass der Philosoph „seine Gedanken nicht mit Fiktionen mischen“ dürfe, auch dagegen verwendet würden. Das Ziel der Arbeit besteht in der Analyse des Traumes im Kontext des Werkes; in einem zweiten Teil soll der Vergleich mit Platons ER- Mythos stehen und zum Abschluss die Frage untersucht werden, warum Cicero die Form des Traumes als Schluss des Werkes de re publica verwendet hat. Nicht das Ziel der Arbeit ist es hingegen, Ciceros (politisches) Leben mit dem Somnium zu verknüpfen, wie es beispielsweise Fuhrmann tut. Ebenso wenig soll Cicero als bloßer Imitator von Quellen dargestellt werden6, sondern als aktiv handelnder, eigenständiger Autor, der aber natürlich Kenner der hellenistischen Philosophie ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Einleitung
- 2) Analyse des Traumes
- 2.1) Situation des Traumes
- 2.2) Scipios Erscheinung, Prophezeiung und Verheißung
- 2.3) Die Unterhaltung mit dem Vater Paulus
- 2.4) Kosmosschau
- 2.5) Relativierung des irdischen Ruhmes
- 2.6) Corollarium: Der Mensch ist Gott
- 3) Platons ER- Mythos in der Politeia im Vergleich mit dem Somnium
- 4) Die Form des Somnium als Finale des Werkes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Ciceros Somnium Scipionis, insbesondere im Kontext des Werkes de re publica. Die Zielsetzung umfasst die Analyse des Traumes, einen Vergleich mit Platons ER-Mythos und die Untersuchung der Funktion des Traumes als Schluss des Werkes. Die Arbeit vermeidet eine rein biografische Interpretation von Ciceros Leben und konzentriert sich auf Cicero als eigenständigen Autor, der sich mit hellenistischer Philosophie auseinandersetzt.
- Analyse des Somnium Scipionis als literarisches und philosophisches Werk
- Vergleich des Somnium Scipionis mit Platons ER-Mythos
- Die Bedeutung des Traumes als literarische Form und Schlusspunkt von Ciceros de re publica
- Die Rolle des Ruhmes und der jenseitigen Belohnung für Staatsmänner
- Ciceros Auseinandersetzung mit hellenistischer Philosophie im Kontext des Somnium Scipionis
Zusammenfassung der Kapitel
1) Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse des Somnium Scipionis im Kontext von Ciceros de re publica, den Vergleich mit Platons ER-Mythos und die Untersuchung der Form des Traumes als Schluss des Werkes. Sie betont die Absicht, Cicero nicht als bloßen Imitator darzustellen, sondern als eigenständigen Autor, der die hellenistische Philosophie in sein Werk integriert. Das Ziel ist die Analyse des Traumes und seiner Bedeutung innerhalb des Gesamtwerks, nicht die biografische Verknüpfung mit Ciceros Leben.
2) Analyse des Traumes: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des Traumes von Scipio, der im Jahre 149 v. Chr. in Afrika stattfindet. Der Traum wird schrittweise entfaltet, beginnend mit der Situation und dem Treffen mit Masinissa, über die Erscheinung des Africanus, dessen Prophezeiungen und Verheißungen bis hin zur Kosmosschau und der Relativierung des irdischen Ruhmes. Das Kapitel untersucht die Bedeutung der einzelnen Elemente des Traumes, wie die Sonne, die Milchstraße und die Zahlenmystik, und stellt Verbindungen zu anderen philosophischen und literarischen Werken her. Das Kapitel gipfelt in der Erkenntnis, dass der wahre Lohn des Staatsmannes nicht irdischer Natur ist, sondern in einem jenseitigen Glück liegt, das im Einklang mit dem göttlichen Willen steht.
3) Platons ER- Mythos in der Politeia im Vergleich mit dem Somnium: Dieses Kapitel stellt einen Vergleich zwischen dem Somnium Scipionis und Platons ER-Mythos aus der Politeia her. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Mythen werden analysiert, wobei die unterschiedliche Wirkungsabsicht und der Kontext der jeweiligen philosophischen Systeme berücksichtigt werden. Der Vergleich beleuchtet Ciceros kritische Auseinandersetzung mit Platon und die Eigenständigkeit seines philosophischen Ansatzes im Somnium. Es wird untersucht, wie Cicero den platonischen Mythos in seinem eigenen Kontext neu interpretiert und an seine politischen und philosophischen Ziele anpasst.
4) Die Form des Somnium als Finale des Werkes: Dieses Kapitel untersucht die narrative und rhetorische Funktion des Somnium Scipionis als Schluss von Ciceros de re publica. Es analysiert die Wahl der Traumform und erörtert, warum Cicero sich für diesen Schluss entschieden hat. Die Diskussion umfasst die ästhetische Wirkung des Traumes, seine Wirkung auf die Leser und seine Rolle im Gesamtkonzept des Werkes. Die Analyse untersucht, wie der Traum die zuvor behandelten politischen und philosophischen Themen zusammenfasst und ein befriedigendes Ende bietet, ohne die offenen Fragen des Werkes völlig zu lösen.
Schlüsselwörter
Somnium Scipionis, Cicero, de re publica, Platon, ER-Mythos, irdischer Ruhm, jenseitige Belohnung, Staatsmann, Kosmosschau, hellenistische Philosophie, politische Philosophie, Traumdeutung, Römische Republik.
Häufig gestellte Fragen zum Somnium Scipionis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Ciceros Somnium Scipionis (Scipios Traum) eingehend, insbesondere im Kontext seines Werkes de re publica. Der Fokus liegt auf der Analyse des Traumes selbst, einem Vergleich mit Platons ER-Mythos und der Untersuchung der Funktion des Traumes als Schluss des Werkes. Die Interpretation vermeidet eine rein biografische Sichtweise und konzentriert sich auf Cicero als eigenständigen Autor, der sich mit hellenistischer Philosophie auseinandersetzt.
Welche Themen werden im Somnium Scipionis behandelt?
Der Traum behandelt zentrale Themen wie die Relativierung des irdischen Ruhmes, die Bedeutung jenseitigen Glücks und die Rolle des Staatsmannes. Es werden philosophische Konzepte wie die Kosmosschau und die Auseinandersetzung mit dem göttlichen Willen erörtert. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der einzelnen Elemente des Traumes (Sonne, Milchstraße, Zahlenmystik) und deren Verbindungen zu anderen philosophischen und literarischen Werken.
Wie wird der Somnium Scipionis mit Platons ER-Mythos verglichen?
Die Arbeit vergleicht detailliert den Somnium Scipionis mit Platons ER-Mythos aus der Politeia. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden analysiert, wobei die unterschiedliche Wirkungsabsicht und der Kontext der jeweiligen philosophischen Systeme berücksichtigt werden. Der Vergleich beleuchtet Ciceros kritische Auseinandersetzung mit Platon und die Eigenständigkeit seines philosophischen Ansatzes im Somnium. Es wird untersucht, wie Cicero den platonischen Mythos in seinem eigenen Kontext neu interpretiert und an seine politischen und philosophischen Ziele anpasst.
Welche Rolle spielt der Traum als Schluss von Ciceros de re publica?
Die Arbeit untersucht die narrative und rhetorische Funktion des Somnium Scipionis als Schlussteil von Ciceros de re publica. Analysiert wird die Wahl der Traumform und die Gründe für Ciceros Entscheidung. Die ästhetische Wirkung des Traumes, seine Wirkung auf die Leser und seine Rolle im Gesamtkonzept des Werkes werden erörtert. Die Analyse zeigt, wie der Traum die zuvor behandelten politischen und philosophischen Themen zusammenfasst und ein befriedigendes Ende bietet, ohne alle offenen Fragen des Werkes vollständig zu beantworten.
Welche Kapitel umfasst die Analyse des Somnium Scipionis?
Die Analyse gliedert sich in vier Kapitel: 1) Einleitung, 2) Analyse des Traumes (inkl. Situation, Scipios Erscheinung, Unterhaltung mit Paulus, Kosmosschau, Relativierung des irdischen Ruhmes und Corollarium: Der Mensch ist Gott), 3) Vergleich mit Platons ER-Mythos und 4) Die Form des Somnium als Finale des Werkes. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Untersuchung der jeweiligen Aspekte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Somnium Scipionis, Cicero, de re publica, Platon, ER-Mythos, irdischer Ruhm, jenseitige Belohnung, Staatsmann, Kosmosschau, hellenistische Philosophie, politische Philosophie, Traumdeutung, Römische Republik.
- Quote paper
- Ulrich Schwender (Author), 2004, Der wahre Lohn des Staatsmanns - Somnium Scipionis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28076