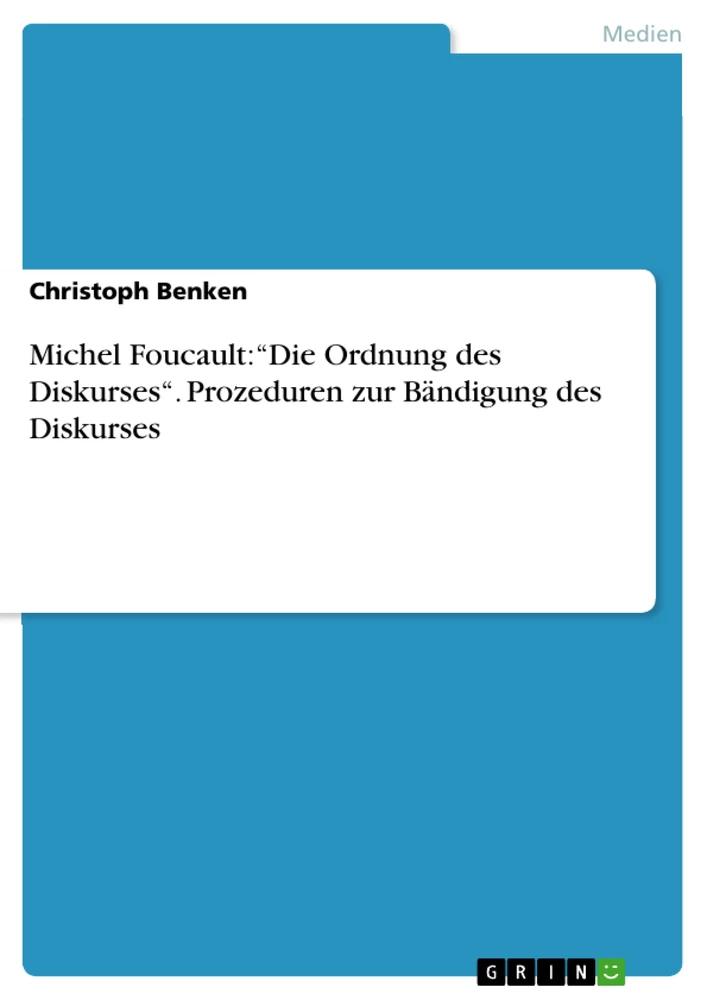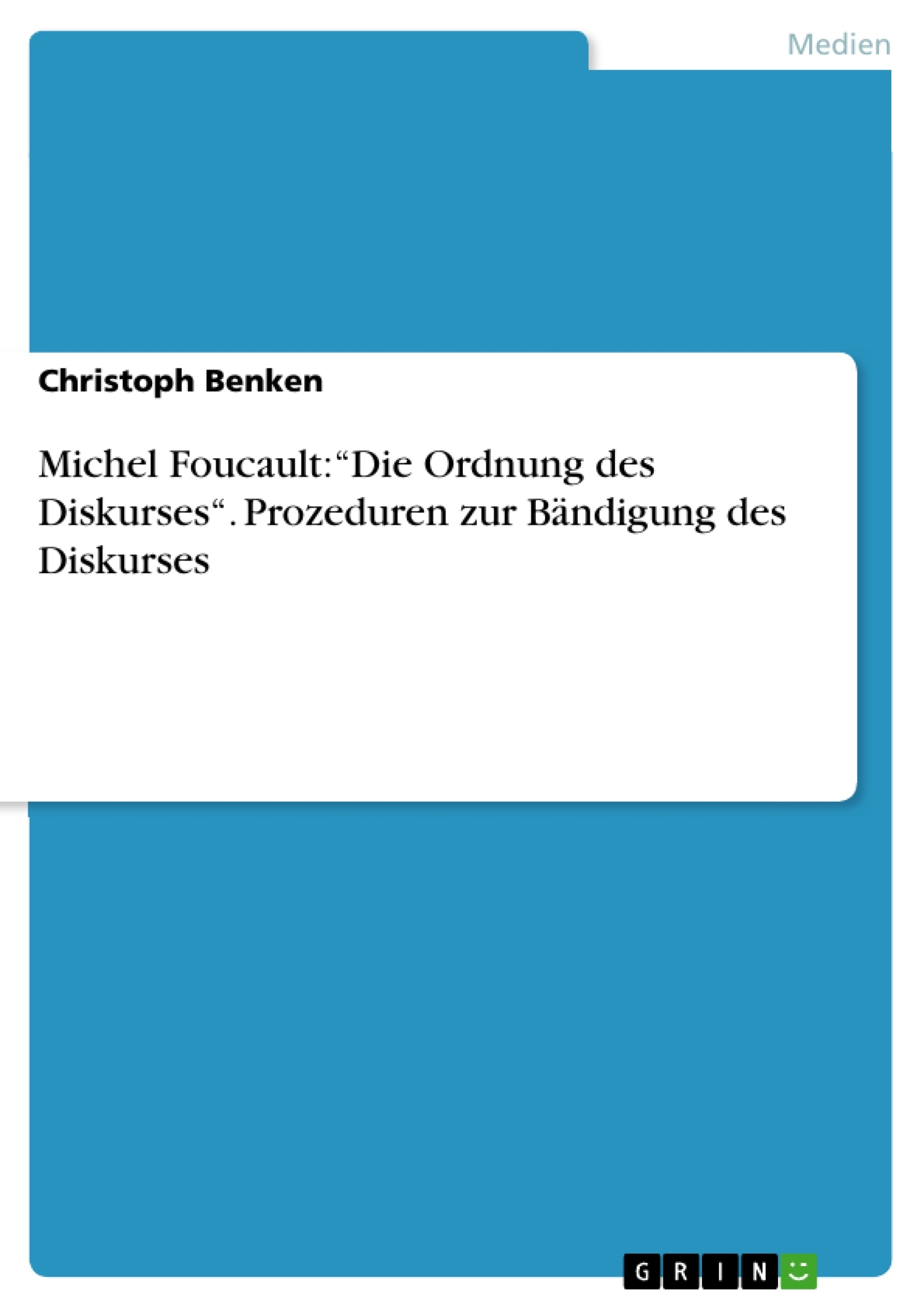Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Text “Die Ordnung des Diskurses“, welchen der französische Philosoph Michel Foucault bei seinem Amtsantritt am Collège de France im Jahr 1970 in Paris verlas. Auf der Grundlage eines Vortrags, den ich in Zusammenarbeit mit Thea Buchholz und Constantin Vorholt im Rahmen des Seminars “Praktiken, Repräsentationen, Performativität: Werkzeuge der Kulturanalyse“ erarbeitet und gehalten habe, möchte ich die wichtigsten Aspekte meines Teils des Textes darstellen. Der Gesamtzusammenhang des Referats soll dabei jedoch nicht außer Acht gelassen werden.
Foucault wendet sich in seinem Text gegen die Reduktion des Diskurses auf ein verbalisiertes Denken und betont dessen Wirken als Machtinstrument. Er vermeidet es, den Diskurs zu definieren. Stattdessen nähert er sich ihm an, ohne die Gültigkeit seines Diskursbegriffs als ahistorische Wahrheit zu behaupten. Foucault entwickelt in seinen Ausführungen Instrumente der Analyse von Diskursen und zeigt die Machtstrukturen auf, denen sie unterworfen sind. Die Arbeit soll herausstellen, dass hierin der große methodische Nutzen seiner Erkenntnisse besteht.
Foucault gliederte seine Diskursanalyse in zwei Bereiche, die er “Kritik“ und “Genealogie“ nennt. Diese Begriffe ersetzen den zuvor verwendeten Begriff “Archäologie“. Wieso unterteilt Foucault sein zukünftiges diskursanalytisches Vorgehen in diese Bereiche? Diese Frage war ein weiterer Aspekt meines Teils des Referats und soll zuletzt ausgeführt werden.
Die Ausarbeitung soll in erster Linie vom vorliegenden Text ausgehen. Auf Sekundärliteratur möchte ich weitestgehend verzichten. Angedacht ist ein Kommentar im Sinne von Foucault, der den Sinn des Primärtextes wiedergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prozeduren zur Bändigung der Kräfte des Diskurses
- Äußere Prozeduren
- Verbot
- Entgegensetzung von Vernunft und Wahnsinn
- Der Gegensatz zwischen dem Wahren und dem Falschen
- Innere Prozeduren
- Der Kommentar
- Der Autor
- Die Disziplin
- Verknappung der sprechenden Subjekte
- Rituale
- Diskursgesellschaften
- Doktrinen
- Gesellschaftliche Aneignung des Wissens
- Äußere Prozeduren
- Die Befreiung des Diskurses von den Einschränkungen der Autorenschaft
- Kritik und Genealogie
- Beidseitige Bemächtigung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Michel Foucaults Text "Die Ordnung des Diskurses", der sich mit der Kontrolle und Bändigung von Diskursen in Gesellschaften beschäftigt. Foucault untersucht die Mechanismen, die die Produktion und Verbreitung von Wissen und Sprache regulieren, und zeigt die Machtstrukturen auf, die diesen Prozessen zugrunde liegen.
- Die Bändigung der Kräfte des Diskurses durch äußere und innere Prozeduren
- Die Verknappung der sprechenden Subjekte durch Rituale, Diskursgesellschaften, Doktrinen und gesellschaftliche Aneignung des Wissens
- Die Kritik an der Reduktion des Diskurses auf ein verbalisiertes Denken und die Betonung seiner Wirksamkeit als Machtinstrument
- Die Bedeutung der Genealogie und Kritik für die Analyse von Diskursen
- Die beidseitige Bemächtigung von Diskursen und Machtstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Textes "Die Ordnung des Diskurses" dar und erläutert Foucaults These, dass Diskurse nicht nur als Ausdruck von Gedanken, sondern auch als Machtinstrumente betrachtet werden müssen. Foucault vermeidet eine Definition des Diskurses und nähert sich ihm stattdessen durch die Analyse seiner Machtstrukturen.
Im zweiten Kapitel werden die Prozeduren zur Bändigung der Kräfte des Diskurses vorgestellt. Foucault unterscheidet zwischen äußeren Prozeduren, die den Diskurs von außen einschränken, und inneren Prozeduren, die den Diskurs von innen heraus regulieren. Zu den äußeren Prozeduren gehören das Verbot, die Entgegensetzung von Vernunft und Wahnsinn sowie der Gegensatz zwischen dem Wahren und dem Falschen. Die inneren Prozeduren umfassen den Kommentar, den Autor und die Disziplin.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Verknappung der sprechenden Subjekte. Foucault argumentiert, dass die Produktion von Diskursen nicht nur durch äußere und innere Prozeduren, sondern auch durch die Einschränkung der sprechenden Subjekte kontrolliert wird. Er beschreibt verschiedene Mechanismen, die diese Verknappung bewirken, wie Rituale, Diskursgesellschaften, Doktrinen und die gesellschaftliche Aneignung des Wissens.
Das vierte Kapitel behandelt die Befreiung des Diskurses von den Einschränkungen der Autorenschaft. Foucault kritisiert die Reduktion des Diskurses auf die Intentionen des Autors und plädiert für eine Analyse, die die Machtstrukturen und historischen Bedingungen des Diskurses berücksichtigt.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Begriffen "Kritik" und "Genealogie" als Werkzeuge der Diskursanalyse. Foucault argumentiert, dass die Analyse von Diskursen nicht nur die Machtstrukturen, sondern auch die historischen Bedingungen und die Entstehung von Wissen berücksichtigen muss.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ordnung des Diskurses, die Bändigung der Kräfte des Diskurses, die Prozeduren der Ausschließung, die inneren Prozeduren, die Verknappung der sprechenden Subjekte, die Kritik, die Genealogie, die Machtstrukturen, die historischen Bedingungen und die Entstehung von Wissen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Foucaults „Ordnung des Diskurses“?
Foucault untersucht die Mechanismen, mit denen Gesellschaften Diskurse kontrollieren, selektieren und bändigen, um Machtstrukturen aufrechtzuerhalten.
Was sind „äußere Prozeduren“ der Diskursbändigung?
Dazu gehören das Verbot (was nicht gesagt werden darf), die Ausgrenzung (Wahnsinn vs. Vernunft) und der Wille zur Wahrheit (Wahr vs. Falsch).
Welche Rolle spielt der „Autor“ laut Foucault?
Der Autor fungiert als ein Prinzip der Einordnung und Begrenzung des Diskurses, indem er die Vielfalt der Bedeutungen auf eine Person und deren Intention reduziert.
Was versteht Foucault unter „Genealogie“?
Die Genealogie untersucht die tatsächliche Entstehung von Diskursen und Wissen unter Berücksichtigung von Machtverhältnissen und Zufällen statt einer linearen Fortschrittsgeschichte.
Was sind Diskursgesellschaften?
Das sind geschlossene Gruppen, die den Zugang zu bestimmten Diskursen kontrollieren und sicherstellen, dass nur Eingeweihte über bestimmtes Wissen verfügen.
- Arbeit zitieren
- Christoph Benken (Autor:in), 2013, Michel Foucault: “Die Ordnung des Diskurses“. Prozeduren zur Bändigung des Diskurses, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280700