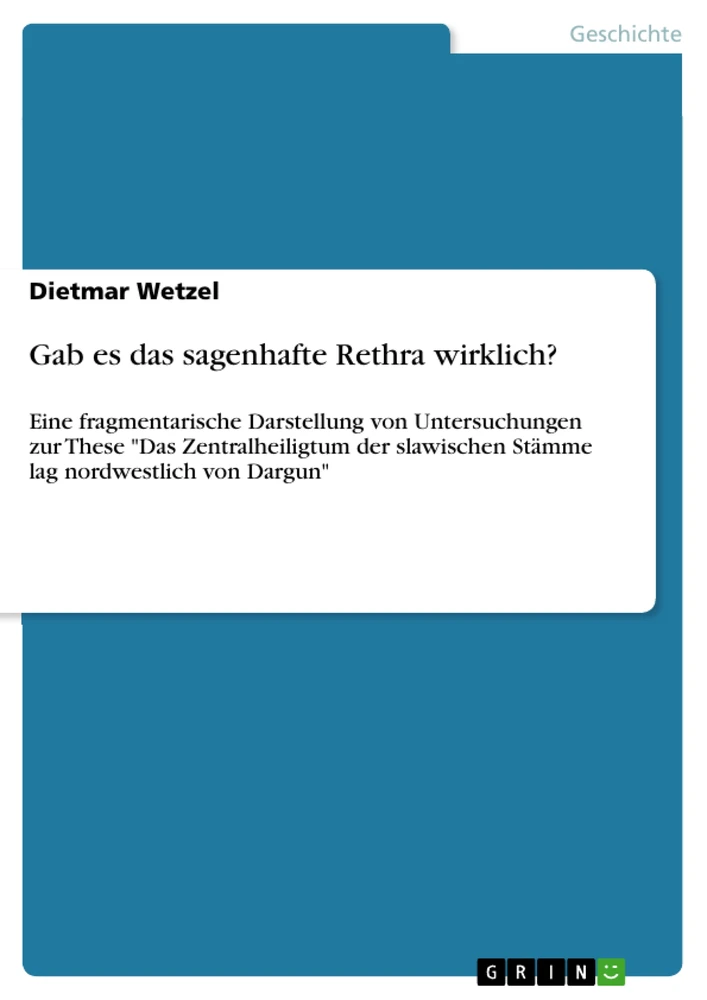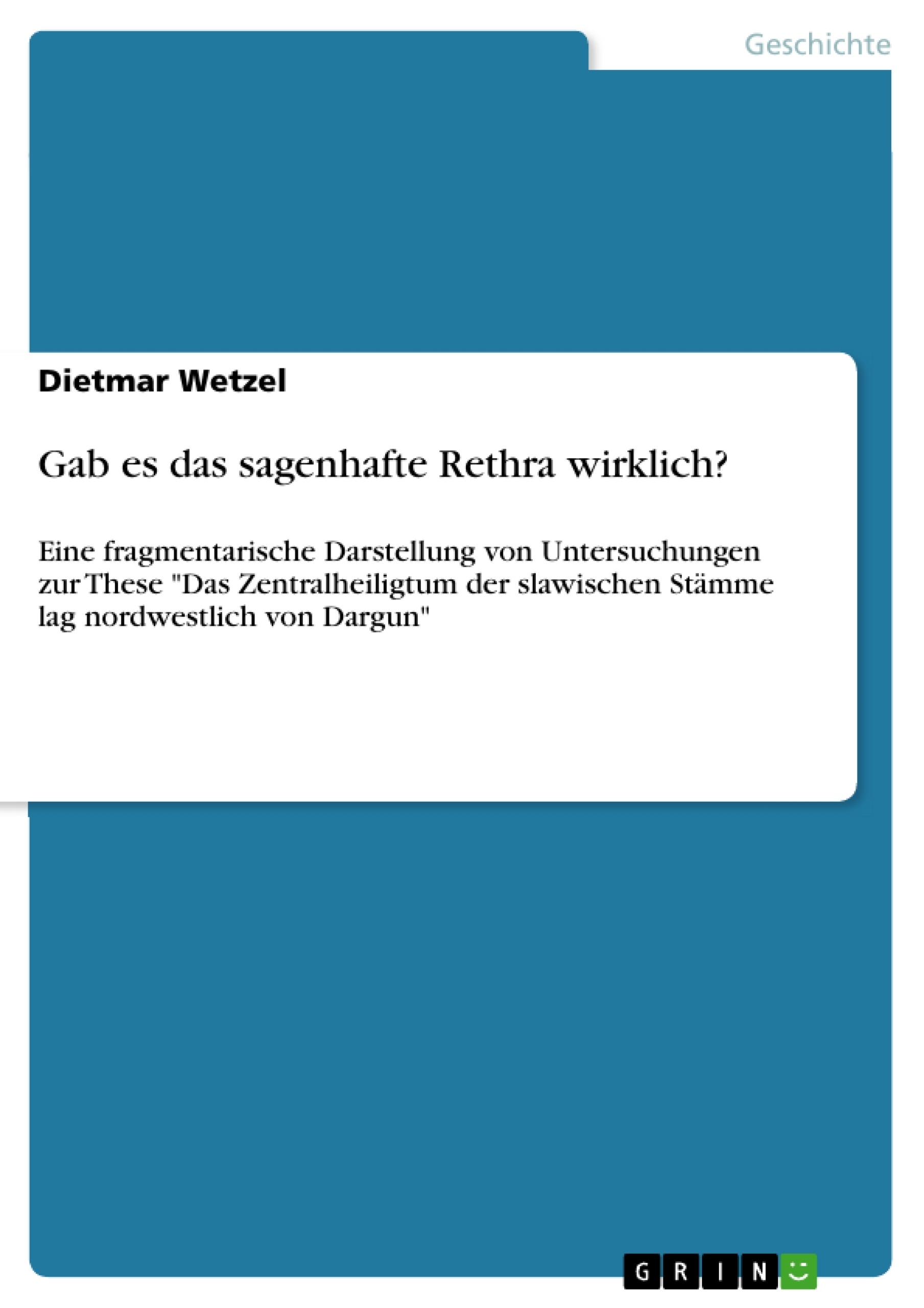Rethra steht bei Chronisten, Historikern und diesbezüglichen Wissenschaftlern für das zentrale Heiligtum des Liutizenbundes, also der im Bund vereinigten slawischen Stämme. Dort soll im Jahr 983 der große Slawenaufstand beschlossen worden sein und regelmäßig Volksversammlungen stattgefunden haben, bei denen der slawische „Hauptgott“ Svarožic angerufen und dessen Orakel abgeholt wurde.
Historiker nennen Rethra deswegen auch oft das „Delphi Mecklenburgs“. Es ist also ein bedeutsamer Mythos der slawischen Frühgeschichte Mecklenburgs, wenn nicht gar der Gewichtigste. Seit 1379 gibt es nicht weniger als 31 Regionen und Plätze, in denen Rethra verortet wird.
Hier soll nun anhand der Beantwortung einiger Fragen auf Tatsachen hingewiesen werden, die beim empirischen Studium der historischen Überlieferungen aufgefallen sind, bisher aber in der „Rethra-Forschung“ nicht oder kaum beachtet wurden, jedoch letztendlich eine neue Hypothese zur Lokalisierung tiefer begründen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- HAT ES RETHRA ÜBERHAUPT GEGEBEN?
- LAG RIEDEGOST ALIAS RETHRA IM „GAU DER REDARIER\"?
- Summa summarum:
- WAS SPRICHT FÜR DIE LAGE IN CIRCIPANIEN?
- Die Reimchronik
- Der Bruderkrieg um das Heiligtum
- Zweifelnde Historiker der Neuzeit
- Der Untergang
- WAS SPRICHT FÜR DARGUN?
- Die grundlegenden Merkmale nach Thietmars Beschreibung
- Thietmars Meer
- Die Entfernung von Hamburg
- Die Lage an der Via Regia des Nordens
- Die Gründung des Zisterzienser Klosters
- Die „Altenburg Dargan“
- Die Unterschätzung der bisherigen archäologischen Befunde
- SCHLUSSFOLGERUNG
- ANLAGEN:
- Anlage 1: Aktuelles - laut Artikel im Nordkurier
- Anlage 2:,,Riedegost\" in Karten
- Anlage 3:,,Riedirierun\"\n
- Literaturempfehlung
- Abkürzungen
- Abbildungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Schrift befasst sich mit der Lokalisierung des sagenhaften Rethra, dem zentralen Heiligtum des Liutizenbundes. Ziel ist es, anhand historischer Quellen und empirischer Untersuchungen eine neue Hypothese zur Lage des Tempels zu entwickeln. Der Autor argumentiert, dass Rethra sich „zweifelsfrei“ bei der Stadt Dargun befindet. Die Schrift beleuchtet historische Beweise, die bisher in der „Rethra-Forschung“ kaum Beachtung fanden.
- Die verschiedenen Hypothesen zur Lage von Rethra
- Die Analyse historischer Quellen und Überlieferungen
- Die Bewertung der verfügbaren archäologischen Befunde
- Die Entwicklung einer neuen Hypothese zur Lokalisierung von Rethra
- Die Kritik an bisherigen Forschungsergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Rethra-Mythos ein und erklärt die Bedeutung des Heiligtums für die slawische Frühgeschichte Mecklenburgs. Anschließend werden die wichtigsten Fragen und Ziele der Arbeit dargestellt. Das Kapitel "HAT ES RETHRA ÜBERHAUPT GEGEBEN?" beschäftigt sich mit der Frage nach der Existenz des Heiligtums und der verschiedenen Theorien dazu. Im Kapitel "LAG RIEDEGOST ALIAS RETHRA IM „GAU DER REDARIER\"?" werden Argumente für und gegen die Lage des Tempels in der Region Circipanien untersucht.
Der Abschnitt "WAS SPRICHT FÜR DIE LAGE IN CIRCIPANIEN?" präsentiert verschiedene historische Quellen und Beweise, die für die Lage von Rethra in Circipanien sprechen. Im Gegenzug werden im Abschnitt "WAS SPRICHT FÜR DARGUN?" Argumente für die Lokalisierung des Tempels bei Dargun beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rethra, Liutizenbund, Slawenaufstand, Svarožic, Delphi Mecklenburgs, historische Quellen, empirische Forschung, archäologische Befunde, Dargun, Circipanien, Thietmar von Merseburg, Reimchronik, Via Regia des Nordens, Zisterzienser Kloster.
- Quote paper
- Dietmar Wetzel (Author), 2014, Gab es das sagenhafte Rethra wirklich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280631