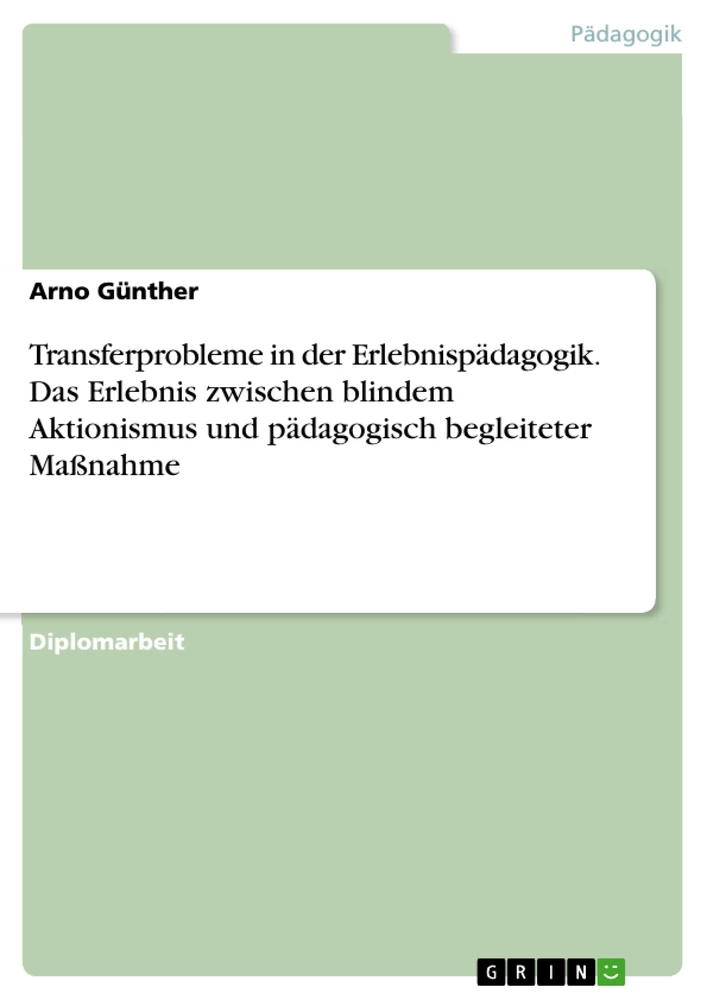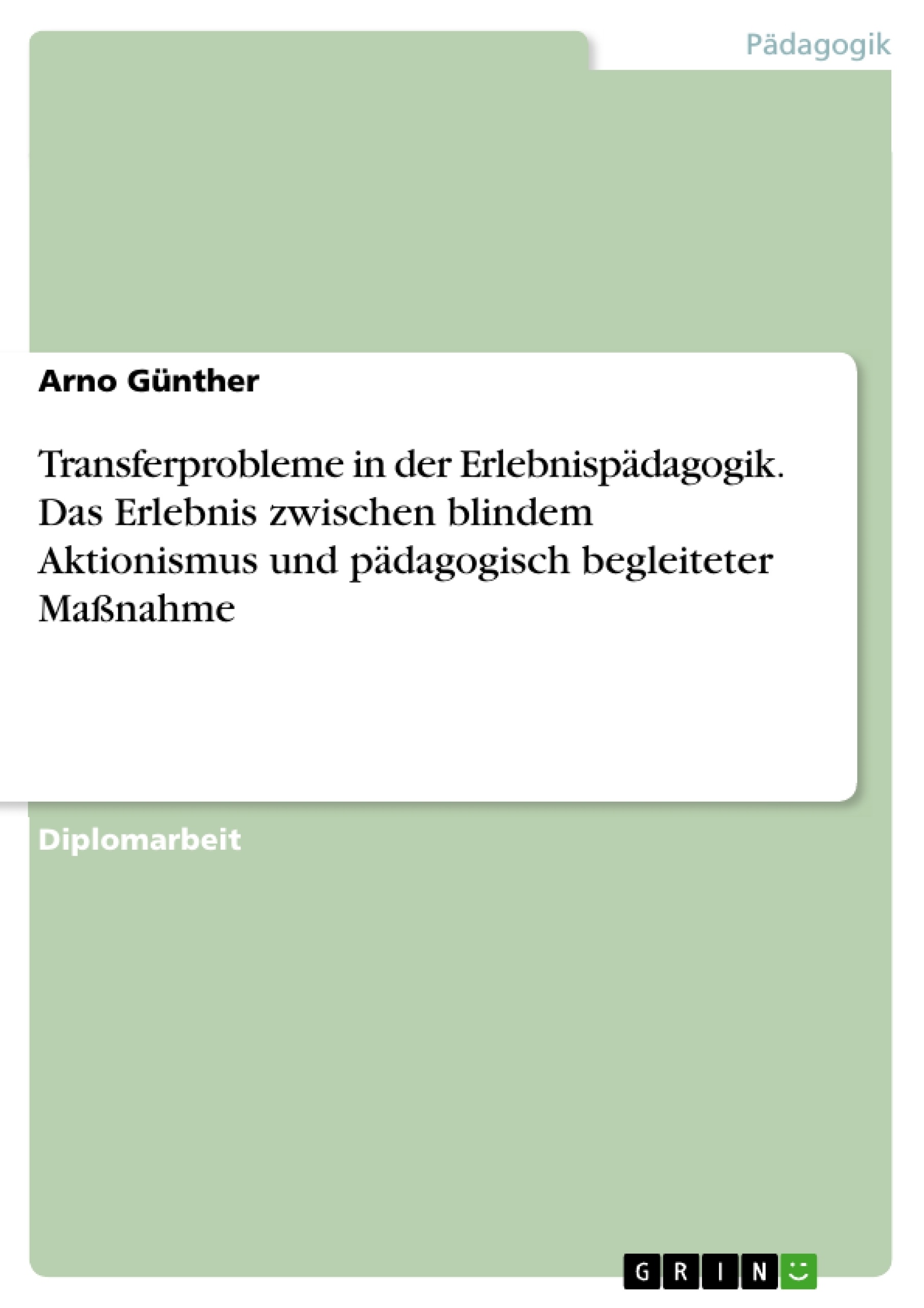Die Frage, worin sich ein Zeltlager während einer Ferienfreizeit von einem erlebnispädagogischen Kurs unterscheidet, scheint leicht zu beantworten zu sein. Ersteres will Kindern und Jugendlichen Spaß und Freizeitgestaltung bieten, während im Zweiten pädagogische Ziele im Vordergrund stehen. Eine einfache Antwort, die jedoch viele Fragen aufwirft: Worin bestehen die Ziele? Wie werden sie erreicht? Können diese Ziele nicht auch in einer spaßorientierten Freizeit erreicht werden? Was unterscheidet erlebnispädagogische Intention von einer zweckfreien Freizeit? Was ist überhaupt Erlebnis?
Um diese Fragen zu beantworten, wird in dieser Arbeit ein Bild der heutigen Erlebnispädagogik (EP) gezeigt, welches jedoch nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene in der Weiterbildung oder auch der Freizeitgestaltung miteinbezieht. Welchen Sinn haben Raftingtouren oder Bungee-Sprünge, die mit Risiko und Gefahr verbunden, immer neue Nervenkitzel hervorrufen? Diese zunächst sinnlos erscheinenden Aktionen werden mit Erlebnis und Lust am Leben beworben und stehen somit scheinbar in enger Verbindung zur Erlebnispädagogik. Wie kann sie sich allerdings von der reinen Lustbetonung absetzten, worin besteht das eigentliche pädagogische Moment?
Kapitel 1 widmet sich dem Begriff des Erlebnis aus verschiedenen Sichtweisen. Im Kapitel 2 wird sich der EP aus historische Sicht genähert, während im dritten Kapitel die moderne EP mit zentralen Bezugspunkten betrachtet wird. Hierzu wird der "Fluss Erlebnispädagogik" als eigenes Darstellungskonzept entworfen. Kapitel 4 und 5 beleuchten die pädagogisch bedeutsamen Phänomene der "Reflexion" und des "Transfer". Hierzu wurde eine (EMail-)Umfrage durchgeführt. Das abschließenden Kapitel 6 gibt eine Sichtweise auf die Zukunft der Erlebnispädagogik unter Einbeziehung einiger Positionen aus der Arbeit wieder. Im Anhang finden sich die Auswertung einer Befragung von 150 Organisationen aus dem Bereich der EP, einige exemplarische E-Mails und eine umfangreiche Literaturliste.
Zum Autor:
Nach mehrjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und der beruflichen Arbeit in der offenen Jugendpflege, widmet sich Arno Günther derzeit intensiv der Erlebnispädagogik als freier Mitarbeiter für verschiedene Institutionen. U. a. begleitet er erlebnispädagogische Projekte und Incentives wie Kistenklettern-Aktionen und Wildniscamps, die z. T. als Vater-Kind-Tour konzipiert sind.
Inhaltsverzeichnis
- Das Erlebnis
- Vom inflationären Gebrauch eines Wortes
- Eine Begriffsbestimmung
- Auf der Suche nach dem Erlebnisbegriff
- Trennung von alltäglichen und außergewöhnlichen Erlebnissen
- Das Erlebnis aus der Sicht der Soziologen
- Das Erlebnis aus der Sicht der Psychologen
- Das Erlebnis aus der Sicht der Pädagogen
- Zusammenfassende Würdigung
- Historische Wurzeln der Erlebnispädagogik
- Ausgewählte Wegbereiter
- Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
- Henry David Thoreau (1817-1862)
- Die Reformpädagogik in Deutschland
- Arbeitsschulbewegung
- Jugendbewegung
- Kunsterziehungsbewegung
- Landerziehungsheimbewegung
- Kurt Hahns (1886-1972) Erlebnistherapie als Kristallisationspunkt
- Die drei Grundpfeiler der Hahnschen Erlebnispädagogik
- Die drei Stufen der Erlebnistherapie
- Moderne Erlebnispädagogik
- Begriffliche Abgrenzung
- Erlebnispädagogik – Eine Frage des Standpunktes
- Ist Erlebnispädagogik eine Methode?
- Oder ist es eine Wissenschaft?
- Vielleicht ist es auch eine Lebensphilosophie?
- Der Fluß Erlebnispädagogik
- Zur Entstehung des Flusses
- Der Verlauf des Flusses
- Methodische Prinzipien
- Medien
- Weitere Einflußfaktoren
- Zielorientierung
- Die Mündung des Flusses
- Weitere Bezugspunkte zur Erlebnispädagogik
- Erlebnispädagogik und Ökologie
- Erlebnispädagogik und Männlichkeit
- Erlebnispädagogik und Freiwilligkeit
- Erlebnispädagogik und „City Bound"
- Erlebnispädagogik und Intensive Sozialpäd. Einzelmaß. (ISE)
- Die Reflexion
- Reflexion - Was ist das?
- Das Modell „the mountains speak for themselves"
- Das Modell „,Outward Bound plus"
- Das metaphorische Modell
- Praktische Würdigung der Reflexionsmodelle
- Die Lernmodelle nach Simon Priest
- Weitere Reflexionsmodelle
- Der Transfer
- Transfer - Was ist das?
- Transfermodelle
- Transferhindernisse
- Transfersicherungsmaßnahmen
- Transfersicherung vor der Maßnahme
- Transfersicherung nach der Maßnahme
- Transferanforderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema „Transferprobleme in der Erlebnispädagogik". Sie analysiert die Herausforderungen, die mit dem Transfer von erlebten Inhalten und Kompetenzen aus erlebnispädagogischen Maßnahmen in den Alltag verbunden sind.
- Der Begriff des Erlebnisses und dessen Relevanz für die Pädagogik
- Die historischen Wurzeln der Erlebnispädagogik und ihre Entwicklung
- Die Analyse von Reflexions- und Transfermodellen in der Erlebnispädagogik
- Die Identifizierung von Transferhindernissen und -sicherungsmaßnahmen
- Die Bedeutung von Freiwilligkeit und Kontextfaktoren für den Transferprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Das Erlebnis
- Kapitel 2: Historische Wurzeln der Erlebnispädagogik
- Kapitel 3: Moderne Erlebnispädagogik
- Kapitel 4: Die Reflexion
- Kapitel 5: Der Transfer
Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Erlebnisbegriffs und dessen Bedeutung im Kontext der Pädagogik. Es werden verschiedene Perspektiven auf das Erlebnis aus der Soziologie, Psychologie und Pädagogik beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis des Konzepts zu entwickeln.
Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung der Erlebnispädagogik nach. Es werden wichtige Wegbereiter wie Jean Jacques Rousseau und Henry David Thoreau vorgestellt und die Bedeutung der Reformpädagogik in Deutschland für die Entstehung der Erlebnispädagogik hervorgehoben. Zudem wird die Rolle von Kurt Hahns und seiner Erlebnistherapie im Kontext der Entwicklung des Feldes beleuchtet.
Dieses Kapitel befasst sich mit der modernen Erlebnispädagogik und ihrer Positionierung im Feld der Pädagogik. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Erlebnispädagogik als Methode, Wissenschaft oder Lebensphilosophie diskutiert. Zudem werden wichtige Elemente des "Flusses Erlebnispädagogik" wie methodische Prinzipien, Medien und Zielorientierung analysiert.
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Reflexion in der Erlebnispädagogik. Es werden verschiedene Reflexionsmodelle vorgestellt und deren praktische Bedeutung für die Verarbeitung und den Transfer von erlebten Inhalten diskutiert. Darüber hinaus werden Lernmodelle nach Simon Priest und weitere Reflexionsansätze betrachtet.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Transfer von erlebten Inhalten und Kompetenzen aus erlebnispädagogischen Maßnahmen in den Alltag. Es werden verschiedene Transfermodelle, Transferhindernisse und -sicherungsmaßnahmen analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, wie der Transfer von erlebten Inhalten und Kompetenzen in den Alltag gelingen kann.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Transfer, Reflexion, Erlebnis, Bildung, Pädagogik, Methode, Wissenschaft, Lebensphilosophie, Reformpädagogik, Kurt Hahns, Freiwilligkeit, Kontext, Alltag.
- Quote paper
- Arno Günther (Author), 2004, Transferprobleme in der Erlebnispädagogik. Das Erlebnis zwischen blindem Aktionismus und pädagogisch begleiteter Maßnahme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28038