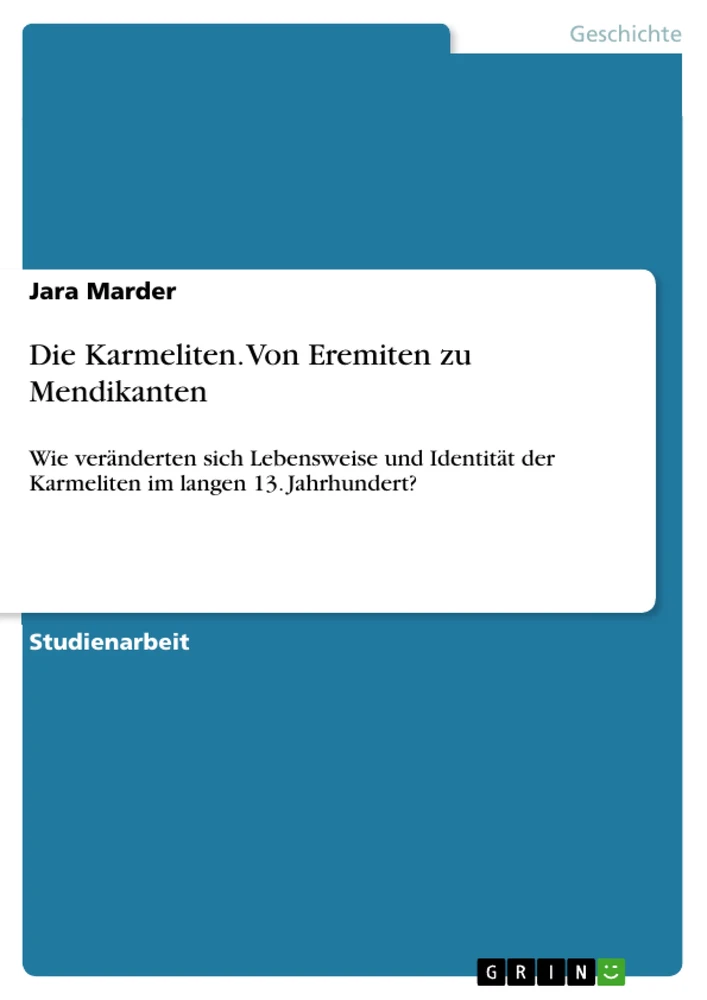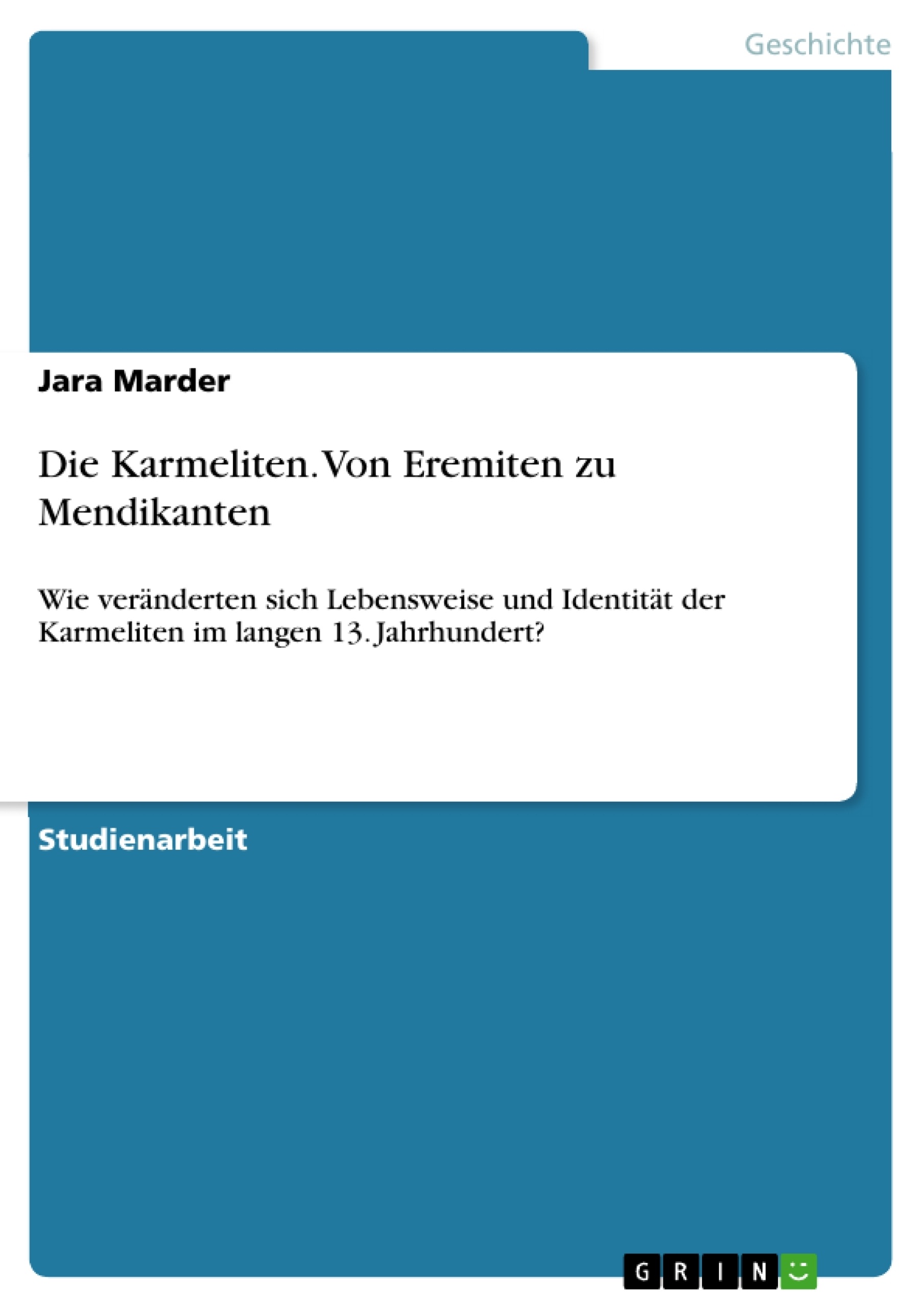„Die Festung des Karmel ist nicht die mit Mauern umgebene Stadt, sondern die offene Wüste .“ (Smet, Joachim)
Das Zitat von Joachim Smet dient insofern als Einstieg in diese Arbeit, als dass es auf wichtige Aspekte in der Geschichte des Karmelitenordens hinweist: zum einen deuten die Begriffe offene Wüste und die von Mauern umgebene Stadt auf zwei von Grund auf unterschiedliche Lebensumfelder hin, in denen sich die Gemeinschaft im Laufe ihrer Geschichte aufhielt. Zum anderen enthält das Zitat offensichtlich eine Kritik an letzterem Umfeld, was im Folgenden ebenso von Bedeutung sein wird. Während der Forschung zum Orden der Karmeliten darauf aufmerksam geworden, führte mich genau diese Diskrepanz zu meinen beiden zusammenhängenden Leitfragen, welche im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. So werde ich zunächst erörtern, inwiefern sich ein Wandel der karmelitischen Lebensweise anhand dreier mittelalterlichen Quellen nachvollziehen lässt, um im Anschluss zu fragen, welche Auswirkungen diese Veränderungen bezüglich der Identität beziehungsweise des Selbstverständnisses der Karmeliten nach sich zogen. Wie bereits im Titel angedeutet, soll demnach der Wandel von den anfänglichen Eremiten am Berg Karmel bis hin zum anerkannten Mendikantenorden in Bezug auf Lebensform und Identität beleuchtet werden, weshalb ich folgende Quellen aus unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Ordens herangezogen habe: die Regel von Albert, welche zwischen 1206 und 1214 entstand, die Bulle von Papst Innozenz IV. aus dem Jahr 1247 und die Konstitution des Generalkapitels, die 1324 verfasst wurde. Um diese Texte richtig einordnen und interpretieren zu können, werde ich im ersten Teil der Arbeit zunächst die jeweiligen Entstehungskontexte knapp zusammenfassen und anschließend zu einer inhaltlichen Untersuchung der Quellen im Hinblick auf den Lebenswandel übergehen. Im dritten Teil dieser Arbeit werde ich zwar erneut auf die Quellen verweisen, dennoch wird mein Blick auch über dieselben hinausgehen, um die Identitätsfrage entsprechend hervorheben und die Forschungsfragen letztlich beantworten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Karmeliten im langen Jahrhundert: Entstehungskontexte der Quellen
- 2.1 Die Einsiedler vom Berge Karmel
- 2.2 Die Anfänge in Europa
- 2.3 Der Weg zum Bettelorden
- 3. Der Lebenswandel der Karmeliten
- 3.1 Die Regel von Albert
- 3.2 Die Bulle des Papst Innozenz IV.
- 3.3 Die Konstitution des Generalkapitels
- 4. Identität im Wandel?
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Veränderungen in der Lebensweise und Identität des Karmelitenordens im langen 13. Jahrhundert. Sie analysiert die Entwicklung des Ordens von den anfänglichen Eremiten am Berg Karmel bis hin zum anerkannten Bettelorden. Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Selbstverständnis der Karmeliten.
- Die Entwicklung der Lebensweise der Karmeliten im 13. Jahrhundert
- Die Rolle der Regeln und Dokumente in der Gestaltung der Lebensweise
- Der Wandel der karmelitischen Identität im Zusammenhang mit der Veränderung der Lebensweise
- Die Bedeutung der Quellen für die Analyse der karmelitischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung führt die Arbeit ein und stellt die Leitfragen vor, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Dabei wird das Zitat von Joachim Smet als Einstiegspunkt verwendet und die Bedeutung der „offenen Wüste“ im Vergleich zur „mit Mauern umgebenen Stadt“ für die Geschichte des Ordens erläutert.
- Kapitel 2: Die Karmeliten im langen Jahrhundert: Entstehungskontexte der Quellen - Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Ordens, indem es die Geschichte der Einsiedler vom Berge Karmel und deren Anfänge in Europa nachzeichnet. Es analysiert die Gründe für die Umsiedlung der Karmeliten aus dem Heiligen Land und stellt den Kontext ihrer Integration in die europäische Gesellschaft dar.
- Kapitel 3: Der Lebenswandel der Karmeliten - Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Regeln und Dokumente, die die Lebensweise der Karmeliten im Laufe des 13. Jahrhunderts prägten. Es analysiert die Regel von Albert, die Bulle von Papst Innozenz IV. und die Konstitution des Generalkapitels.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Eremiten, Bettelorden, Karmeliten, Lebensweise, Identität, Regel von Albert, Bulle von Papst Innozenz IV., Konstitution des Generalkapitels, Geschichte des 13. Jahrhunderts, Mittelalter, Quellenanalyse, historische Entwicklung.
- Quote paper
- Jara Marder (Author), 2013, Die Karmeliten. Von Eremiten zu Mendikanten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280277