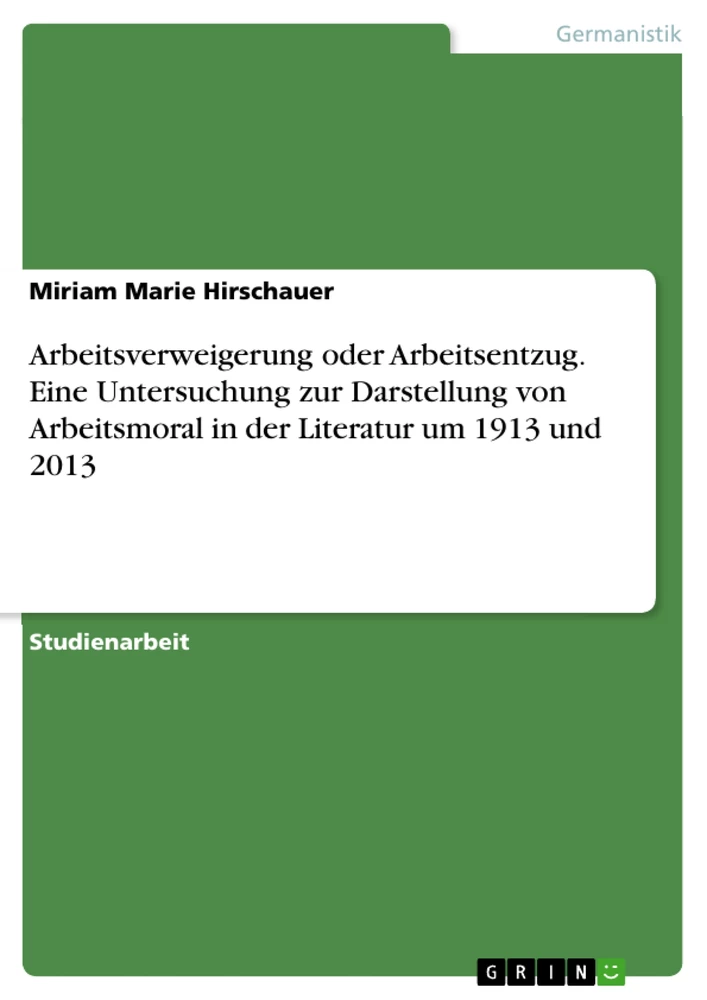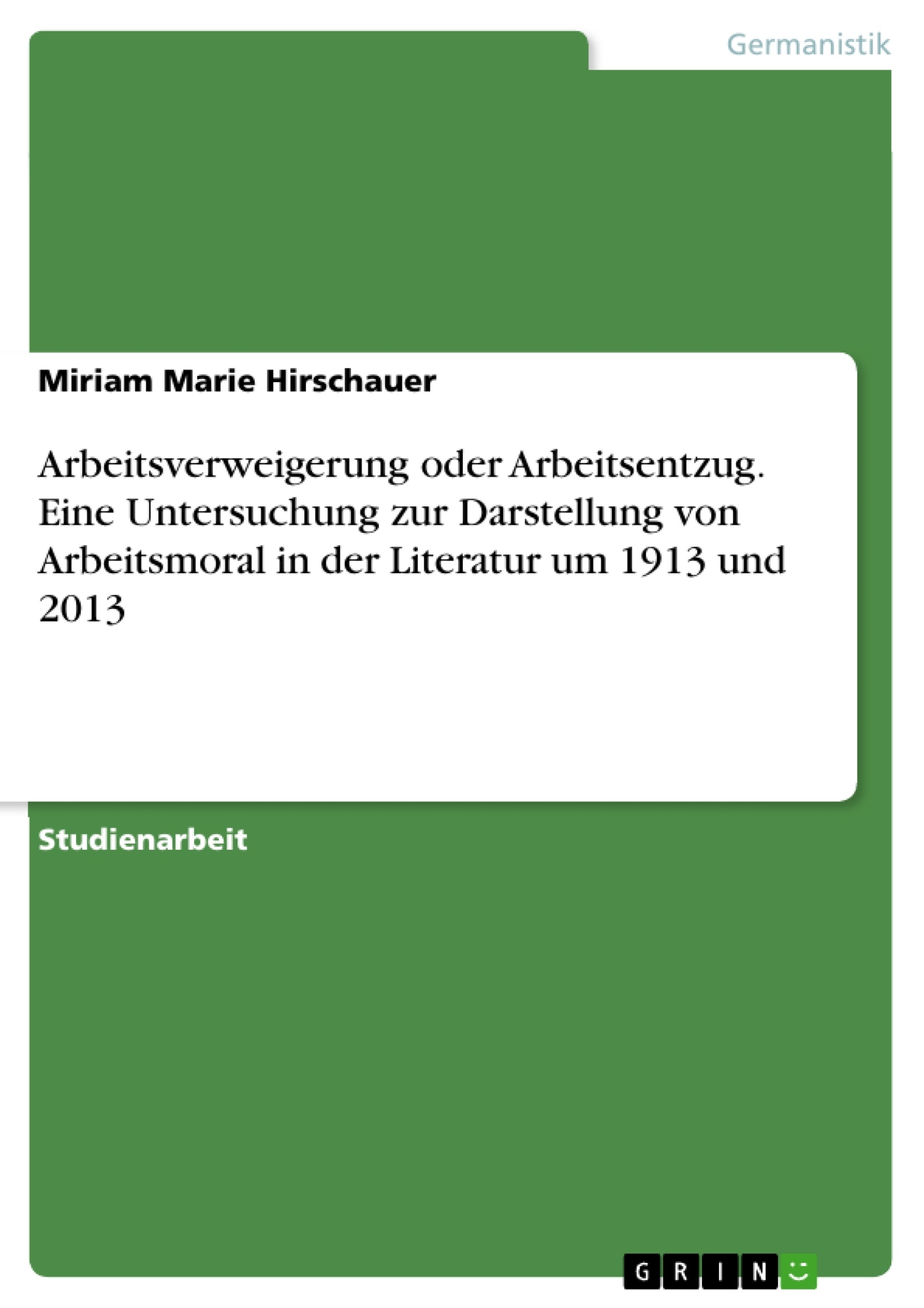Wenn ein Angestellter permanent überfordert ist, am Limit arbeitet und dem¬entsprechend emotional ausgelaugt ist, nennt man das Resultat Burnout. Wenn ein Angestellter permanent unterfordert ist und sich langweilt, nennt man das Bore¬out. Ist ein Mitarbeiter, der am Burnout-Syndrom leidet, mit einer höheren Arbeitsmoral ausgestattet als der sich Langweilende? – Und wie nennt man einen, der sich gleichzeitig unter- und überfordert fühlt? In unserer heutigen beschleunigten Gesellschaft ist es fast schon schick geworden, an Burnout zu leiden. Wer das hat, ist ein Arbeitstier und genießt Anerkennung dafür, dass er sich für seinen Beruf so aufopfert. Das Gegenteil ist dabei weniger prestigeträchtig: An Boreout zu leiden, weil man im Beruf keine anspruchsvollen Aufgaben zugewiesen bekommt, wird lieber verschwiegen. Noch weniger kommt zur Sprache, wenn man gar keine Lust hat zu arbeiten und sich stattdessen gar seiner Faulheit hingibt. Ein solcher Angestellter wird nicht nur von Chef und Kollegen verdrossen beäugt, er sollte seine Einstellung auch nicht außerhalb der Arbeit zum Besten geben. In den folgenden Kapiteln soll von genau solchen Angestellten aus der Literatur berichtet werden: von einem, der träge und arbeitsscheu ist, und von einem, dem trotz seiner Motiviertheit das effektive Arbeiten verwehrt wird. Diese zwei Figuren spiegeln jeweils ihre eigene Arbeitsmoral wider und passen doch in ihre jeweilige Zeit. Während der Faule seiner Kontorarbeit um 1913 in Robert Walsers Helblings Geschichte nachgeht, beschreibt Matthias Roth seine Situation in Der Hauptstadtflughafen genau hundert Jahre später. Beide Autoren verarbeiten mit ihrem jeweiligen Werk autobiografisch ihre Erlebnisse. „Arbeitsmoral ist [nach heutigem Sprachverständnis] als die Einstellung und Haltung eines Arbeitnehmers zu seiner Arbeit sowie zu der bei ihrer Durchführung befolgten Sorgfalt zu verstehen“, schreibt Fred J. Heidemann in seiner Auswertung einer Studie der Bertelsmann Stiftung über die Arbeitsmotivation bei Angestellten in der deutschen Wirtschaft. Weiter heißt es: „Allgemein wird derjenige mit einer hohen oder guten Arbeits¬moral charakterisiert, der gute Arbeitsleistungen erbringt, diszipliniert und fleißig arbeitet und seine Arbeitspflichten pünktlich, gewissenhaft und ordentlich verrichtet.“ Mit diesem Verständnis dieser Definition von Arbeitsmoral soll die Haltung der Protagonisten der zu untersuchenden Erzählungen dazu analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitsmoral und Arbeitsmotivation um 1900 und heute
- 3. Das Beispiel aus der Literatur: Eine Analyse
- 3.1 Faulheit und Utopie: Robert Walsers Helblings Geschichte
- 3.2 Motiviertheit und Zynismus: Matthias Roths Der Hauptstadtflughafen
- 3.3 Motivation vs. Demotivation: Der Vergleich
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013, indem sie die Arbeitsmoral und -motivation der Angestellten dieser Zeit anhand literarischer Beispiele analysiert. Sie beleuchtet, wie sich die Einstellung zur Arbeit im Laufe der Zeit verändert hat und welche Faktoren diese Veränderung beeinflussen.
- Entwicklung der Arbeitsmoral von der Jahrhundertwende bis heute
- Kontrast zwischen Faulheit und Utopie (Robert Walser)
- Motiviertheit und Zynismus in modernen Arbeitskontexten (Matthias Roth)
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Arbeitsmoral
- Vergleich der Arbeitsmoral in unterschiedlichen literarischen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Arbeitsmoral ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie wird Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013 dargestellt? Sie beleuchtet die Gegensätze von Burnout und Boreout und führt die beiden literarischen Figuren ein, die im Mittelpunkt der Analyse stehen: den arbeitsscheuen Angestellten aus Walsers Werk und den motivierten, aber ineffektiv arbeitenden Angestellten aus Roths Werk. Die Arbeit untersucht, wie diese Figuren ihre jeweilige Arbeitsmoral widerspiegeln und wie sie in ihre jeweilige Zeit passen.
2. Arbeitsmoral und Arbeitsmotivation um 1900 und heute: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der Arbeitsmoral und ihre Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert. Es beleuchtet die Veränderung der Einstellung zur Arbeit vom Mittelalter über den Calvinismus bis hin zur Industrialisierung und der Entstehung des modernen Büroangestellten. Das Kapitel diskutiert den Wandel der Arbeitssituation vom religiös geprägten Verständnis im Mittelalter bis hin zur Entfremdung des Arbeiters von seiner Tätigkeit im Kapitalismus. Es analysiert die Rolle von Sinnhaftigkeit und gesellschaftlicher Anerkennung im Kontext der Arbeitsmotivation und stellt die Herausforderungen für Arbeitnehmer im Umgang mit monotonen Aufgaben und Ineffizienz dar.
Schlüsselwörter
Arbeitsmoral, Arbeitsmotivation, Literatur, Robert Walser, Matthias Roth, Jahrhundertwende, Industrialisierung, Kapitalismus, Entfremdung, Burnout, Boreout, Büroangestellte, Effektivität, gesellschaftliche Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen: Analyse von Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013. Sie untersucht die Arbeitsmoral und -motivation von Angestellten dieser Zeit anhand literarischer Beispiele und beleuchtet die Veränderung der Einstellung zur Arbeit im Laufe der Zeit und die Faktoren, die diese Veränderung beeinflussen.
Welche literarischen Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Robert Walsers „Helblings Geschichte“ als Beispiel für Faulheit und Utopie um 1913 und Matthias Roths „Der Hauptstadtflughafen“ als Beispiel für Motiviertheit und Zynismus in einem modernen Arbeitskontext (2013). Der Vergleich dieser beiden Werke steht im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Arbeitsmoral von der Jahrhundertwende bis heute, den Kontrast zwischen Faulheit und Utopie bei Walser, Motiviertheit und Zynismus bei Roth, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Arbeitsmoral und den Vergleich der Arbeitsmoral in unterschiedlichen literarischen Kontexten. Sie beleuchtet auch die Gegensätze von Burnout und Boreout.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über Arbeitsmoral und Arbeitsmotivation um 1900 und heute, einem Kapitel mit der Literaturanalyse (einschließlich der Einzelanalysen von Walsers und Roths Werken und einem Vergleich), und einer Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Das Kapitel über Arbeitsmoral und Arbeitsmotivation um 1900 und heute untersucht die historischen Wurzeln der Arbeitsmoral und ihre Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert. Es beleuchtet die Veränderung der Einstellung zur Arbeit vom Mittelalter über den Calvinismus bis hin zur Industrialisierung und der Entstehung des modernen Büroangestellten, inklusive des Wandels der Arbeitssituation und der Rolle von Sinnhaftigkeit und gesellschaftlicher Anerkennung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Arbeitsmoral, Arbeitsmotivation, Literatur, Robert Walser, Matthias Roth, Jahrhundertwende, Industrialisierung, Kapitalismus, Entfremdung, Burnout, Boreout, Büroangestellte, Effektivität, gesellschaftliche Veränderungen.
Welche zentrale Fragestellung wird untersucht?
Die zentrale Fragestellung lautet: Wie wird Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013 dargestellt?
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Darstellung von Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013 zu untersuchen und die Veränderungen der Einstellung zur Arbeit im Laufe der Zeit zu analysieren.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Miriam Marie Hirschauer (Author), 2014, Arbeitsverweigerung oder Arbeitsentzug. Eine Untersuchung zur Darstellung von Arbeitsmoral in der Literatur um 1913 und 2013, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280210