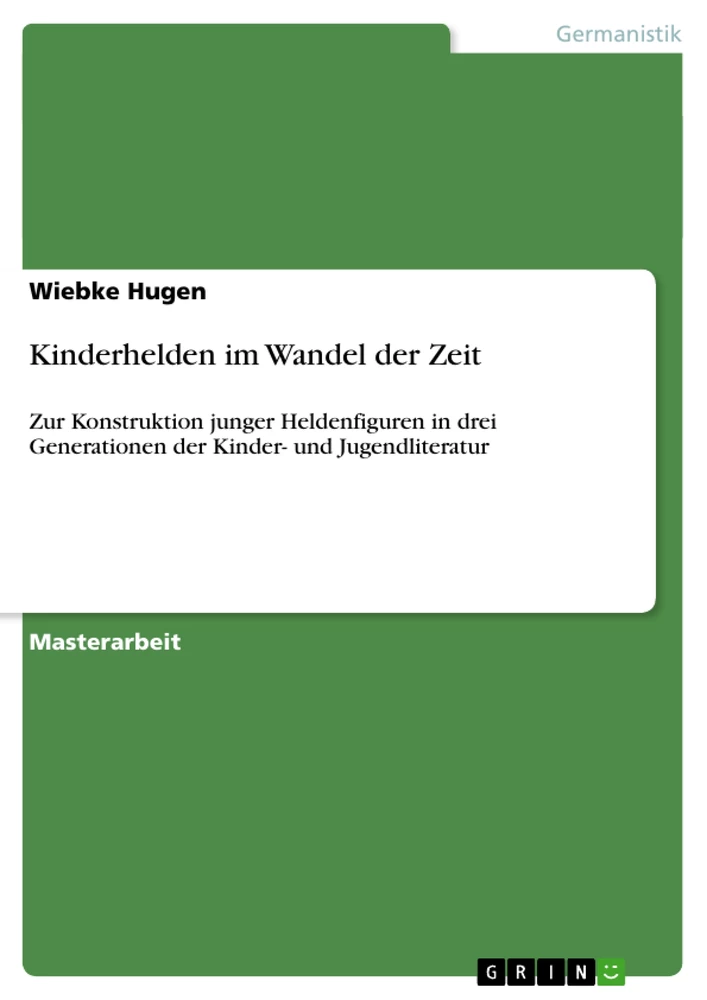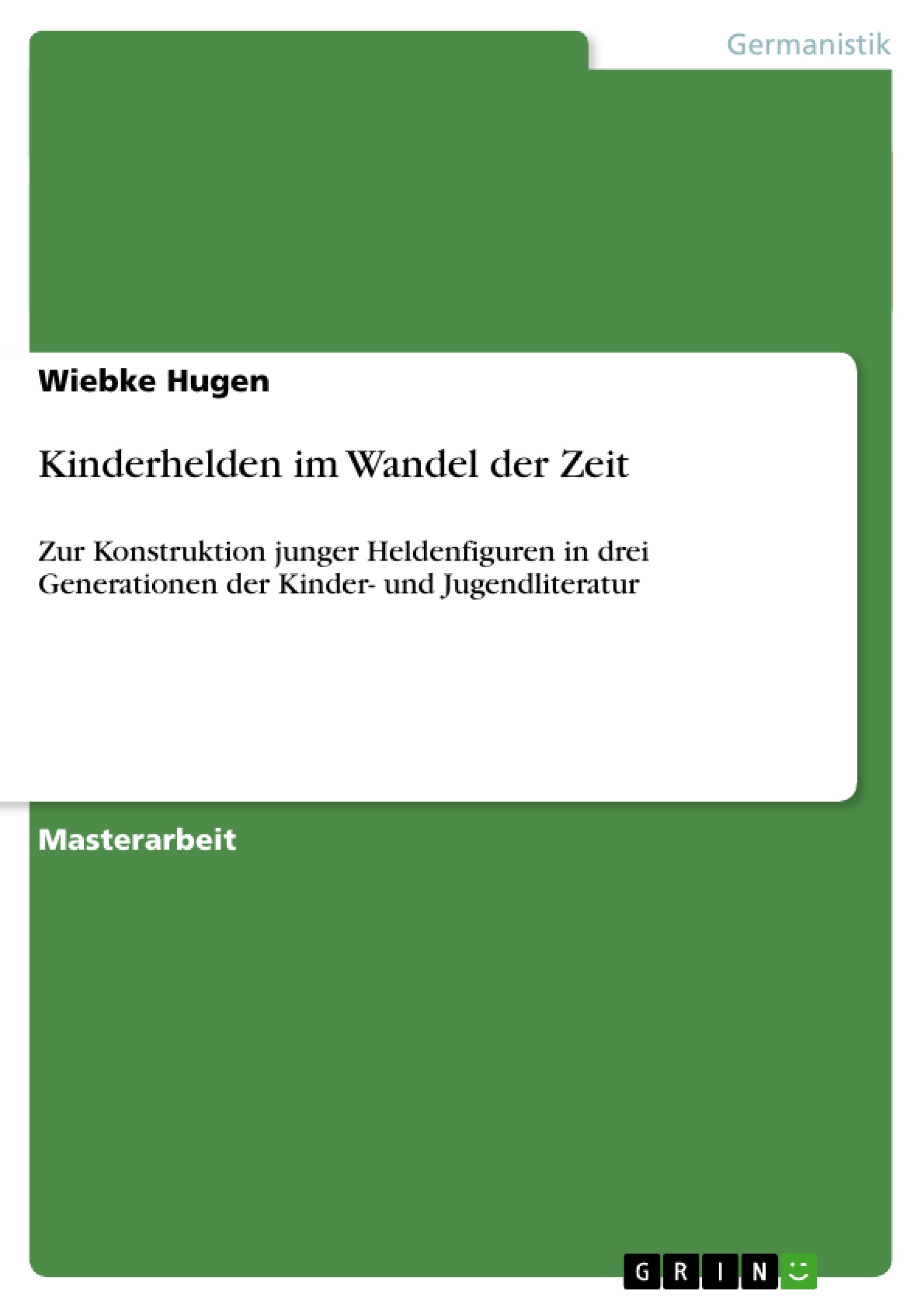Was macht Kinderhelden aus? Seit wann konnten heroisch agierende Kinderfiguren in der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur überhaupt existieren? Wie hat sich ihr Bild im Laufe der Zeit möglicherweise gewandelt? Zur Beantwortung dieser Fragen sollen die Helden aus drei exemplarischen Werken untersucht werden, die die Entwicklung der Kinderhelden im 20. Jahrhundert besonders gut illustrieren: Erich Kästners „Emil und die Detektive“, Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ und Joanne K. Rowlings „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Ausgewählt wurden die Texte aufgrund ihres Bekanntheitsgrads wie auch aufgrund ihrer Beliebtheit und – damit einhergehend – ihres Verkaufserfolgs, da diese Aspekte die hierin vorkommenden Figuren nach Ansicht der Verfasserin dieser Arbeit als besonders repräsentative Kinderhelden auszeichnen. In der Arbeit soll herausgefunden werden, inwiefern die betrachteten Kinderhelden die Umstände ihrer Entstehungszeit reflektieren und ob bzw. wie etwaige Unterschiede zwischen den analysierten Texten auf einen Wandel des Kinderheldenbildes zwischen den 1920er Jahren und den 1990er Jahren hinweisen. Die Unterkapitel zu jedem bearbeiteten Text folgen der gleichen Struktur: Im ersten Teil der drei Analysen wird jeweils ein Überblick zur Entstehung des Werkes gegeben. Hierzu werden die Grundhaltung der Autoren zum Thema Kindheit, aus der sich die Konstruktion ihrer Figuren herleiten lässt, die zeitlichen bzw. nationalliterarischen Gegebenheiten, unter denen das Buch entstanden ist, sowie die seinerzeitigen Leserreaktionen thematisiert. An dieser Stelle wird bereits deutlich werden, welche Bedeutung den Protagonisten der Texte als Vertreter neuen Generation von Kinderhelden zukommt. Anschließend wird die Konstruktion der Figuren ausführlich untersucht; dabei interessieren vor allem deren charakterliche Merkmale, das Verhältnis der Protagonisten untereinander, Fragen zur Darstellung der Geschlechter sowie der jeweilige Neuheitswert der Figuren bzw. mögliche Alleinstellungsmerkmale gegenüber den bis dahin bekannten Kinderhelden. Zusammenfassend soll schließlich jeweils festgestellt werden, was die Figuren als echte Heldenfiguren auszeichnet. Abschließend werden die Ergebnisse der drei Textanalysen in der Schlussbetrachtung resümiert dargestellt und, nach Möglichkeit, Antworten auf die eingangs gestellten Fragen gefunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum tradierten Heldenbegriff
- Wer oder was ist ein Held?
- Warum brauchen wir Helden?
- Der Held in der Literatur
- Zum Begriff des Kinderhelden
- Kinderhelden im Wandel der Zeit
- Emil Tischbein und seine Detektive - Geburtsstunde der Kinderhelden
- Zu Entstehung, Rezeption und Kritik
- Figurenanalyse
- Zwischenfazit I: Emil & Co. als Kinderhelden
- Pippi Langstrumpf – „Ich mach' mir die Welt, wie sie mir gefällt“
- Zu Entstehung, Rezeption und Kritik
- Figurenanalyse
- Zwischenfazit II: Pippi als Kinderheldin
- Harry Potter - klassischer Held in neuem Gewand
- Entwicklungen der KJL zwischen den 1950er und 1990er Jahren
- Zu Entstehung, Rezeption und Kritik
- Figurenanalyse
- Zwischenfazit III: Harry & Co. als Kinderhelden
- Emil Tischbein und seine Detektive - Geburtsstunde der Kinderhelden
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Kinderheldenbildes in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur anhand dreier exemplarischer Werke: Erich Kästners „Emil und die Detektive“, Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ und Joanne K. Rowlings „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern die Kinderhelden ihre jeweilige Entstehungszeit reflektieren und ob sich das Bild des Kinderhelden im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert hat.
- Der Wandel des Heldenbegriffs im Laufe der Zeit
- Die Konstruktion von Kinderheldenfiguren in verschiedenen literarischen Epochen
- Der Einfluss historischer, politischer und sozialer Faktoren auf die Gestaltung von Kinderhelden
- Vergleichende Analyse der Kinderheldenfiguren Emil, Pippi und Harry
- Reflexion der jeweiligen Rezeption und Kritik der ausgewählten Werke
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Wandel des Kinderheldenbildes im 20. Jahrhundert. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einer vergleichenden Analyse dreier exemplarischer Werke beruht: „Emil und die Detektive“, „Pippi Langstrumpf“ und „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Die Auswahl der Werke begründet sich auf ihrem Bekanntheitsgrad und ihrer Repräsentativität für die jeweilige Epoche. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der ersten Bände der jeweiligen Reihen, um die Vergleichbarkeit der Kinderheldenfiguren zu gewährleisten.
Zum tradierten Heldenbegriff: Dieses Kapitel beleuchtet den klassischen Heldenbegriff aus anthropologischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive. Es werden wichtige Fragen zum Heldenbegriff erörtert: Was kennzeichnet einen Helden? Warum brauchen wir Helden? Wie wird der Held in der Literatur dargestellt? Dieses Kapitel dient als Grundlage für die anschließende Analyse der Kinderheldenfiguren, indem es den allgemeinen Rahmen für das Verständnis von Heldentum etabliert. Es werden wichtige Forschungsbeiträge zum Thema herangezogen, um einen fundierten Überblick über den traditionellen Heldenbegriff zu geben.
Zum Begriff des Kinderhelden: Dieses Kapitel befasst sich mit der spezifischen Definition des "Kinderhelden". Es differenziert den Begriff vom allgemeinen Heldenbegriff und analysiert die besonderen Charakteristika von Kinderheldenfiguren in der Literatur. Dieses Kapitel ist entscheidend für die konsistente Anwendung des Begriffs in der folgenden Analyse der drei ausgewählten Werke. Es schafft eine klare Grundlage für den Vergleich der verschiedenen Kinderhelden.
Kinderhelden im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die drei ausgewählten Werke – „Emil und die Detektive“, „Pippi Langstrumpf“ und „Harry Potter und der Stein der Weisen“ – in Bezug auf ihre Kinderheldenfiguren. Für jedes Werk wird die Entstehung, die Rezeption und die Kritik beleuchtet. Die Figurenanalyse konzentriert sich auf die Charaktereigenschaften der jeweiligen Helden und untersucht, inwiefern diese die gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten ihrer Entstehungszeit reflektieren. Die Zwischenfazits zu jedem Werk ziehen die Ergebnisse der Analysen zusammen und zeigen auf, wie sich das Bild des Kinderhelden im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt hat.
Schlüsselwörter
Kinderhelden, Kinder- und Jugendliteratur, Heldenbegriff, Figurenanalyse, Erich Kästner, Astrid Lindgren, Joanne K. Rowling, Emil Tischbein, Pippi Langstrumpf, Harry Potter, Epochenvergleich, gesellschaftliche Entwicklung, Literaturgeschichte, Rezeption, Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Wandel des Kinderheldenbildes im 20. Jahrhundert"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Kinderheldenbildes in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur des 20. Jahrhunderts. Sie analysiert, inwiefern Kinderhelden ihre Entstehungszeit widerspiegeln und wie sich das Bild des Kinderhelden im Laufe des Jahrhunderts verändert hat.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei exemplarische Werke: Erich Kästners "Emil und die Detektive", Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" und Joanne K. Rowlings "Harry Potter und der Stein der Weisen". Die Auswahl basiert auf Bekanntheitsgrad und Repräsentativität für ihre jeweiligen Epochen.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Heldenbegriffs, der Konstruktion von Kinderheldenfiguren in verschiedenen literarischen Epochen, dem Einfluss historischer, politischer und sozialer Faktoren auf die Gestaltung von Kinderhelden, einem Vergleich der Kinderheldenfiguren Emil, Pippi und Harry sowie der Reflexion der jeweiligen Rezeption und Kritik der ausgewählten Werke.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum traditionellen Heldenbegriff, ein Kapitel zum Begriff des Kinderhelden, ein Kapitel zur Analyse der drei ausgewählten Werke mit Fokus auf Entstehung, Rezeption, Kritik und Figurenanalyse (inklusive Zwischenfazits für jedes Werk) und eine Schlussbetrachtung. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie hat sich das Bild des Kinderhelden im 20. Jahrhundert verändert? Zusätzliche Fragen untersuchen den traditionellen Heldenbegriff, die spezifischen Merkmale von Kinderhelden und den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die Gestaltung dieser Figuren.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der drei ausgewählten Werke. Es werden die Entstehungskontexte der Werke berücksichtigt und die Figuren anhand ihrer Charaktereigenschaften analysiert. Die Rezeption und Kritik der Werke werden ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderhelden, Kinder- und Jugendliteratur, Heldenbegriff, Figurenanalyse, Erich Kästner, Astrid Lindgren, Joanne K. Rowling, Emil Tischbein, Pippi Langstrumpf, Harry Potter, Epochenvergleich, gesellschaftliche Entwicklung, Literaturgeschichte, Rezeption, Kritik.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung des Kinderheldenbildes im 20. Jahrhundert aufzuzeigen und zu analysieren, inwiefern die ausgewählten Kinderheldenfiguren ihre jeweilige Entstehungszeit reflektieren.
- Quote paper
- Wiebke Hugen (Author), 2014, Kinderhelden im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279945