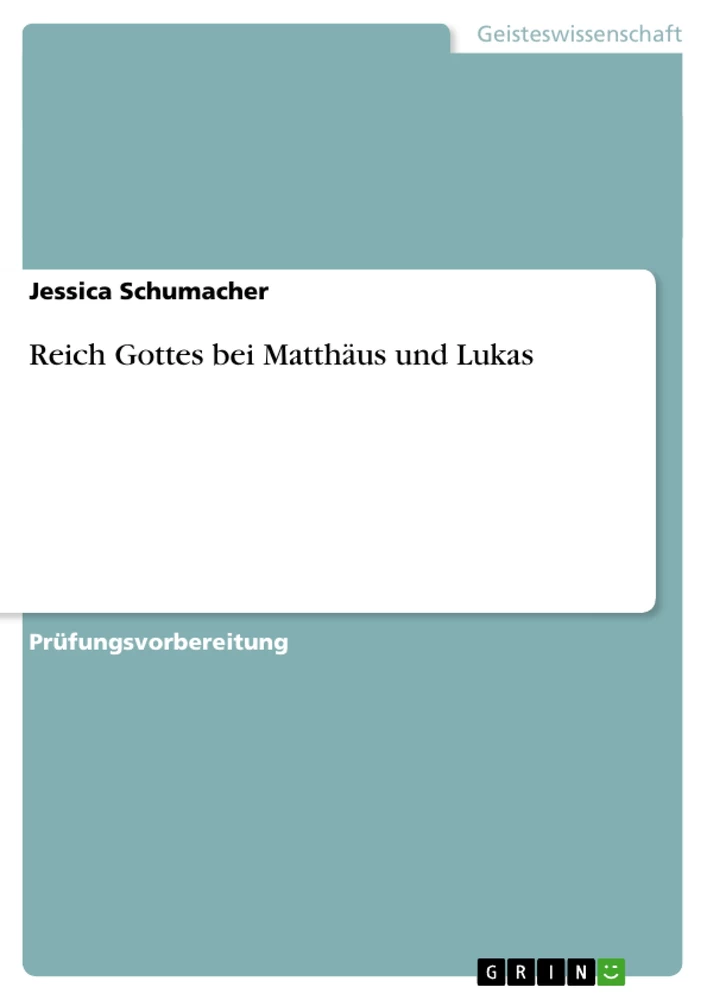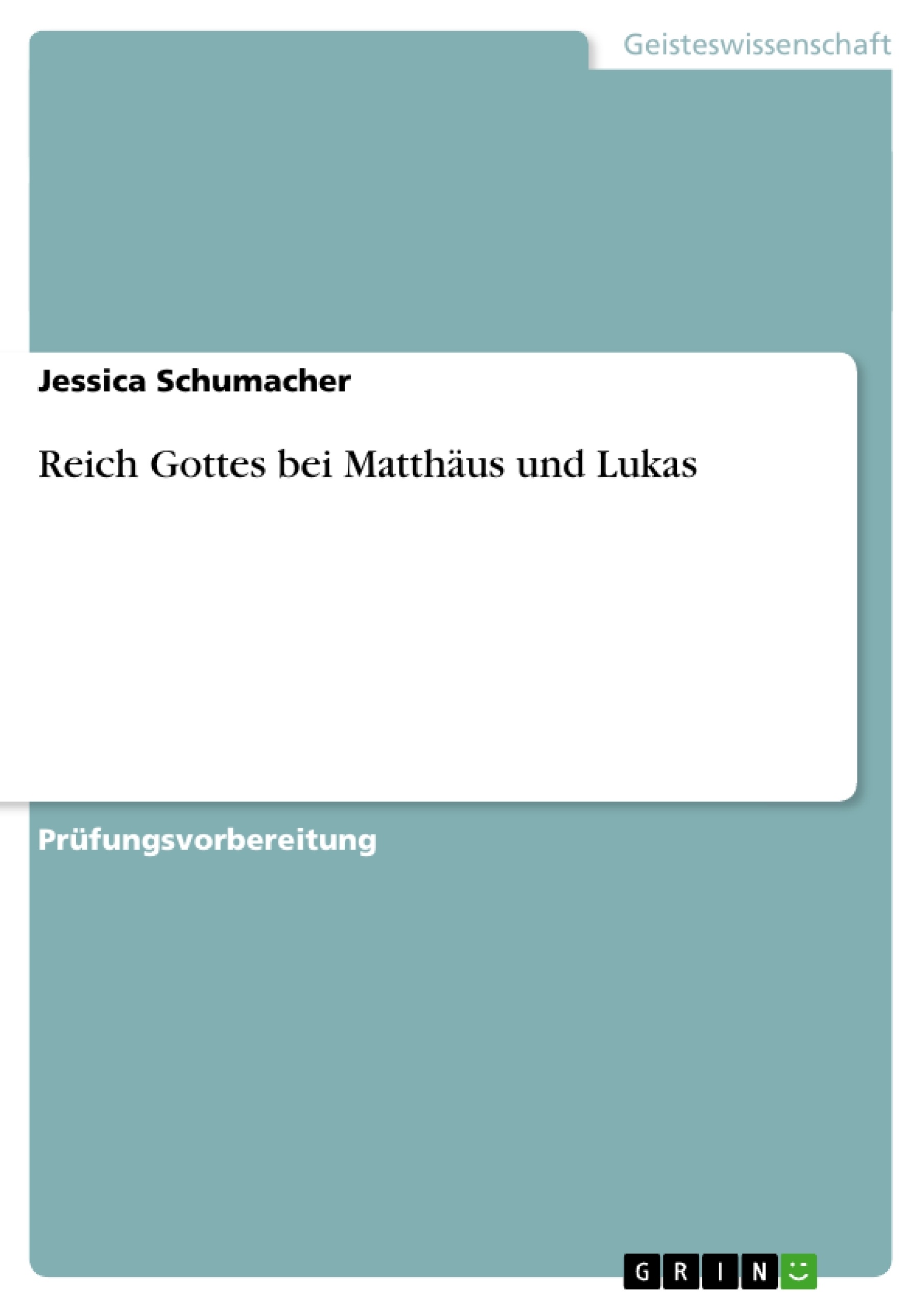„Der Zentralbegriff der Verkündigung Jesu, den wir für gewöhnlich mit ,Reich Gottes’ übersetzen, aber nach seiner hebräisch-aramäischen Grundlage passender mit ,Königtum’ oder ,Königsherrschaft Gottes’ wiedergeben sollten, da er nur für manche bildhafte Wendungen (zum Beispiel ,eingehen ins Gottesreich’) die sich auf die vollendete kosmische Gottesherrschaft am Ende der Welt beziehen, die Vorstellung eines ,Reiches’ nahelegt, sonst aber stets die königliche Macht und Machtausübung Gottes meint, hat eine lange und reiche Geschichte, die weit ins AT zurückreicht, in Jesu Botschaft ihren Höhepunkt findet und danach noch manchen Entwicklungen ausgesetzt ist.“
Inhaltsverzeichnis
- Prolog: Abstammung und Geburt des Christus Jesus von Nazareth 1,1-2,23
- Das Evangelium vom Reich 3,1-7,29
- Die Ausbreitung des Reiches 8,1-11,1
- Die Predigt vom Königreich – Beginn des offenen Widerstandes 11,2-13,53
- Der Widerstand nimmt zu 13,54-19,2
- Vorgeschichte der Passion 19,2-26,5
- Das Leiden und Auferstehen von Jesus 26,6-28,20
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des „Reich Gottes“ in den Evangelien nach Matthäus und Lukas. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen des Begriffs in beiden Evangelien und beleuchtet die Bedeutung des „Reich Gottes“ für die jeweilige Gemeinde und die Zeit, in der die Evangelien entstanden sind.
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf das „Reich Gottes“ in den Evangelien nach Matthäus und Lukas
- Die Bedeutung des „Reich Gottes“ für die jeweilige Gemeinde
- Die Rolle des „Reich Gottes“ in der Heilsgeschichte
- Die Bedeutung des „Reich Gottes“ für das Leben der Christen
- Die Beziehung zwischen dem „Reich Gottes“ und der Parusie
Zusammenfassung der Kapitel
Das Matthäusevangelium (Mt) orientiert sich in seiner Gattung und Perikopenreihenfolge an Markus (Mk). Es verwendet Q als Materialsammlung und ordnet den Q-Stoff in kleinere Blöcke ein. Auch einiges S ist vorhanden. Mt setzt bei seinen Lesern viel voraus: So erläutert er bspw. jüdische Gebräuche, Ordnungen und Redensarten nicht und benutzt gelegentlich sogar aramäische Worte in griechischer Umschrift. Hieraus entsteht der Eindruck, dass er selbst Judenchrist ist und auch an die judenchristliche Gemeinde schreibt. Allerdings steht der Missionsbefehl in 28,19-20, sodass wohl auch „Heidenmission“ betrieben wird.² Zu Beginn verengt sich die Perspektive des Ev auf Jesus (10,5) (zumal die Geburt Jesu bereits Astrologen aus dem östlichen Kulturkreis wahrnehmen, kommen und Jesus anbeten (2,1-12)), weitet sich gegen Ende jedoch ins Universale, auf alle Völker 26,1-28,18. Also ist Mt im hellenistischen Judenchristentum anzuordnen.
Mt spricht als einziger von der Herrschaft der Himmel und nur an wenigen Stellen von der Herrschaft Gottes – Mk und Lk hingegen ausschließlich von der Herrschaft Gottes. Mt setzt viele Ereignisse aus Jesu Leben in Beziehung zum AT und will so nachweisen, dass sich in Jesus die messianischen Weissagungen erfüllt haben und Jesus von Nazareth der Messias Israels ist.³ Dies zeigt sich bspw. am messianischen Titel: Sohn Davids. (12,23; 15,22; 21,9.15) 4 Jesus ist der erhöhte Menschensohn, der sein universales Reich aufrichtet.
Mt interpretiert die Thora universalistisch und formuliert seine Schwerpunkte in vier Punkten5: In der Goldenen Regel (7,12) 1,Im Doppelgebot der Liebe (22,37-40) Das Wichtigste der Gesetze sind „Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue“ (23,23) Jesus zählt die sechs Taten der Barmherzigkeit auf (25,35f). Mt wählt ein dualistisches Erzählkonzept: „In dualistischen Erzählungen wird der kontradiktorische Grundgegensatz der Erzählung am Anfang etabliert und sowohl in der Mitte als auch am Ende aufrechterhalten. Der Grundgegensatz wird mithin in Erzählungen dieser Art nicht vermittelt und in keiner Weise beseitigt. Das Mtev gehört zu diesem Erzähltypus. Dies erklärt die erzählerische Begeisterung für ausweglose existenzielle Desaster, für finster Verhängnisvolles, für schreckliche Traumsituationen, die leider identisch mit dem Wachzustand sind. Irgendwann hat sich der kontradiktorische Gegensatz von Reich der Himmel' und, ewigem Feuer', von,Menschensohn' und, Teufel' ausgebildet. Beide säen, der eine Unkraut, der andere Weizen (Mt 13 ). [...] Die Erlöserfigur steht dabei auf der positiven Seite des kontradiktorischen Gegensatzes." Bei Mt ist dies kommunikationszentriert gewendet, denn niemand kann wissen, zu welcher Seite er gehört. Kommunikationszentriert meint die „einverständliche Annahme einer kommunizierten Initiative", dass man z.B. dem Menschensohn im Dienst an sozial Randständigen dient. So kann eine (schwache) Gruppenidentität herausgebildet werden. (Ggs. zu kommunikationszentriert ist identitätszentriert.)
Das Himmelreich wird dualistisch dargestellt (vgl. Mt 13+25: Gleichnis vom Sämann, Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, Gleichnis vom Senfkorn, Gleichnis vom Sauerteig, Gleichnisse vom Schatz und von der Perle, Gleichnis vom Fischnetz, Gleichnis von den zehn Jungfrauen, Gleichnis vom anvertrauten Geld, Vom Weltgericht.). Es geht nicht um den Zeitpunkt des Anbruchs, sondern um den Widerspruch zwischen der Herrschaft Satans (12,26) und der Herrschaft Gottes: Mit dem matthäischen Gerichtsgedanken ist das Gericht über die Christen gemeint, in welchem aufgedeckt werden wird, wer innerhalb der Gemeinde ins Himmelreich und wer zur Hölle berufen ist (13,38.41). Diejenigen, die gesellschaftlichen Randgruppen wie Armen, Kranken, Gefängnisinsassen etc. Liebe widerfahren lassen, gehen ins ewige Leben ein, die anderen aber ins ewige Feuer. Mt kennt stark den Gedanken des Lohns: Handelt man sichtlich durch Innerlichkeit und Nächsten-/Feindesliebe, erhält man seinen Lohn beim Vater. Auch verlangt Mt Vergebungsbereitschaft als Bedingungen für das Heil (6,14; 18,23ff). Bei Mt tritt an die Stelle eines militanten Messias ein friedfertiger König, der nur durch seine Gebote die Welt beherrschen will.
Es entsteht das Bild des Allherrschers, das auch Jesus aufnimmt: „Der Himmel ist sein Thron, die Erde der Schemel seiner Füße, Jerusalem aber die Stadt des großen Königs.“ (5,34f.) „Der Auferstandene ist der Weltregent und der Modus seiner Regentschaft ist die Weltmission durch die von seiner ständigen Präsenz geprägte Jüngerschaft.❝8 Die Parusieverzögerung wird als Problem thematisiert (25,1-13). Die Zeit Jesu begründet die Gegenwart des Heils und lässt sie gleichzeitig beginnen: Johannes der Täufer verkündigt die nahe Herrschaft der Himmel (3,2), ebenso wie Jesus (4,17) und wie dessen Jünger (10,7). Nach 4,23-25 hat Jesus „das Evangelium von der Herrschaft“ verkündigt und viele Krankheiten geheilt. „Der Evangelist zeigt, daß mit Jesu Predigt die bis in die Gegenwart andauernde Verkündigung des Evangeliums begann, dessen Thema „die Herrschaft“ ist (vgl. 13,19.52). Nach 24,14 ist die weltweite Predigt [...] ein (dem, Ende' vorausgehender) Teil des Vollzugs der Endereignisse."
Das Lukasevangelium (Lk) kann wie folgt gegliedert werden: I. Prolog 1,1-1,4 II. Vorgeschichte (Kindheitsgeschichte) 1,5-2,52 III. Vorbereitung der Wirksamkeit Jesu 3,1-4,13 IV. Jesu Wirksamkeit in Galiläa 4,14-9,50 V. Unterwegs nach Jerusalem 9,51-19,27 VI. Jesus in Jerusalem 19,28-24,53 Bei Lk hat Jesu Weg nach Jerusalem eine besondere Betonung (auch in der Apg). Jerusalem ist die Stadt der Auseinandersetzungen und des Leidens. Zumal Lk hier keine Route wiedergibt oder einen Reisebericht liefert. Vielmehr ist die Zeit erfüllt, nach Jerusalem zu wandern: Lk schildert den Weg Jesu nach Jerusalem, eine Zeit der Vorbereitung auf das Leiden. Jesus bereitete auch seinen Jüngerkreis auf das Leiden vor. „Vieles, was Lukas besonders am Herzen liegt, kann man in diesem Abschnitt finden. In den anderen Teilen finden wir eine ähnliche Anordnung der apostolischen Überlieferung wie bei Markus und Matthäus. "12
Lk kann als Historiker mit theologischen Absichten verstanden werden (vgl. Lk 1,4): Die heilsgeschichtliche Ablösung Israels ist Realität. Lk ersetzt semitische Begriffe durch griechische. Lk lässt Mk-Perikopen und evtl. Q-Texte aus, in denen palästinische Züge dominieren. Er gebraucht aber konsequent die LXX. Lk war wohl ein Heidenchrist, der in Kontakt mit der Diasporasynagoge lebte und in sein Werk bewusst judenchristliche Traditionen integrierte. Empfänger des LkEv ist wohl mehrheitlich die heidenchristliche Gemeinde. Lk setzt die gesetzesfreie Heidenmission voraus (Apg 10; 28,28). Der Inhalt des LkEv erweckt den Eindruck, dass der Adressat bzw. die Adressaten Heidenchristen waren (vgl. Lk 1,3). Die Adressierung ist mit dem Auftrag verbunden, das Evangelium zu verbreiten.
Lk wählt für sein Ev das Erzählmodell der „Erfolgsgeschichte“ 13. Wie der eine Typus der dualistischen Erzählungen sind Erfolgsgeschichten identitätszentriert: Erfolgsgeschichten sind an der Identität der jeweiligen Gruppe orientiert. Erfolgsgeschichten: 1. Darstellung einer negativen Ausgangssituation 2. Erzählung der Überwindung dieser negativen Ausgangssituation 3. Darstellung der gewendeten negativen Ausgangssituation Die negative Ausgangssituation betrifft die Situation der Juden im Römischen Reich. Die Hoffnungen der Juden werden nun erfüllt. Und diese Erfüllung wird bei Lk (und auch in der Apg) so dargestellt, dass sie sich auf Jesus von Nazareth und die Kirche beziehen lassen. „Denn das lukanische Doppelwerk entfaltet den göttlich geplanten und in den heiligen Schriften der Juden prophetisch vorausgesagten Weg von einem provinziellen Winkel in das Zentrum der durch soziale Schichtung bestimmten Gesellschaft und so den Siegeszug des Evangeliums im Glauben der Heiden (Apg 28,28). "14 Bspw. ist nach Lk Jesus auferstanden, weil es in den Schriften so vorausgesagt wurde (Schrifterfüllung) (Lk 24,44-49).
Auch die Juden können durch Christus erlöst werden, vorausgesetzt sie erkennen ihn an. Als ein besonderes Merkmal im LkEv ist der „Universalismus“ zu nennen. Lk' Ev ist das Evangelium für die ganze Welt. Christus wird als Erlöser der ganzen Welt dargestellt (2,10f.), als der Armenfreund und Sünderheiland. Dies zeigt sich bspw.: in der Botschaft der Engel, die allen Menschen gilt (2,14) in der Verheißung des Simeons, dass Jesus den Heiden zum Licht gesetzt ist (2,32) in 3,4-6 zitiert Lk ausführlich die Ankündigung Johannes des Täufers aus Jesaja 40,3-5 im Bericht über Jesu Rechtfertigung in Nazareth, in der er zwei nicht Israeliten als Beispiel erwähnt (4,25-27). 15 Nach dem Bericht von Lukas hat sich Jesus schon früh als Messias bekannt (Lk 4,21). Er wird von Anfang an als Kyrios (Herr) bezeichnet und angeredet (Lk 5,8; 7,13; 10,1.41; 22,61).15 Lk spricht vom „leidenden Messias“, nur bei ihm sagte Jesus seinen heilsgeschichtlich verankerten „Tod als Prophet“ voraus (13,33). Lk bindet das Heil des Menschen an Jesu ganzes Leben und Auferstehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Himmelherrschaft, die Parusie, die Parusieverzögerung, die Gemeinde, die Heilsgeschichte, die jüdische Tradition, die heidenchristliche Gemeinde, die Universalität des Evangeliums, der leidende Messias, die Erfolgsgeschichte, die dualistische Erzählung, die Zeit Jesu, die Zeit der Gemeinde Christi, der Heilige Geist, die Schrifterfüllung, die messianischen Weissagungen, die Thora, die Goldene Regel, das Doppelgebot der Liebe, die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, die Feindesliebe, die Vergebungsbereitschaft, die Wachsamkeit, die Geduld, die Weltmission, die Jüngerschaft, die Gegenwart des Heils, die Zukunft des Reiches Gottes, die Geschichte Israels, die Zeit der Propheten, die Zeit zwischen Himmelfahrt und Parusie.
- Quote paper
- M.A. Jessica Schumacher (Author), 2007, Reich Gottes bei Matthäus und Lukas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279931