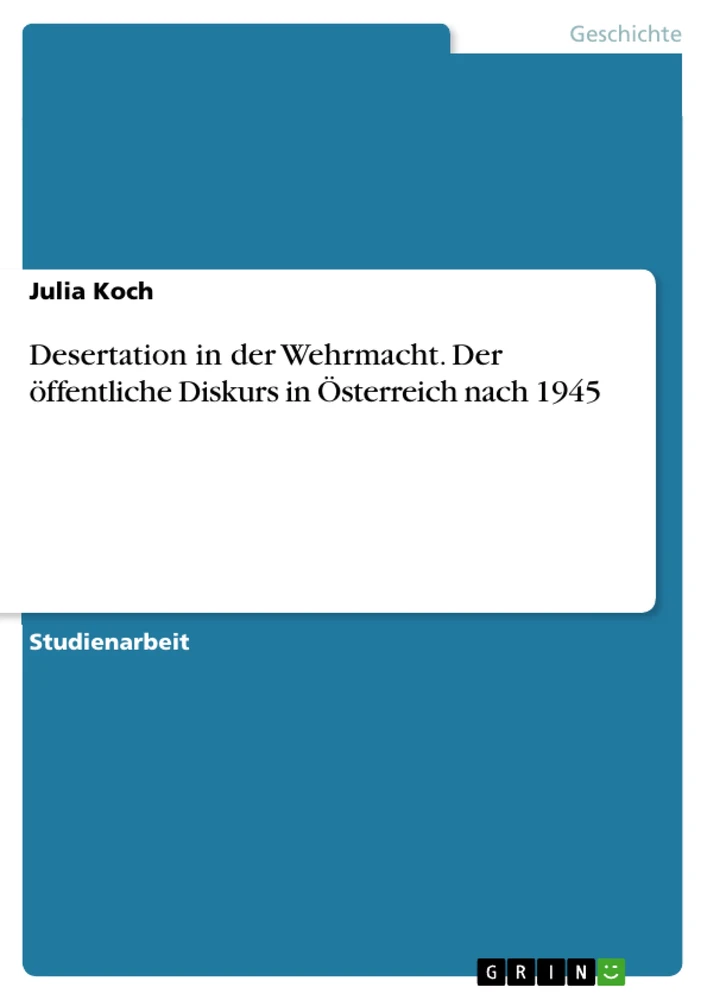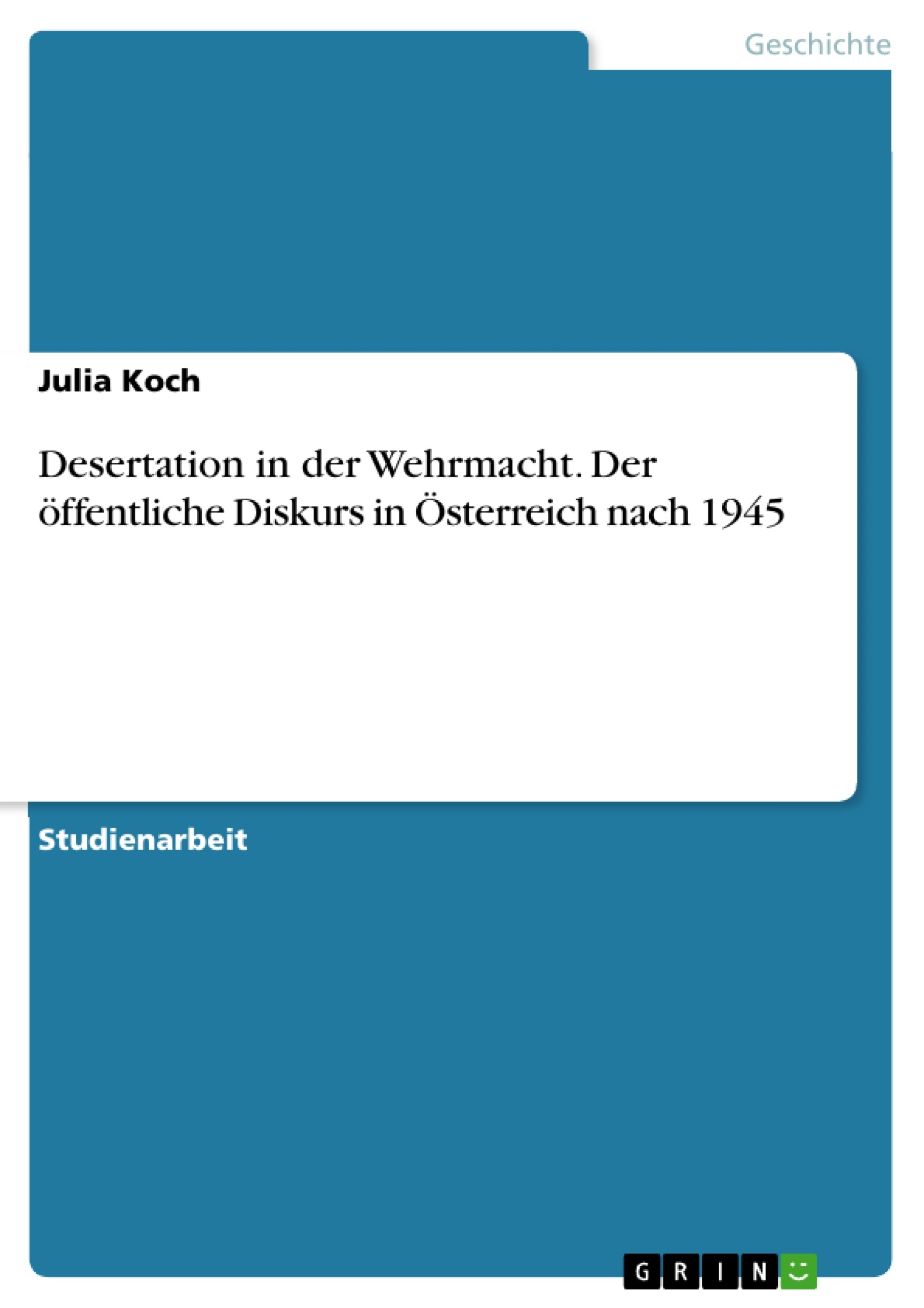Der Umgang der Republik Österreich mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit ist immer wieder Thema kontroverser Diskussionen. Basierend auf der Moskauer-Deklaration, in der Österreich von den Alliierten zum ersten Opfer des nationalsozialistischen Deutschland erklärt wurde, entstand in der Zweiten Republik ein Geschichtsbild, welches die gesamte Verantwortung für den Nationalsozialismus auf Deutschland projizierte. Dieses Bild beeinflusste über Jahrzehnte hinweg die Selbstdarstellung Österreichs im Ausland. Verschiedene Affären um ehemalige Nationalsozialisten in hohen Ämtern im Nachkriegsösterreich, besonders aber die Kontroverse um die Vergangenheit des Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl 1986, Kurt Waldheim, führten dazu, dass Österreichs Mitwirken im Nationalsozialismus zu einem vieldiskutierten Thema in der internationalen Presse wurde. Die öffentliche Kontroverse um Österreichs Vergangenheit wurde zur Zäsur der österreichischen Zeitgeschichtsforschung, die lange Zeit die Opfer-These mitgetragen hatte. Mit der Erklärung des damaligen Bundeskanzlers Franz Vranitzky vor dem Nationalrat, am 8. Juli 1991, wurde die „moralische Mitverantwortung“ Österreichs auch offiziell ausgesprochen. Die Verdrängung von Österreichs nationalsozialistischer Vergangenheit, die „Geschichte der Stunde-Null-Generation“, konnte auch im öffentlichen Bewusstsein nicht länger aufrecht erhalten werden.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist aufgrund dieser Vorgeschichte differenziert zu jener Deutschlands zu betrachten, jenem Staat, der die Verantwortung für den Nationalsozialismus übernahm. Die Diskussion um die Deserteure der Wehrmacht war in den vergangenen Jahren in beiden Staaten medial präsent. In Österreich beherrscht die aktuelle Kontroverse um ein Deserteurs-Denkmal die politische wie mediale Auseinandersetzung. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Aufarbeitung und dem öffentlichen Diskurs in Österreich. Sie untersucht den Zusammenhang zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Geschichtsbild, das in Österreichs Gesellschaft lange Zeit vorherrschte und auch heute noch zu finden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Desertion in der Wehrmacht
- Der Umgang mit den Deserteuren nach 1945
- Opferrolle und Widerstand
- Erinnerung an Helden
- Wende in der Zeitgeschichtsforschung
- Rehabilitation der Deserteure
- Entschließungsantrag der Grünen
- Initiativantrag und Personenkomitee
- Die Befreiungsamnestie von 1946
- Das Anerkennungsgesetz 2005
- Das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz 2009
- Deserteursdenkmal
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aufarbeitung der Desertion in der Wehrmacht und den öffentlichen Diskurs darüber in Österreich. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen dieser Aufarbeitung, der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs und dem lange Zeit vorherrschenden Geschichtsbild. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der öffentlichen Meinung und der politischen Maßnahmen bezüglich der Deserteure.
- Die Rolle der Desertion im Kontext des Nationalsozialismus
- Die juristische Behandlung von Deserteuren während und nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Entwicklung des öffentlichen Diskurses über Deserteure in Österreich
- Der Einfluss des Opfermythos auf die Aufarbeitung der Vergangenheit
- Die Bedeutung von Gedenk- und Rehabilitationsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die kontroversen Diskussionen um Österreichs Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und die lange Zeit vorherrschende Opferrolle. Sie hebt die Bedeutung der Kurt Waldheim-Affäre und die damit verbundene Zäsur in der österreichischen Zeitgeschichtsforschung hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Aufarbeitung der Desertion in der Wehrmacht und deren Einbettung in den österreichischen Kontext.
Desertion in der Wehrmacht: Dieses Kapitel beschreibt die nationalsozialistische Ideologie und deren Einfluss auf die Militärjustiz. Es analysiert die Verschärfung der Militärstrafgesetzgebung nach 1933, insbesondere die Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) und die Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO). Der Fokus liegt auf dem Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien und der willkürlichen Anwendung von Todesstrafen, die als Instrument des Regimes dienten. Die hohe Zahl der hingerichteten Wehrmachtangehörigen, darunter viele Österreicher, wird hervorgehoben.
Der Umgang mit den Deserteuren nach 1945: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Auseinandersetzung mit der Rolle Österreichs im Dritten Reich und die veränderte Sichtweise auf Deserteure. Es geht auf die Moskauer Deklaration ein, welche die Opferrolle Österreichs betonte und die eigene Mitverantwortung verharmloste. Die weiteren Unterkapitel befassen sich mit den verschiedenen Phasen der Rehabilitation und der öffentlichen Diskussion um die Deserteure, inklusive der Rolle von Gedenkinitiativen.
Schlüsselwörter
Deserteure, Wehrmacht, Österreich, Nationalsozialismus, Opfermythos, Zeitgeschichte, Militärjustiz, Rehabilitation, öffentlicher Diskurs, Erinnerungskultur, Gedenkpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Aufarbeitung der Desertion in der Wehrmacht in Österreich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Aufarbeitung der Desertion in der Wehrmacht und den öffentlichen Diskurs darüber in Österreich. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen dieser Aufarbeitung, der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs und dem lange Zeit vorherrschenden Geschichtsbild. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der öffentlichen Meinung und der politischen Maßnahmen bezüglich der Deserteure.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Desertion im Kontext des Nationalsozialismus, die juristische Behandlung von Deserteuren während und nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung des öffentlichen Diskurses über Deserteure in Österreich, den Einfluss des Opfermythos auf die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Bedeutung von Gedenk- und Rehabilitationsmaßnahmen. Es werden auch die verschiedenen Phasen der Rehabilitation und die Rolle von Gedenkinitiativen beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die Desertion in der Wehrmacht, ein Kapitel über den Umgang mit Deserteuren nach 1945 (inklusive Unterkapiteln zu Opferrolle, Erinnerung, der Wende in der Geschichtsforschung und der Rehabilitation mit konkreten Beispielen wie dem Entschließungsantrag der Grünen, dem Anerkennungsgesetz 2005 und dem Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz 2009), und ein Fazit.
Wie wird die Desertion in der Wehrmacht dargestellt?
Das Kapitel zur Desertion beschreibt die nationalsozialistische Ideologie und deren Einfluss auf die Militärjustiz. Es analysiert die Verschärfung der Militärstrafgesetzgebung nach 1933, insbesondere die KSSVO und die KStVO, und den Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien. Die willkürliche Anwendung von Todesstrafen und die hohe Zahl der hingerichteten Wehrmachtangehörigen, darunter viele Österreicher, werden hervorgehoben.
Wie wird der Umgang mit Deserteuren nach 1945 beschrieben?
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Auseinandersetzung mit der Rolle Österreichs im Dritten Reich und die veränderte Sichtweise auf Deserteure. Es thematisiert die Moskauer Deklaration und die damit verbundene Betonung der Opferrolle Österreichs. Die verschiedenen Phasen der Rehabilitation und die öffentliche Diskussion werden detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielt der Opfermythos?
Der Opfermythos und sein Einfluss auf die Aufarbeitung der Vergangenheit werden ausführlich analysiert. Die Arbeit zeigt, wie dieser Mythos die Auseinandersetzung mit der eigenen Mitverantwortung beeinflusst hat.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Deserteure, Wehrmacht, Österreich, Nationalsozialismus, Opfermythos, Zeitgeschichte, Militärjustiz, Rehabilitation, öffentlicher Diskurs, Erinnerungskultur und Gedenkpolitik.
Welche Bedeutung hat die Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die kontroversen Diskussionen um Österreichs Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und die lange Zeit vorherrschende Opferrolle. Sie hebt die Bedeutung der Kurt Waldheim-Affäre und die damit verbundene Zäsur in der österreichischen Zeitgeschichtsforschung hervor und führt in das Thema der Aufarbeitung der Desertion ein.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im bereitgestellten Text nicht explizit aufgeführt und müsste aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
- Quote paper
- Julia Koch (Author), 2012, Desertation in der Wehrmacht. Der öffentliche Diskurs in Österreich nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279849