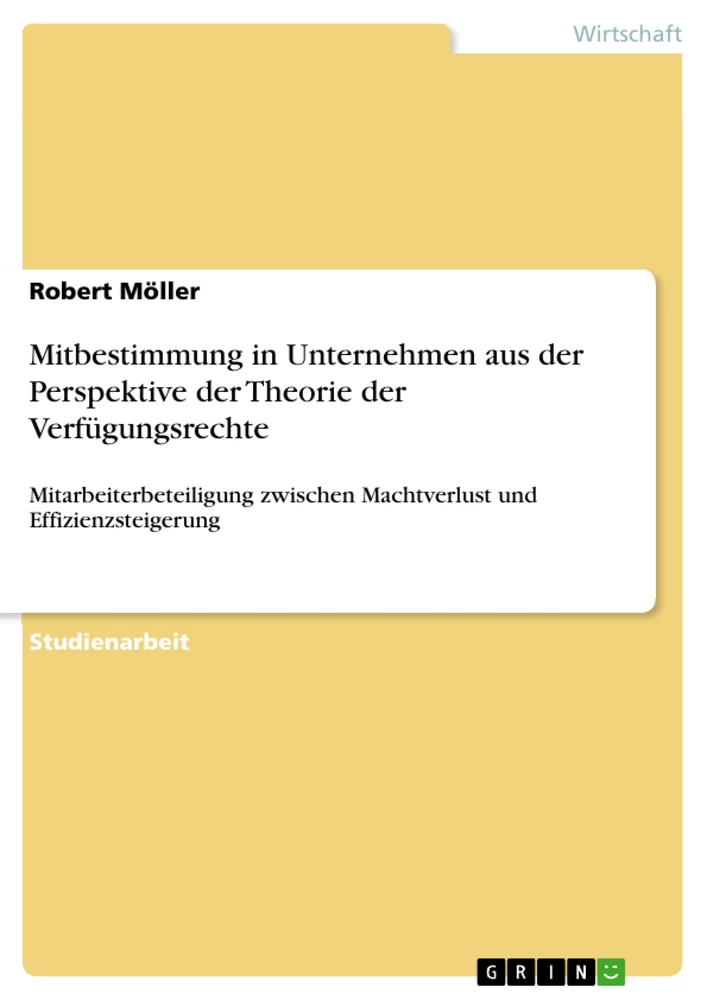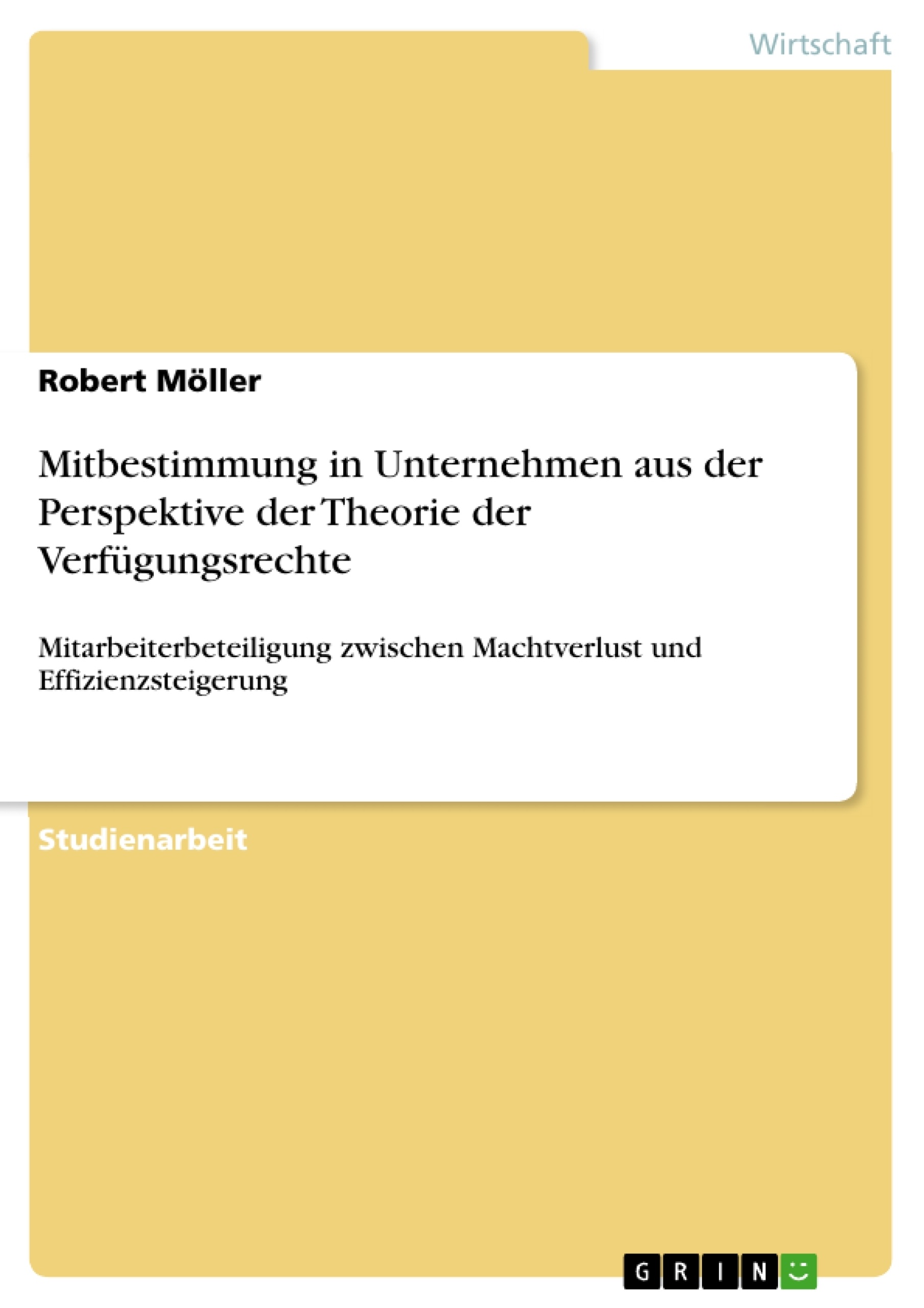Der Arbeitsplatz stellt für einen Beschäftigten sowohl aus ökonomischer wie auch aus sozialer Sicht einen wichtigen Lebensbereich dar. Veränderungen in diesem Umfeld wirken sich oftmals auf die Lebensführung des Angestellten aus. Da sich der Mitarbeiter über diesen Umstand im Klaren ist, sucht er nach Möglichkeiten, sich an diesen Entscheidungen zu beteiligen. Der Unternehmer andererseits wird durch eine derartige Mitbestimmung teilweise von der freien Unternehmensleitung abgehalten, wodurch er nicht mehr ausschließlich auf die Marktbedürfnisse reagieren kann, sondern auch die Mitbestimmungsrechte seiner Angestellten berücksichtigen muss.
Aufgrund dieser Überlegungen stellt sich die Frage, ob Mitbestimmung im Unternehmen zu Effizienzverlusten führt, oder ob vielleicht doch die positiven Effekte, wie sie durch verbesserte Kommunikation, den Abbau von Informationsasymmetrien oder verringertes Konfliktpotential entstehen, gegenüber der „Verlangsamung und Verteuerung betrieblicher Prozesse“ (Hinderlich 2007) überwiegen. Die empirischen Befunde sind hier, trotz einer Vielzahl entsprechender Studien, grundsätzlich widersprüchlich. Des Weiteren beziehen sich die Studien im Einzelnen auf unterschiedliche positive Effekte und Beteiligungssysteme. Eine eindeutige Aussage zur Wirkung von Mitarbeiterbeteiligung lässt sich, innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses, bis heute nicht treffen.
Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, die Mitbestimmung in Unternehmen aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik, hier insbesondere aus dem Blickwinkel der Verfügungsrechtetheorie zu betrachten, um so einen theoretischen Ansatz zur Beantwortung der Frage zu finden, ob Mitarbeiterbeteiligung eher einen unternehmerischem Machtverlust, oder eine ökonomische Effizienzsteigerung bewirkt. Dazu wird zunächst die Theorie der Verfügungsrechte, als eine Teiltheorie der Neuen Institutionenökonomik, vorgestellt und erläutert werden. Im Anschluss daran erfolgt eine kurze Darstellung über Mitbestimmung in Wirtschaftssystemen, damit in der Folge die Zusammenführung aus Mitarbeiterbeteiligung und Verfügungsrechtetheorie erfolgen kann. Dabei soll auch auf die Unterscheidung zwischen freiwilliger und rechtlich bindender Mitbestimmung geachtet werden, da die verpflichtende Beteiligung im deutschen Wirtschaftsraum einen großen Anteil mitbestimmter Unternehmensstrukturen ausmacht, worauf jedoch noch gesondert eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Theoriengebäude der Neuen Institutionenökonomik
- Theorie der Verfügungsrechte
- Mitbestimmung in Wirtschaftssystemen
- Mitbestimmung in Unternehmen aus Sicht der Verfügungsrechtetheorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mitbestimmung in Unternehmen aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik, insbesondere der Verfügungsrechtetheorie. Ziel ist es, einen theoretischen Ansatz zu finden, um die Auswirkungen von Mitarbeiterbeteiligung auf unternehmerischen Machtverlust und ökonomische Effizienzsteigerung zu bewerten.
- Theorie der Verfügungsrechte als Teil der Neuen Institutionenökonomik
- Mitbestimmung in verschiedenen Wirtschaftssystemen
- Auswirkungen von Mitarbeiterbeteiligung auf unternehmerische Macht und Effizienz
- Unterscheidung zwischen freiwilliger und rechtlich bindender Mitbestimmung
- Bewertung widersprüchlicher empirischer Befunde zur Mitarbeiterbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Mitbestimmung in Unternehmen anhand des Zitats von John Naisbitt. Sie hebt die Bedeutung des Arbeitsplatzes für Beschäftigte hervor und thematisiert den Konflikt zwischen unternehmerischer Freiheit und den Mitbestimmungsrechten der Angestellten. Die Einleitung führt die widersprüchlichen empirischen Befunde zur Wirkung von Mitarbeiterbeteiligung an und formuliert das Ziel der Arbeit: die Betrachtung der Mitbestimmung aus der Perspektive der Verfügungsrechtetheorie, um die Auswirkungen auf Macht und Effizienz zu analysieren. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau, der die Vorstellung der Verfügungsrechtetheorie, eine kurze Darstellung der Mitbestimmung in Wirtschaftssystemen und schließlich die Zusammenführung beider Aspekte beinhaltet.
2. Das Theoriengebäude der Neuen Institutionenökonomik: Dieses Kapitel bettet die Verfügungsrechtetheorie in die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) ein. Es beschreibt die NIÖ als Organisationstheorie, die die Struktur, Verhaltenswirkungen, Effizienz und den Wandel ökonomischer Institutionen analysiert. Im Gegensatz zur Neoklassik berücksichtigt die NIÖ Informationsasymmetrien, Marktunvollkommenheiten, beschränkte Rationalität und Reibungsverluste. Während beide Theorien von der Nutzenmaximierung der Akteure ausgehen, beachtet die NIÖ den Einfluss von Verträgen, Gesetzen und Normen auf deren Handlungen. Das Kapitel nennt drei zentrale Ansätze der NIÖ: die Agenturkostentheorie, die Transaktionskostentheorie und die Verfügungsrechtetheorie, wobei der Fokus auf letztere gerichtet wird.
3. Theorie der Verfügungsrechte: Dieses Kapitel erläutert die Verfügungsrechtetheorie, die sich mit Eigentums- und Nutzungsrechten befasst und deren Auswirkungen auf das Verhalten wirtschaftlicher Akteure untersucht. Es beschreibt vier Arten von Verfügungsrechten: ius usus (Nutzungsrecht), ius abusus (Recht der Veränderung), ius usus fructus (Recht auf Nutzungserträge) und ius successionis (Recht der Weitergabe). Der Wert eines Gutes wird nicht nur durch seinen physischen Wert, sondern auch durch das Bündel an Verfügungsrechten bestimmt. Der Handel einer Ressource ist nur sinnvoll, wenn auch die damit verbundenen Verfügungsrechte übertragen werden. Das Kapitel beschreibt die zentrale Grundannahme der Verfügungsrechtetheorie von Furubotn/Pejovich (1972) bezüglich der Interaktion ökonomischer Akteure.
Schlüsselwörter
Mitbestimmung, Verfügungsrechtetheorie, Neue Institutionenökonomik, Mitarbeiterbeteiligung, Effizienz, Macht, Wirtschaftssysteme, unternehmerische Entscheidungen, Informationsasymmetrien.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Mitbestimmung in Unternehmen aus Sicht der Verfügungsrechtetheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Mitbestimmung in Unternehmen aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ), insbesondere der Verfügungsrechtetheorie. Sie analysiert die Auswirkungen von Mitarbeiterbeteiligung auf unternehmerischen Machtverlust und ökonomische Effizienzsteigerung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Theorie der Verfügungsrechte im Kontext der NIÖ, Mitbestimmung in verschiedenen Wirtschaftssystemen, die Auswirkungen von Mitarbeiterbeteiligung auf Macht und Effizienz, die Unterscheidung zwischen freiwilliger und rechtlich bindender Mitbestimmung und die Bewertung widersprüchlicher empirischer Befunde zur Mitarbeiterbeteiligung.
Welche Theorien bilden die Grundlage der Arbeit?
Die Arbeit basiert auf der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ) und konzentriert sich insbesondere auf die Verfügungsrechtetheorie. Die NIÖ wird als Organisationstheorie vorgestellt, die im Gegensatz zur Neoklassik Informationsasymmetrien, Marktunvollkommenheiten und beschränkte Rationalität berücksichtigt. Die Verfügungsrechtetheorie wird detailliert erläutert, einschließlich der vier Arten von Verfügungsrechten (ius usus, ius abusus, ius usus fructus, ius successionis).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Neuen Institutionenökonomik, ein Kapitel zur Verfügungsrechtetheorie, ein Kapitel zur Mitbestimmung in Wirtschaftssystemen, ein Kapitel zur Mitbestimmung in Unternehmen aus Sicht der Verfügungsrechtetheorie und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Kapitel entwickeln die theoretischen Grundlagen und wenden diese auf die Fragestellung an.
Welche Ergebnisse werden angestrebt?
Das Ziel der Arbeit ist es, einen theoretischen Ansatz zu finden, um die Auswirkungen von Mitarbeiterbeteiligung auf unternehmerischen Machtverlust und ökonomische Effizienzsteigerung zu bewerten. Die Arbeit analysiert widersprüchliche empirische Befunde und versucht, diese im Lichte der Verfügungsrechtetheorie zu interpretieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mitbestimmung, Verfügungsrechtetheorie, Neue Institutionenökonomik, Mitarbeiterbeteiligung, Effizienz, Macht, Wirtschaftssysteme, unternehmerische Entscheidungen, Informationsasymmetrien.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Inhalt jedes Kapitels detailliert. Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Mitbestimmung, das Kapitel zur NIÖ beschreibt deren Grundlagen, das Kapitel zur Verfügungsrechtetheorie erläutert die verschiedenen Arten von Verfügungsrechten und deren Bedeutung.
- Quote paper
- Master of Arts Robert Möller (Author), 2012, Mitbestimmung in Unternehmen aus der Perspektive der Theorie der Verfügungsrechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279796