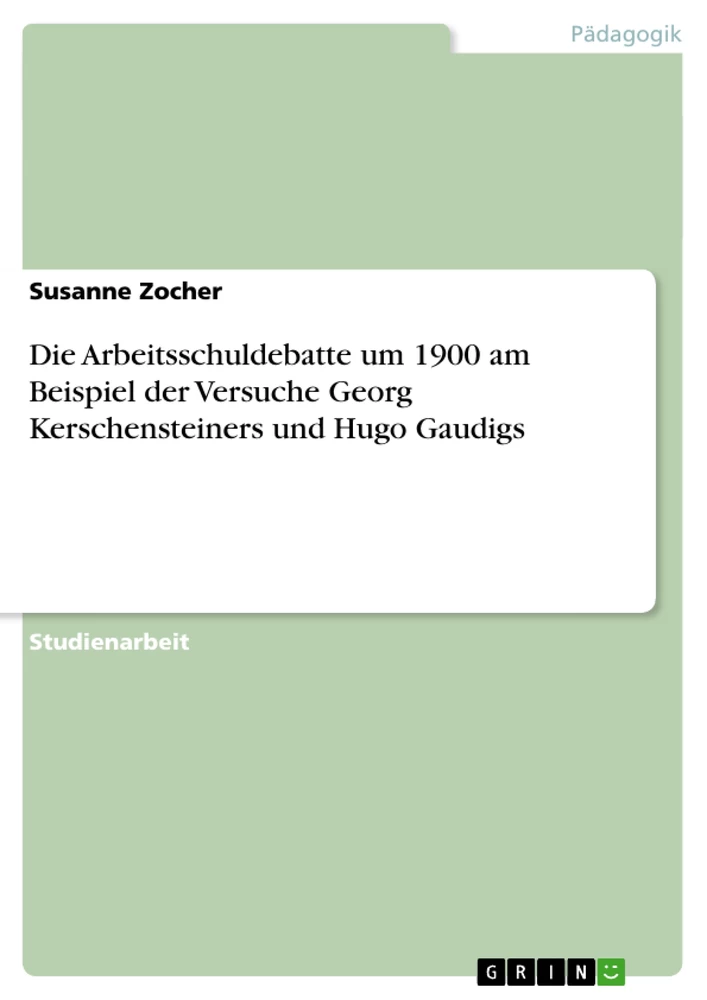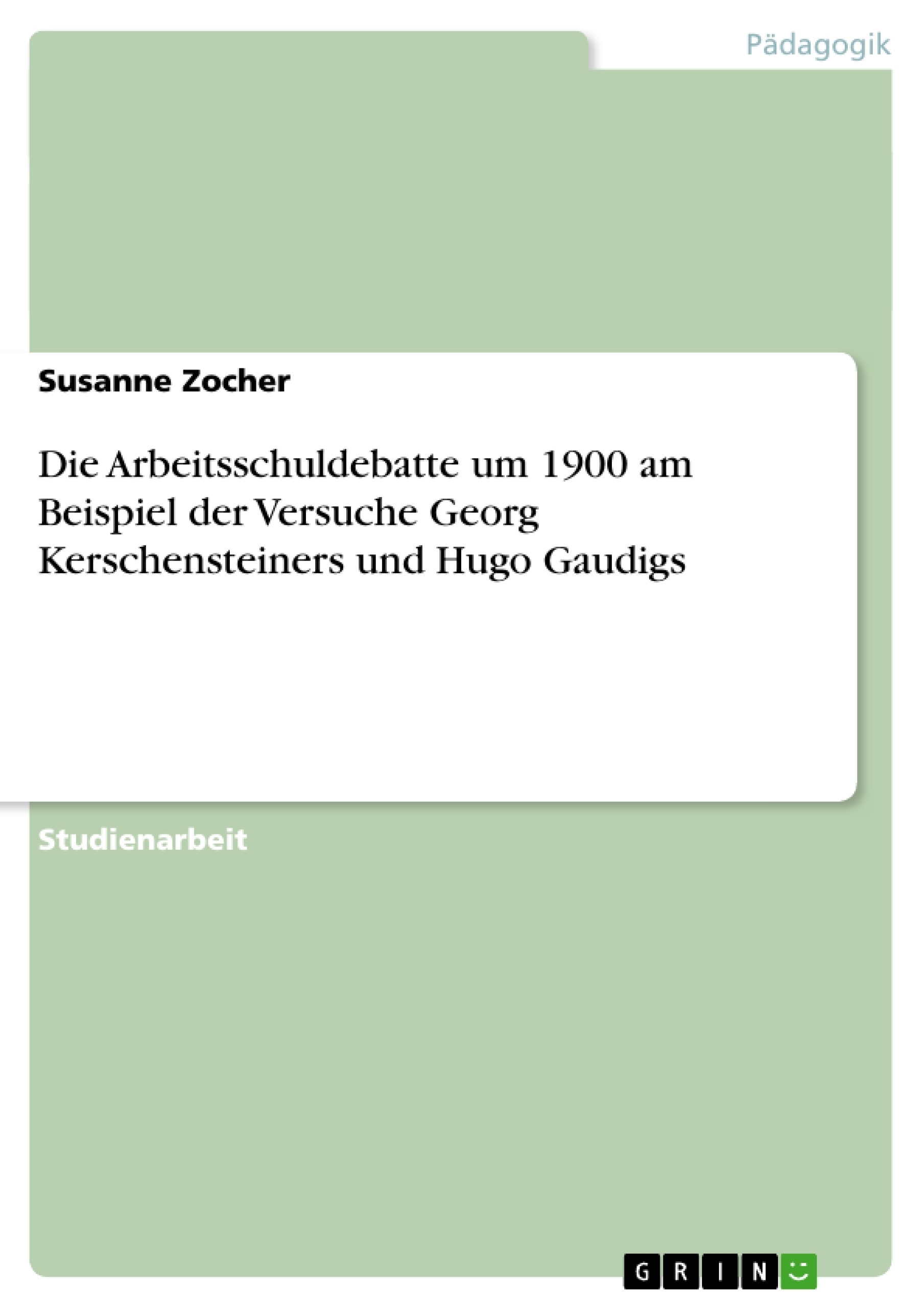Die Arbeitsschule war einer der ersten reformpädagogischen Entwürfe zu Beginn bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu den bedeutendsten Vertretern dieser Reformschule ist der damalige Münchner Stadtschulrat Georg Kerschensteiner zu nennen. Er wollte bereits 1902 eine fachliche Fortbildungsschule, die in Gewerbe unterteilt war und auf den späteren Beruf vorbereiten sollte. Diese Ziele sollten in der Arbeitsschule verwirklicht werden. „In ihr sollten ‚mit einem Minimum von Wissensstoff ein Maximum von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Arbeitsfreude im Dienste staatsbürgerlicher Gesinnung‘ vermittelt werden.“
Doch mit welchen Mitteln setzte Kerschensteiner diese Vorstellungen in die Tat um? Wie unterschieden sich seine neuen Methoden gegenüber denen davor üblichen und gab es auch noch andere Pädagogen, die ein solches oder ähnliches Konzept erstellten? Wenn ja, wie sahen deren Vorstellungen aus? Diese und noch weitere Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit geklärt werden.
Der erste Teil wird sich mit den geschichtlichen Hintergründen der Arbeitsschule befassen. Dabei soll geklärt werden, wie die Situation der Schulen war, bevor die ersten reformpädagogischen Schritte gemacht wurden und wie sich die Umwandlung vollzogen hat.
Der zweite Teil und gleichzeitig auch der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit den beiden Pädagogen Georg Kerschensteiner und Hugo Gaudig. Beide haben eine Form der Arbeitsschule entworfen, die näher beleuchtet werden soll. Danach wird es noch einen kurzen Vergleich beider Entwürfe geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die geschichtlichen Hintergründe der Arbeitsschule
- Die Arbeitsschule nach Georg Kerschensteiner
- Die Grundvorstellungen
- Die praktische Umsetzung
- Allgemeines
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Arbeitsschule im frühen 20. Jahrhundert. Ziel ist es, die historischen Hintergründe dieser reformpädagogischen Bewegung zu beleuchten und die Konzepte von Georg Kerschensteiner und Hugo Gaudig im Detail zu analysieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verbindung von Theorie und Praxis in der Arbeitsschule.
- Die historischen Wurzeln der Arbeitsschule
- Das Konzept der Arbeitsschule nach Georg Kerschensteiner
- Der Vergleich der Konzepte von Georg Kerschensteiner und Hugo Gaudig
- Die Bedeutung der Arbeitsschule für die Entwicklung der modernen Pädagogik
- Die Relevanz der Arbeitsschule im Kontext der heutigen Bildungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die geschichtlichen Hintergründe der Arbeitsschule und setzt sie in den Kontext der damaligen Bildungslandschaft. Es wird die Situation der Schulen vor der Einführung reformpädagogischer Ideen beschrieben und die Herausforderungen, die zu ihrer Entstehung führten, dargelegt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept der Arbeitsschule nach Georg Kerschensteiner. Es werden seine Grundvorstellungen zu Erziehung, Bildung und Staatsbürgerschaft erläutert. Die praktische Umsetzung seiner Ideen, insbesondere die Bedeutung der Handarbeit und die Förderung der Selbstständigkeit, werden im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Arbeitsschule, Reformpädagogik, Georg Kerschensteiner, Hugo Gaudig, Handarbeit, Selbstständigkeit, Staatsbürgerschaft, Bildung, Erziehung, Geschichte der Pädagogik.
- Quote paper
- Susanne Zocher (Author), 2010, Die Arbeitsschuldebatte um 1900 am Beispiel der Versuche Georg Kerschensteiners und Hugo Gaudigs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279642