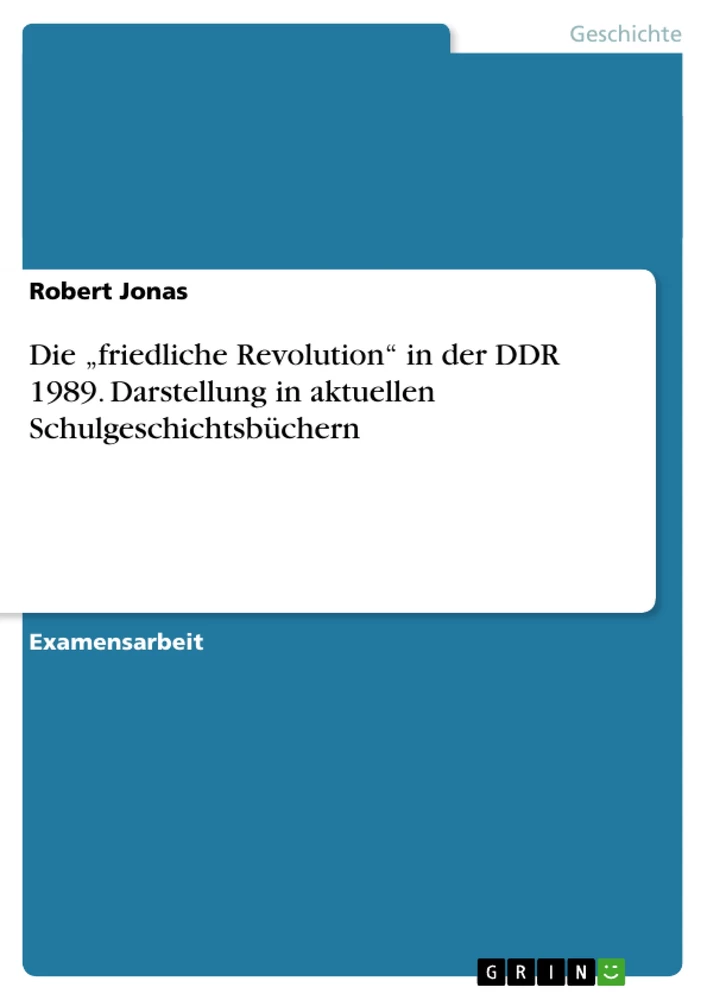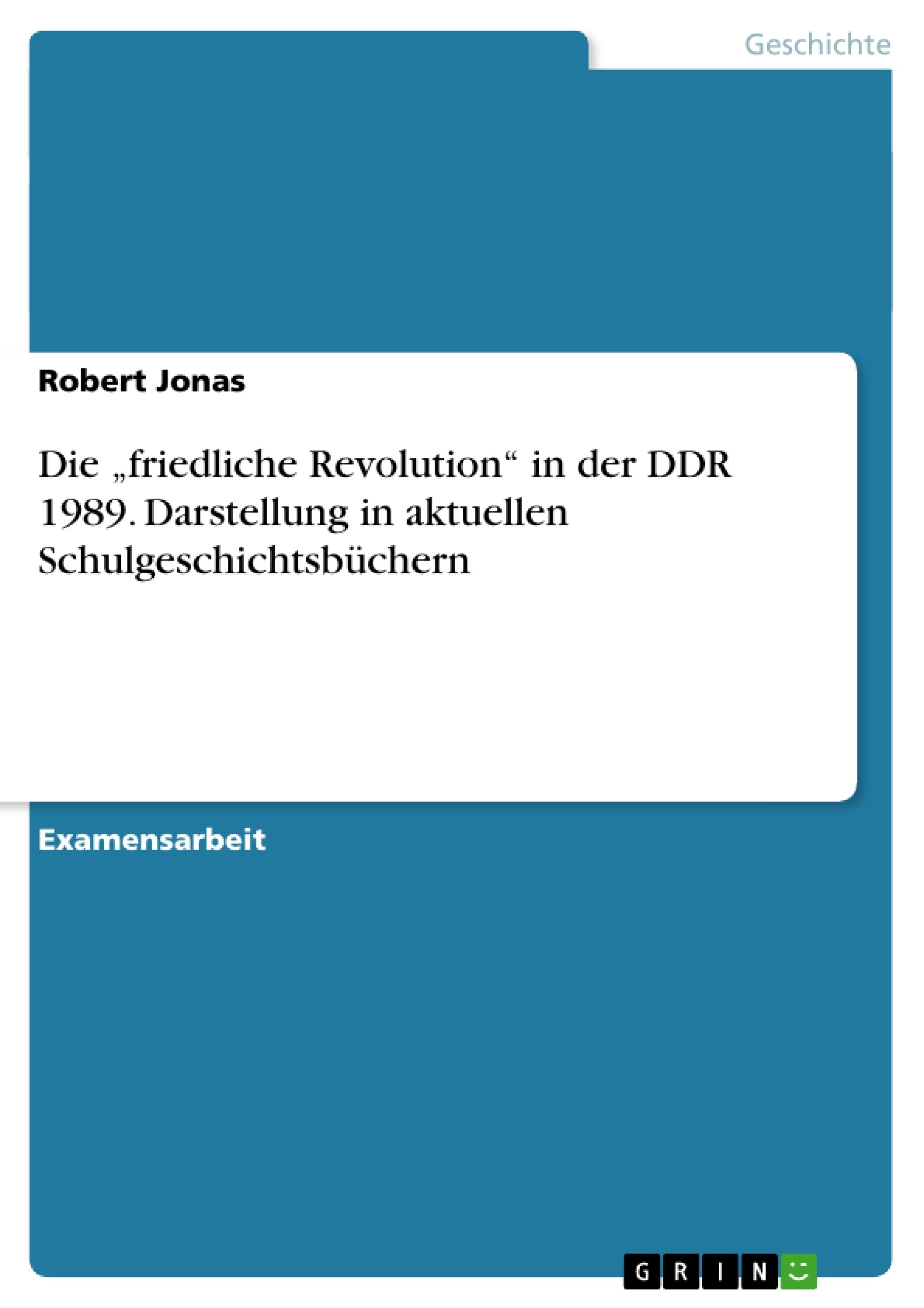In einem historischen Kontext betrachtet schloss sich mit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik als Folgewirkung des Endes des Ost-West-Konfliktes und dem Fall der Mauer das Kapitel der „deutschen Frage“ nach den Grenzen und der territorialen Ordnung Deutschlands an. Diese zog sich spätestens seit der Revolution 1848/49 wie ein roter Faden durch die deutsche Geschichte. Mit der „Einheit in Freiheit“ sind nach Ansicht des Historikers ANDREAS RÖDDER für das vereinigte Deutschland nach den „katastrophalen Umwegen“ die „Hoffnungen des 19. Jahrhunderts“ schließlich doch noch in Erfüllung gegangen. In der historischen Fachwissenschaft und der breiten Öffentlichkeit wird dem Volk der ehemaligen DDR zugutegehalten, für diesen „Glücksfall“ der deutschen Geschichte gesorgt zu haben, in dem es im Herbst 1989 nach 40 Jahren der Bevormundung und Gängelung den aufrechten Gang gelernt und in einer „friedlichen Revolution“ seine unterdrückerischen Machthaber abgeschüttelt habe. Seitdem wird “mit ‚1989‘ Geschichtspolitik betrieben“. In großen Teilen der Gesellschaft scheint Konsens darüber zu herrschen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, der sich dem Streben aller Deutschen nach Freiheit und Demokratie in den Weg stellte und dessen Ende nur gerecht war. Historische Darstellungen über die DDR scheinen von einer voreingenommenen Perspektive zugunsten demokratisch-marktwirtschaftlicher Verhältnisse geprägt zu sein und den Zweck zu verfolgen, das SED-Regime als „Unrechtsstaat“ zu bewerten anstatt seine politische Ziele zu analysieren. Dies kann umgekehrt jedoch nicht bedeuten, dass alles, was über die DDR und ihre Geschichte geschrieben worden ist, außerhalb jeder Kritik steht.
Diese Arbeit geht von der These aus, dass, insofern Schulbuchinhalte durch Lehrplanvorgaben politisch-administrativ legitimiert sind und „im Spannungsfeld politischer und gesellschaftlicher Interessen“ stehen, die Analyse schulbuchförmigen Wissens auch als Analyse gesellschaftlich und zeitlich vorherrschenden Wissens gesehen werden kann. Davon ausgehend soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob und inwiefern die Darstellungen des Zusammenbruchs der DDR 1989 in vier aktuellen Schulgeschichtsbüchern gesellschaftliche Ideologien und politische Tendenzen widerspiegeln und vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Ende der DDR im fachwissenschaftlichen Diskurs
- Darstellung
- Kontroversen
- Externe Faktoren
- Interne Faktoren
- Systemimmanente Faktoren
- Gesellschaftliche Faktoren
- Ökonomische Faktoren
- Das Schulgeschichtsbuch
- Das Schulgeschichtsbuch im Spannungsfeld divergierender Ansprüche
- Verschiedene Typen von Schulgeschichtsbüchern
- Funktionen des Schulgeschichtsbuches
- Kriterien des „idealen“ Schulgeschichtsbuchs
- Brauchbarkeit für die Unterrichtspraxis
- Brauchbarkeit für den Erwerb narrativer Kompetenz
- Brauchbarkeit für die historische Wahrnehmung
- Brauchbarkeit für die historische Deutung
- Brauchbarkeit für die historische Orientierung
- Das Schulgeschichtsbuch in der Praxis
- Das Schulgeschichtsbuch als Politikum
- Schulbuchanalyse
- Allgemeine Beschreibung der untersuchten Schulgeschichtsbücher
- Analyse der Darstellungen
- Methodische Vorbemerkungen
- Die Charakterisierung der Ereignisse
- Die Ausgangslage
- Die Kommunalwahlen
- Die Flüchtlingswelle
- Die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR
- Die Demonstrationen, der Rücktritt der Regierung und der Mauerfall
- Analyse ausgewählten Quellenmaterials und der Arbeitsaufträge
- Fachdidaktische Maßgaben an Quellenmaterial und Arbeitsaufträge
- Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung der „friedlichen Revolution“ in der DDR 1989 in aktuellen Schulgeschichtsbüchern. Ziel ist es, zu untersuchen, inwiefern diese Darstellungen gesellschaftliche Ideologien und politische Tendenzen widerspiegeln und vermitteln.
- Die Rolle von Schulgeschichtsbüchern bei der Vermittlung historischer Ereignisse
- Die Darstellung der „friedlichen Revolution“ in der DDR 1989 in aktuellen Schulgeschichtsbüchern
- Die Analyse von Quellenmaterial und Arbeitsaufträgen in Schulgeschichtsbüchern
- Die Einbettung der „friedlichen Revolution“ in den historischen Kontext
- Die Analyse von gesellschaftlichen Ideologien und politischen Tendenzen in Schulgeschichtsbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Kapitel 2 beleuchtet den fachwissenschaftlichen Diskurs über das Ende der DDR, wobei sowohl Darstellungen als auch Kontroversen analysiert werden. Kapitel 3 widmet sich dem Schulgeschichtsbuch und seinen Funktionen, Kriterien und der Praxis. In Kapitel 4 wird eine Schulbuchanalyse durchgeführt, bei der die Darstellungen der „friedlichen Revolution“ in ausgewählten Schulgeschichtsbüchern untersucht werden. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: „friedliche Revolution“, DDR, Schulgeschichtsbuch, Darstellungsformen, Quellenmaterial, Arbeitsaufträge, gesellschaftliche Ideologien, politische Tendenzen, historische Kontext, fachdidaktische Analyse.
- Citation du texte
- Robert Jonas (Auteur), 2013, Die „friedliche Revolution“ in der DDR 1989. Darstellung in aktuellen Schulgeschichtsbüchern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279632