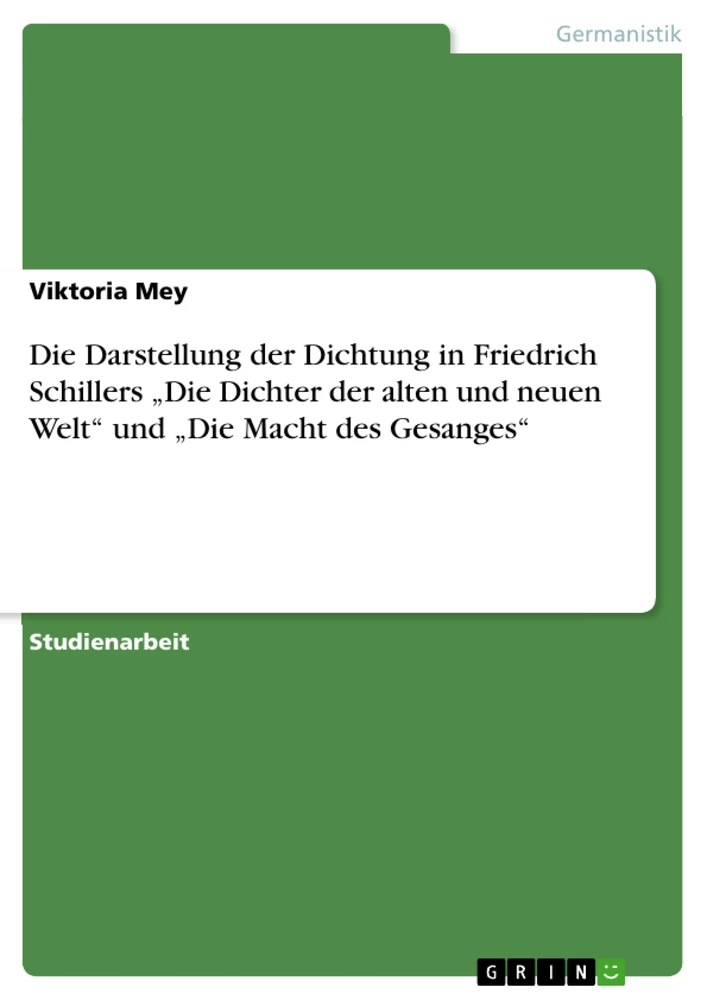Schiller pflegt ein besonders positives, nahezu passioniertes Verhältnis zur lyrischen Dichtkunst. Er lässt ihr zahlreiche Funktionen und Wirkungen bezüglich des menschlichen Lebens zukommen und verehrt sie damit nicht nur als eine Form der Kunst, sondern als einen Bestandteil des Lebens. Deutlich wird dies unter anderem in einem Zitat Schillers: „Was Erfahrung und Vernunft an Schätzen für die Menschheit aufhäuften, müßte Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Anmut sich kleiden in ihrer schöpferischen Hand. Die Sitten, den Charakter, die ganze Weisheit ihrer Zeit müßte sie, geläutert und veredelt, in ihrem Spiegel sammeln und mit idealisierender Kunst aus dem Jahrhundert selbst ein Muster für das Jahrhundert erschaffen. Dies aber setzte voraus, daß sie selbst in keine andre als reife und gebildete Hände fiele.“ Aus dem Zitat geht jedoch deutlich hervor, dass er für diesen Prozess einen Leser voraussetzt, der die Lyrik zu schätzen und mit ihr umzugehen weiß. Diesen bezeichnet er als „legens doctus“.
Schiller forderte jedoch nicht nur vom die Dichtung rezipierenden Leser ein Verständnis für Lyrik, sondern stellte auch an den Dichter selbst hohe Anforderungen. So beschrieb er den idealen Dichter als „Poeta doctus“, also einen „gebildeten Geist“, welcher sowohl bezüglich des Intellekts auch im Bezug auf die Sittlichkeit mit dem Leser gleichgestellt ist.
Schillers Dichtung ist bestimmt vom lyrischen Erbe seiner Vorgänger. Hierbei lässt er sich von einer Mischung aus barockem Pathos, Sturm und Drang, aufgeklärtem 18. Jahrhundert sowie der Antike beeinflussen. An dieser Stelle lassen sich zahlreiche Vorbilder des Lyrikers Schiller nennen. Beispielhaft hierfür stehen Petrarca und sein Canzoniere, die Lyriker des Barock - primär Opitz und Gryphius, die Lyriker der Aufklärung - insbesondere von Kleist, von Haller, Gellert und Uz sowie die Lyriker der antiken Tradition - vor allem Ovid, Vergil, Horaz, Martial, Klopstock, Schubart, Ossian und Bürger.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schiller und seine Lyrik
- Schiller und die lyrische Tradition
- Schillers lyrischer Stil
- Einordnung der Gedichte „Die Dichter der alten und neuen Welt“ und „Die Macht des Gesanges\" in eine Epoche
- Darstellung der Dichtung in den ausgewählten Werken Schillers
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung von Dichtung in den Werken Friedrich Schillers, insbesondere in seinen Gedichten „Die Dichter der alten und neuen Welt“ und „Die Macht des Gesanges“. Ziel ist es, Schillers Ansichten über die Dichtung, seine Utopie der Antike und seine Verzweiflung über die Entwicklung der Dichtung zu untersuchen.
- Schillers Auffassung von der Lyrik und ihre Rolle im menschlichen Leben
- Die Bedeutung der lyrischen Tradition für Schillers Werk
- Die Einordnung der Gedichte in eine bestimmte Epoche
- Schillers Schreibstil und seine Verwendung von Bildern und Metaphern
- Die Rolle des „legens doctus“ und des „Poeta doctus“ in Schillers Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Motivation für die Untersuchung. Kapitel 2 beleuchtet Schillers Verhältnis zur lyrischen Tradition und seine Ansichten über den idealen Dichter und Leser. Kapitel 3 betrachtet die Einordnung der ausgewählten Gedichte in eine bestimmte Epoche. Kapitel 4 analysiert die Darstellung der Dichtung in den ausgewählten Werken Schillers.
Schlüsselwörter
Lyrik, Friedrich Schiller, Dichtung, „Die Dichter der alten und neuen Welt“, „Die Macht des Gesanges“, lyrische Tradition, „legens doctus“, „Poeta doctus“, Klassik, Barock, Aufklärung, Antike, Petrarca, Canzoniere, Emblematik, Metaphern, Bilder, Schreibstil
- Quote paper
- Viktoria Mey (Author), 2012, Die Darstellung der Dichtung in Friedrich Schillers „Die Dichter der alten und neuen Welt“ und „Die Macht des Gesanges“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279598