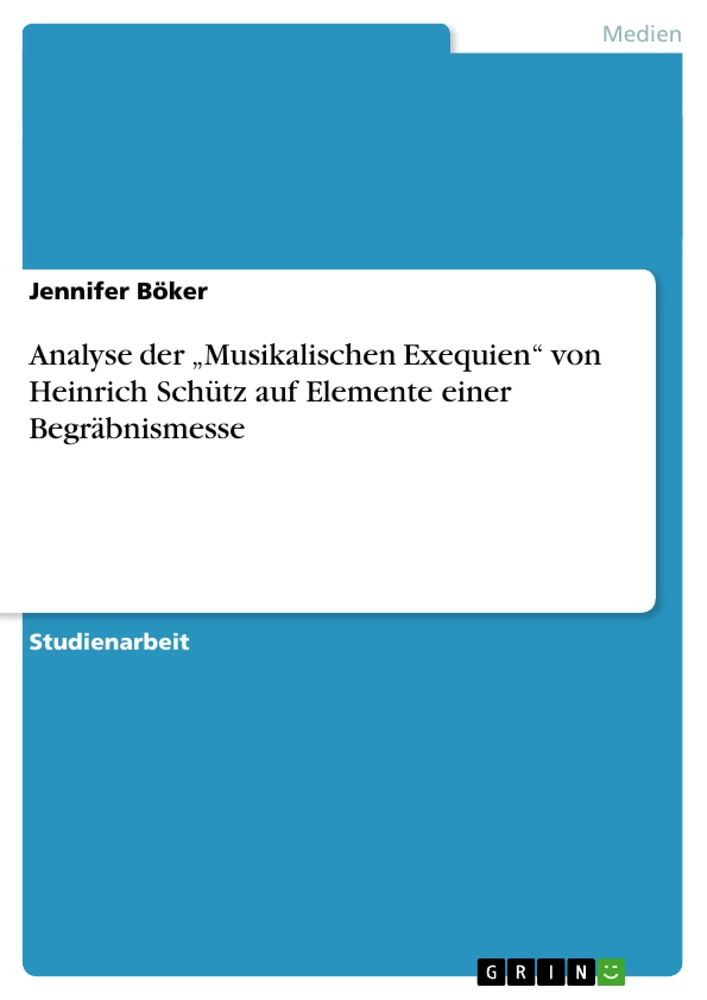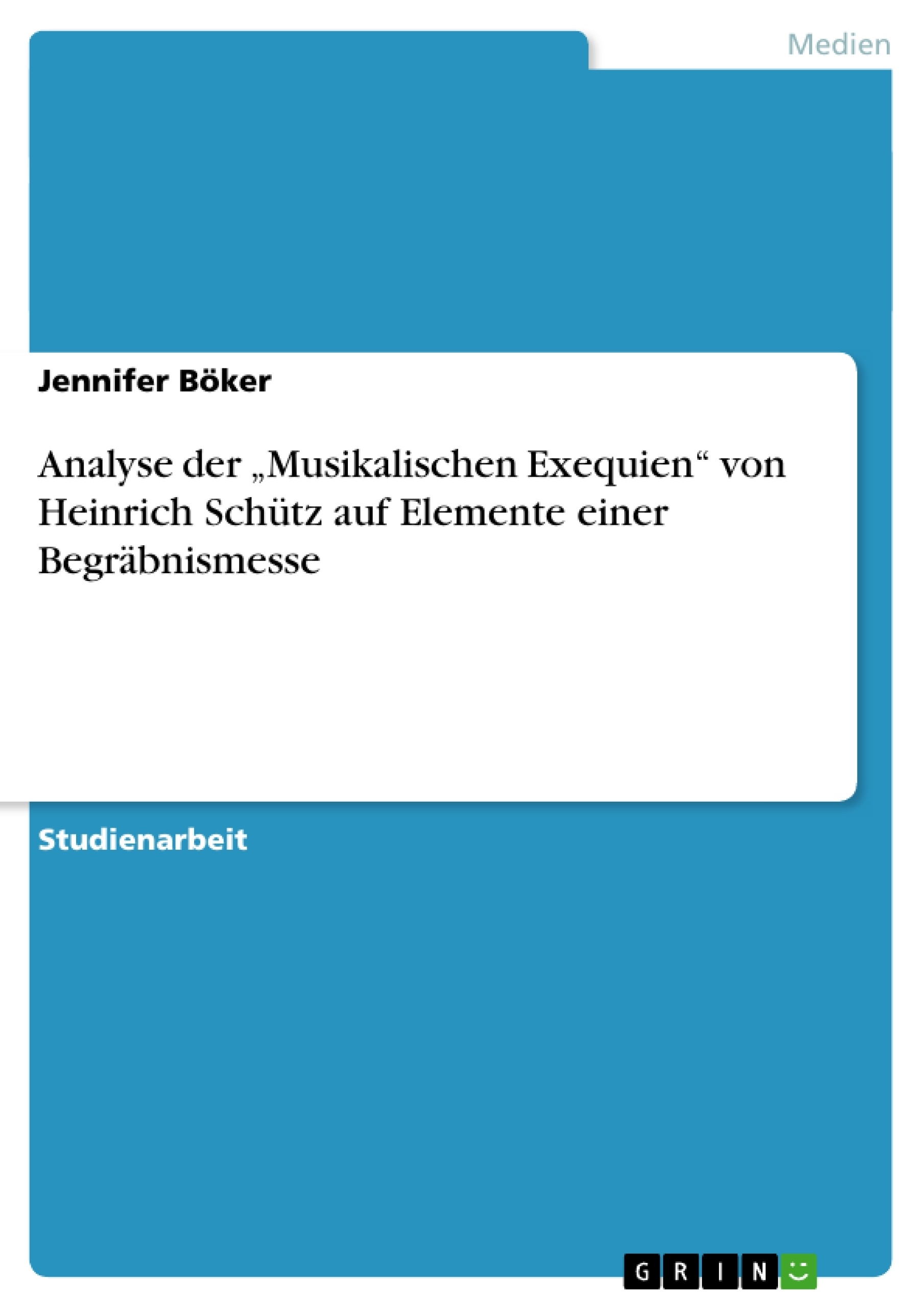Die „Musikalische(n) Exequien“ sind eine Kompositionsreihe von Heinrich Schütz, die von ihm anlässlich des Todes Heinrich Posthumus von Reuß komponiert wurde. Die Komposition besteht aus drei Teilen, wobei der erste eine Teutsche Begräbnismissa, der zweite eine Motette und der dritte das Nunc dimittis als Doppelchor mit „Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach.“ ist. Diese drei Teile bilden das Gesamtwerk, könnten aber wie Schütz selbst sagt: „In diesem Musicalischen Wercklein (…) nur dreyerley Stücke oder Concert zu befinden“ auch als drei eigenständige Werke betrachtet werden. Mit Schütz' Bezeichnung „Teutsche Begräbnismissa“ beziehungsweise „Deutsche Begräbnismesse“ werde ich mich im Anschluss beschäftigen und mit der Frage, ob dies begründet geschehen ist oder ob die Bezeichnung als falsch zu bewerten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Entstehungsgeschichte der „Musikalische(n) Exequien“
- Schütz Hintergründe, die zur Komposition beigetragen haben.
- Der Tod Reuß und die erste Aufführung der Exequien........
- Bezeichnung als Begräbnismesse......
- Bibliographie
- Anhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die „Musikalischen Exequien“ von Heinrich Schütz auf Elemente einer Begräbnismesse. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte des Werkes im Kontext des Todes von Heinrich Posthumus von Reuß und beleuchtet die Verwendung von Bibeltexten und Kirchenliedstrophen in der Komposition. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Bezeichnung „Teutsche Begräbnismissa“ gerechtfertigt ist und welche Elemente der Komposition auf eine Begräbnismesse hindeuten.
- Entstehungsgeschichte der „Musikalischen Exequien“ im Kontext des Todes von Heinrich Posthumus von Reuß
- Verwendung von Bibeltexten und Kirchenliedstrophen in der Komposition
- Analyse der musikalischen Elemente der „Musikalischen Exequien“ im Hinblick auf eine Begräbnismesse
- Bedeutung der „Musikalischen Exequien“ als Ausdruck der Trauerkultur des 17. Jahrhunderts
- Schütz' Komposition im Kontext der musikalischen Entwicklung des Barock
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit befasst sich mit der Entstehungsgeschichte der „Musikalischen Exequien“. Es wird die Rolle von Heinrich Posthumus von Reuß als Auftraggeber und die Bedeutung seiner Todesvorbereitungen für die Komposition beleuchtet. Die Verwendung von Bibeltexten und Kirchenliedstrophen in der Komposition wird untersucht und in den Kontext der damaligen Trauerkultur eingeordnet. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung der „Musikalischen Exequien“ als Ausdruck der Trauerkultur des 17. Jahrhunderts.
Das zweite Kapitel analysiert die musikalischen Elemente der „Musikalischen Exequien“ im Hinblick auf eine Begräbnismesse. Es wird untersucht, ob die Bezeichnung „Teutsche Begräbnismissa“ gerechtfertigt ist und welche Elemente der Komposition auf eine Begräbnismesse hindeuten. Die Arbeit beleuchtet die Verwendung von Kyrie und Gloria in der Komposition und setzt diese in Bezug zu den traditionellen Bestandteilen einer Begräbnismesse.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Musikalischen Exequien“, Heinrich Schütz, Heinrich Posthumus von Reuß, Begräbnismesse, Trauerkultur, Bibeltexte, Kirchenliedstrophen, Barockmusik, musikalische Analyse, Kyrie, Gloria, Teutsche Begräbnismissa.
- Quote paper
- Jennifer Böker (Author), 2012, Analyse der „Musikalischen Exequien“ von Heinrich Schütz auf Elemente einer Begräbnismesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279101