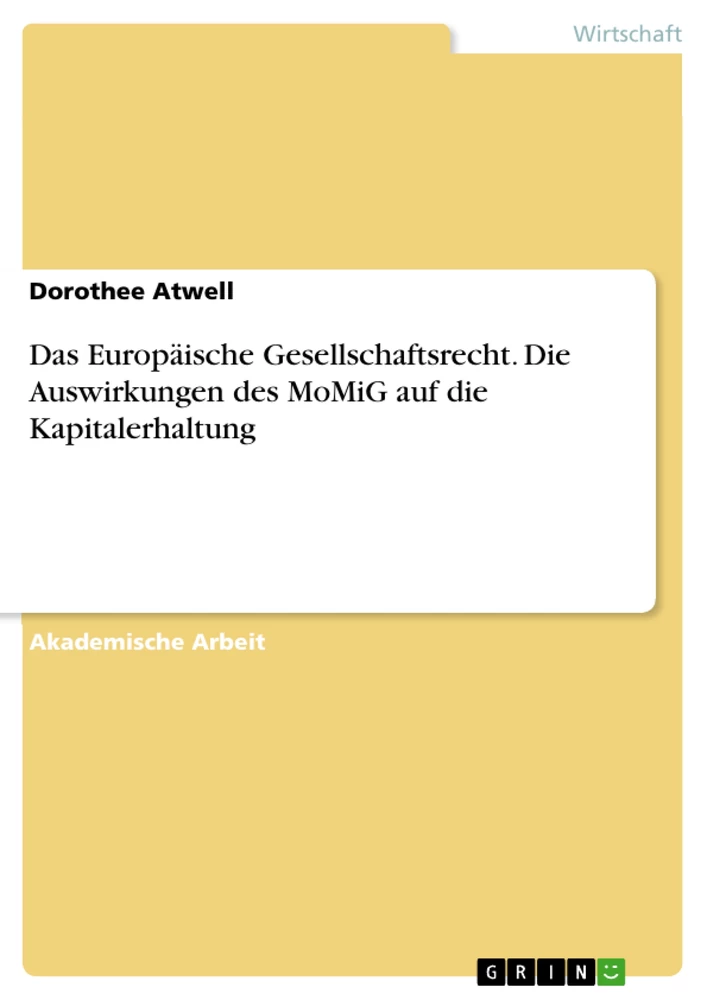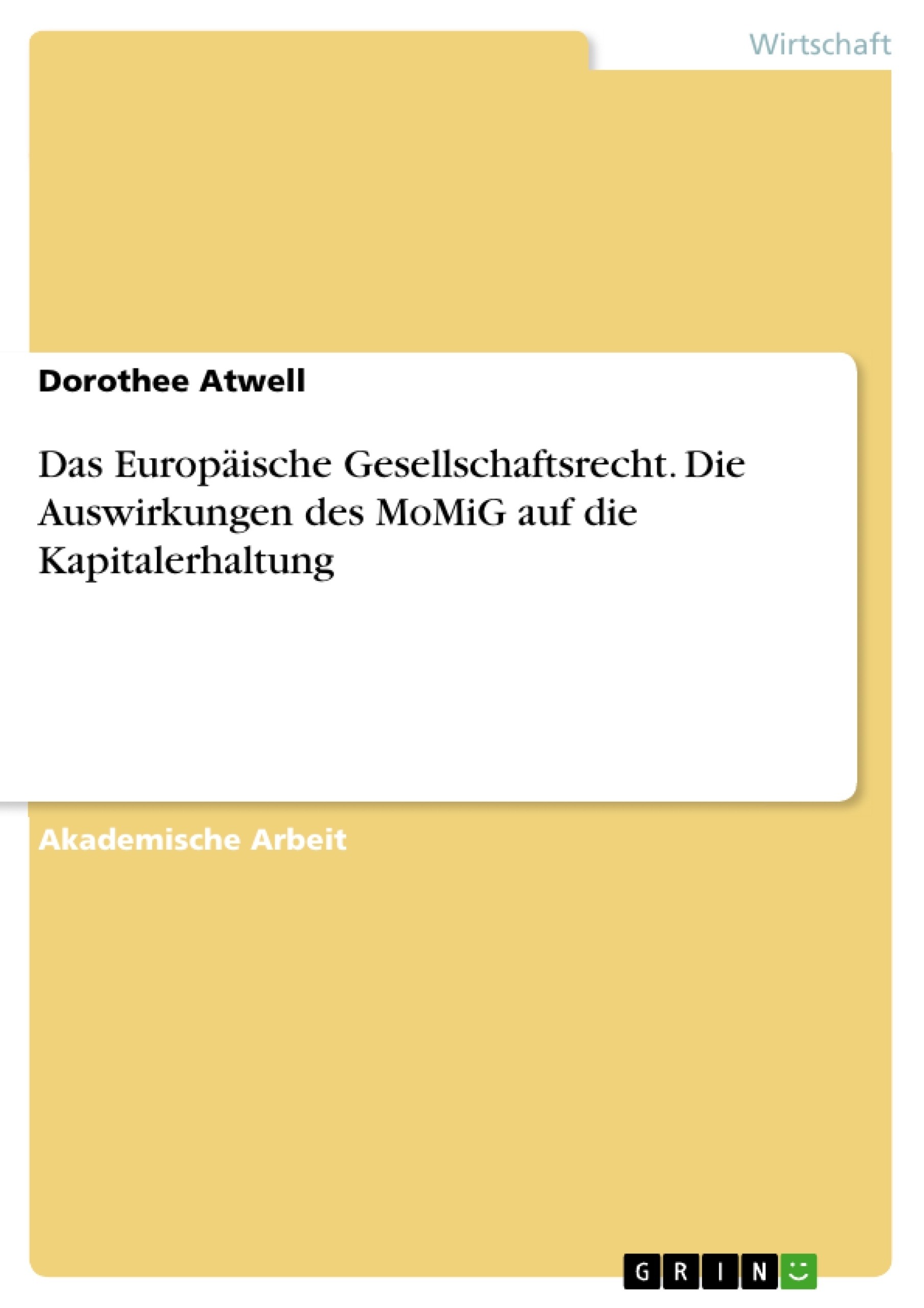Der im deutschen GmbH-Recht verankerte Kapitalschutz ist das „Kernstück des GmbH-Rechts“ und wird weiterhin als „Kulturleistung ersten Ranges“ angesehen.
Durch die Einführung eines Stammkapitals, welches im Handelsregister eingetragen ist – sei es in Höhe des Mindeststammkapitals oder in Höhe eines von den Gesellschaftern vereinbarten höheren Betrages – müssen gleichzeitig Regelungen geschaffen werden, die die Aufbringung und vor allem die Erhaltung des eingetragenen Betrages sicherstellen. Dem dienen die Regelungen zum Kapitalschutz. Da die gesetzlichen Bestimmungen lückenhaft sind, hat die Rechtsprechung über die gesetzlichen Regeln hinaus umfangreiche Grundsätze entwickelt, die bei der Aufbringung und Erhaltung des Kapitals zu beachten sind. Diese Grundsätze sind in zahlreichen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs niedergelegt und weisen eine kaum noch überschaubare Komplexität auf, die vielfach zu erheblicher Rechtsunsicherheit führt. Häufig sind KMU die Leidtragenden der sich daraus ergebenden vielfältigen Nachteile, da sie sich über den Stand der Rechtsentwicklung nicht im Klaren sind oder den kostenintensiven fortlaufenden Beratungsaufwand nicht zu leisten vermögen.
Als häufige Folge der komplexen richterrechtlichen Grundsätze werden Bar- oder Sacheinlagen, die bei der Gründung oder einer späteren Kapitalerhöhung geleistet werden, als nicht erbracht angesehen. Eine Heilung dieses Umstands ist fast unmöglich bzw. nur mit großem Aufwand zu leisten. Dies hat wiederum zur Folge, dass bei nicht rechtmäßig erbrachten Bar- oder Sacheinlagen im Falle einer Insolvenz die Verpflichtung entsteht, die Einlagen nochmals zu leisten, obwohl die Einlagen der Gesellschaft wirtschaftlich betrachtet in vollem Umfang zugeflossen sind.
Der Gesetzgeber hat diese Probleme im MoMiG aufgegriffen und versucht, die Kapitalerhaltung zu reformieren, um das GmbH-Recht in diesem Bereich zu vereinfachen und attraktiver zu machen, ohne jedoch den Grundsatz der Kapitalerhaltung anzugreifen oder abzuschwächen. Besonders im Hinblick darauf, dass der Kapitalaufbringung durch das abgesenkte Mindestkapital eine geringere Bedeutung zukommt, muss durch konsequente Regelungen zur Kapitalerhaltung sichergestellt werden, dass das den Gläubigern zur Verfügung stehende Haftungskapital möglichst umfangreich geschützt wird.
Die dazu im MoMiG-Entwurf vorgeschlagenen Änderungen sollen in dieser Arbeit betrachtet und kritisch analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Die Auswirkungen des MoMiG auf die Kapitalerhaltung
- Änderungen im Eigenkapitalersatzrecht
- Sinn und Zweck des Eigenkapitalersatzrechts
- Entwicklung des Eigenkapitalersatzrechts
- Bestehende Rechtslage
- Neuregelungen im Eigenkapitalersatzrecht durch das MoMiG und die Auswirkungen auf die Kapitalerhaltung
- Überblick über die Neuregelungen
- Abschaffung der Rechtsprechungsregeln
- Verlagerung von Regelungen in die Insolvenzordnung
- Nachrangigkeit sämtlicher Darlehensforderungen in der Insolvenz
- Beibehaltung des Kleinbeteiligten- und Sanierungsprivilegs
- Änderungen beim Cash-Pooling
- Entwicklung des Cash-Poolings in der Rechtsprechung
- Reaktionen der Literatur auf die Rechtsprechung
- Grundsätzliche Bedenken
- Darlehensvergabe im Zeitpunkt der Unterbilanz
- Lösungsansatz des MoMiG
- Konsequenzen der Neuregelung für den Grundsatz der Kapitalerhaltung
- Ausstrahlungswirkung der Neuregelung auf die Kapitalaufbringung
- Zusammenfassung: Auswirkungen des MoMiG auf die Kapitalerhaltung
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) auf den Grundsatz der Kapitalerhaltung im deutschen Gesellschaftsrecht. Dabei werden insbesondere die Änderungen im Eigenkapitalersatzrecht und die Neuregelungen zum Cash-Pooling untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe der Gesetzesänderungen, die Auswirkungen auf die Praxis und die Folgen für die Kapitalaufbringung.
- Eigenkapitalersatzrecht
- Cash-Pooling
- Kapitalerhaltung
- Insolvenzrecht
- Gesellschaftsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den Änderungen im Eigenkapitalersatzrecht durch das MoMiG. Es werden die Sinn und Zweck des Eigenkapitalersatzrechts, die Entwicklung des Rechtsgebiets und die bestehende Rechtslage dargestellt. Anschließend werden die Neuregelungen im MoMiG und deren Auswirkungen auf die Kapitalerhaltung analysiert. Dabei werden die Abschaffung der Rechtsprechungsregeln, die Verlagerung von Regelungen in die Insolvenzordnung und die Nachrangigkeit sämtlicher Darlehensforderungen in der Insolvenz beleuchtet. Abschließend wird die Beibehaltung des Kleinbeteiligten- und Sanierungsprivilegs diskutiert.
Das zweite Kapitel behandelt die Änderungen beim Cash-Pooling. Es wird die Entwicklung des Cash-Poolings in der Rechtsprechung und die Reaktionen der Literatur auf die Rechtsprechung dargestellt. Anschließend werden die Lösungsansätze des MoMiG und die Konsequenzen der Neuregelung für den Grundsatz der Kapitalerhaltung analysiert. Abschließend wird die Ausstrahlungswirkung der Neuregelung auf die Kapitalaufbringung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das MoMiG, das Eigenkapitalersatzrecht, das Cash-Pooling, die Kapitalerhaltung, die Insolvenzordnung, das Gesellschaftsrecht und die Kapitalaufbringung. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des MoMiG auf diese Bereiche und beleuchtet die Folgen für die Praxis.
- Arbeit zitieren
- Dorothee Atwell (Autor:in), 2007, Das Europäische Gesellschaftsrecht. Die Auswirkungen des MoMiG auf die Kapitalerhaltung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278984