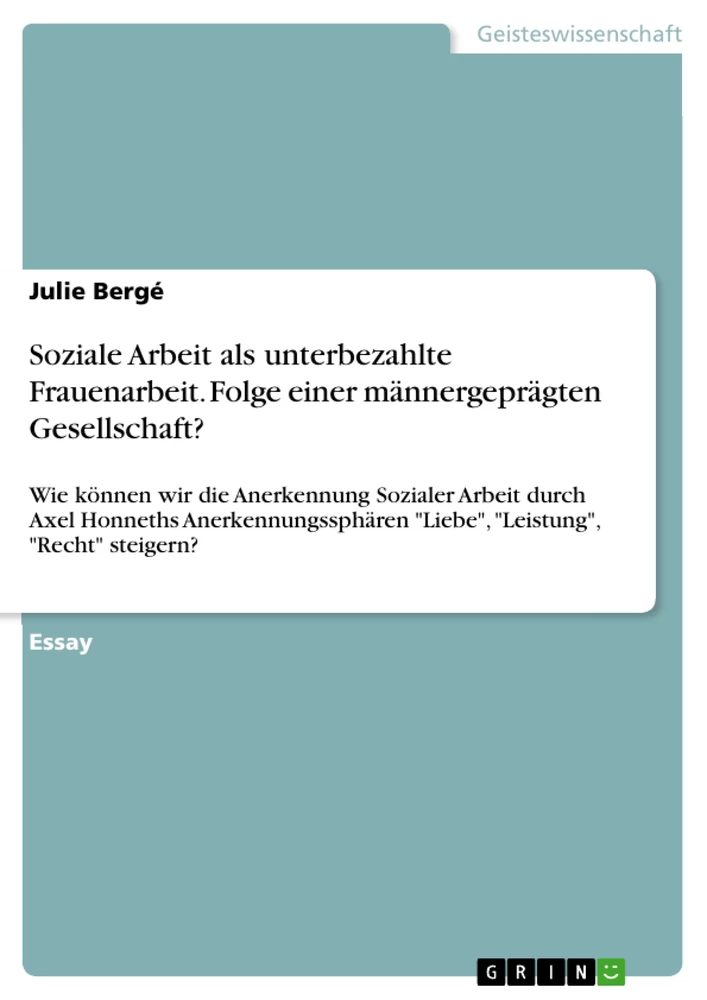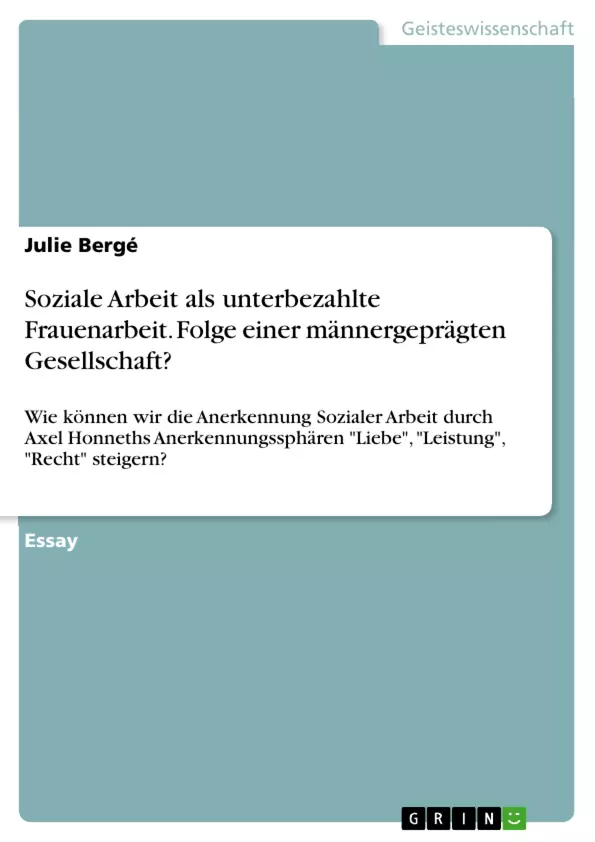„Und dafür muss man studieren?“ Eine Frage, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Großteil der SozialarbeiterInnen im Laufe der eigenen Karriere auseinandersetzen muss. Die Infragestellung der professionellen Identität von SozialarbeiterInnen ist nicht selten auf perpetuierte Rollenbilder zurückzuführen, die Soziale Arbeit als weiblich codierte ‚Semi-Profession‘ abwerten.
Im Zentrum diesen Essays steht die These, dass Soziale Arbeit in einer männerdominierten Gesellschaft auf Grund ihres Berufsstandes als ‚Frauenberuf‘ in ihrer Profession eine Abwertung erfährt.
Ein kurzer Abriss der Entstehungsgeschichte sozialer Arbeit zu Beginn des Essays demonstriert, wie eng die Geschichte der S.A. mit Frauenbewegungen und frühen Emanzipationsbestrebungen verknüpft ist und wie sie sich zunehmends zu einem ‚weiblich dominierten‘ Berufsfeld entwickelt hat. Eine generelle Subordination der Frau bzw. weiblich konnotierter Merkmale unter den Mann bzw. das ‚Männliche‘ wird dabei aus historischer Perspektive sichtbar.
Anschließend findet entlang des ‚Stratifizierungssignets Geschlecht‘ eine kurze Standortbestimmung sozialer Arbeit in der ‚Statushierarchie der Anerkennung‘ statt. Dazu bediene ich mich des anerkennungstheoretischen Konzepts Axel Honneths. Entlang der drei Anerkennungssphären Liebe, Leistung und Recht werden im dritten Kapitel die aktuellen Professionalisierungsstrategien - sprich Aufwertungsversuche - Sozialer Arbeit beschrieben.
Die unterschiedlichen Argumentationsstränge und Aufwertungsstrategien werden dann im vierten Kapitel kritisch reflektiert und auf Ambivalenzen bzw. auch auf eventuelle Kompatibilität überprüft. Gleichzeitig findet eine Beantwortung der Frage statt, unter welchen Bedingungen soziale Arbeit nun -aus meiner Sicht - eine Höherwertung erreichen könnte und wie disponibel die momentane Lage der Sozialen Arbeit ist.
Dieser Essay bleibt primär auf die Darlegung theoretischer Standpunkte beschränkt und beschäftigt sich daher weniger mit der konkreten Verwirklichung in der Praxis.
Auf Grund der Genderthematik ist dieser Text geschlechtergerecht formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund: über die Geschichte der sozialen Arbeit und den Geschlechterkampf
- Die drei Anerkennungssphären und aktuelle Aufwertungsversuche Sozialer Arbeit
- Die Anerkennungssphäre Liebe/Fürsorge und die Care-Debatte
- Die Anerkennungssphäre Leistung und Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
- Die Anerkennungssphäre Recht und eine kritisch-reflexive Soziale Arbeit
- What works: Leistung, Liebe oder Recht?
- Das Leistungsprinzip und die Vermännlichung Sozialer Arbeit
- Die Care-Debatte und die Verweiblichung Sozialer Arbeit
- Zwischenfazit: Die Vielfalt macht's oder: Recht statt Leistung und Liebe
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Abwertung sozialer Arbeit als Frauenberuf in einer männerdominierten Gesellschaft. Er untersucht die historische Entwicklung der sozialen Arbeit im Kontext von Geschlechterrollen und -kämpfen und beleuchtet die aktuelle Debatte um die Anerkennung sozialer Arbeit anhand von Axel Honneths Anerkennungstheorie. Der Essay argumentiert, dass die Anerkennung sozialer Arbeit durch die drei Sphären Liebe, Leistung und Recht beeinflusst wird und dass die aktuelle Situation der sozialen Arbeit durch die Verweiblichung und die Ökonomisierung des Berufsfelds geprägt ist.
- Die Abwertung sozialer Arbeit als Frauenberuf in einer männerdominierten Gesellschaft
- Die historische Entwicklung der sozialen Arbeit im Kontext von Geschlechterrollen und -kämpfen
- Die aktuelle Debatte um die Anerkennung sozialer Arbeit anhand von Axel Honneths Anerkennungstheorie
- Die drei Sphären der Anerkennung: Liebe, Leistung und Recht
- Die Verweiblichung und die Ökonomisierung des Berufsfelds
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These auf, dass Soziale Arbeit in einer männerdominierten Gesellschaft aufgrund ihres Berufsstandes als „Frauenberuf“ in ihrer Profession eine Abwertung erfährt. Sie skizziert die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit und zeigt die enge Verknüpfung mit Frauenbewegungen und frühen Emanzipationsbestrebungen auf. Die Einleitung führt das Konzept der Anerkennungssphären nach Axel Honneth ein und kündigt die Analyse der aktuellen Professionalisierungsstrategien Sozialer Arbeit an.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte der Sozialen Arbeit und die Rolle der Geschlechterverhältnisse. Es zeigt, wie soziale und fürsorgerische Tätigkeiten ursprünglich im Haushalt angesiedelt waren und mit der Industrialisierung zunehmend in den öffentlichen Bereich verschoben wurden. Die Entstehung der sozialen Frage und die Reaktion darauf durch Männer in Form von öffentlicher Armenpflege werden dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Frauen in der privaten Fürsorge und die Entwicklung der „Geistigen Mütterlichkeit“ als Beitrag zum Sozialen. Es zeigt, wie Frauen durch die Professionalisierung der Sozialen Arbeit Zugang zu Ausbildung und Beruf erhielten, aber gleichzeitig in den unteren Etagen der Hierarchie blieben.
Das dritte Kapitel analysiert die drei Anerkennungssphären nach Axel Honneth im Kontext der Sozialen Arbeit. Es beleuchtet die Anerkennungssphäre der Liebe/Fürsorge und die Care-Debatte, die Anerkennungssphäre der Leistung und die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit sowie die Anerkennungssphäre des Rechts und die Bedeutung einer kritisch-reflexiven Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Soziale Arbeit, die Anerkennung, die Geschlechterverhältnisse, die Frauenarbeit, die Care-Debatte, die Ökonomisierung, die Professionalisierung, die Anerkennungssphären nach Axel Honneth (Liebe, Leistung, Recht) und die Abwertung von Frauenberufen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Soziale Arbeit oft als „Frauenberuf“ abgewertet?
Historisch bedingt wurde Soziale Arbeit aus der privaten Fürsorge ("Geistige Mütterlichkeit") entwickelt, was zu einer Abwertung als weiblich codierte 'Semi-Profession' führte.
Wie hängen Soziale Arbeit und Frauenbewegungen zusammen?
Die Entstehung der professionellen Sozialen Arbeit war eng mit den Emanzipationsbestrebungen von Frauen verknüpft, die sich dadurch neue Bildungs- und Berufsfelder erschlossen.
Was besagt Axel Honneths Anerkennungstheorie für diesen Bereich?
Honneth unterscheidet die Sphären Liebe, Leistung und Recht. Soziale Arbeit kämpft oft um Anerkennung in der Leistungssphäre, da sie primär der Fürsorge (Liebe) zugeordnet wird.
Was bewirkt die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit?
Sie führt zu einem Fokus auf messbare Leistung, was einerseits zur Professionalisierung beitragen kann, andererseits aber die Beziehungsarbeit und Fürsorgeaspekte unter Druck setzt.
Wie könnte eine Höherwertung der Sozialen Arbeit erreicht werden?
Durch eine stärkere rechtliche Verankerung als unverzichtbare gesellschaftliche Leistung und eine Aufwertung der "Care"-Arbeit jenseits geschlechtsspezifischer Rollenbilder.
- Quote paper
- Julie Bergé (Author), 2014, Soziale Arbeit als unterbezahlte Frauenarbeit. Folge einer männergeprägten Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278932