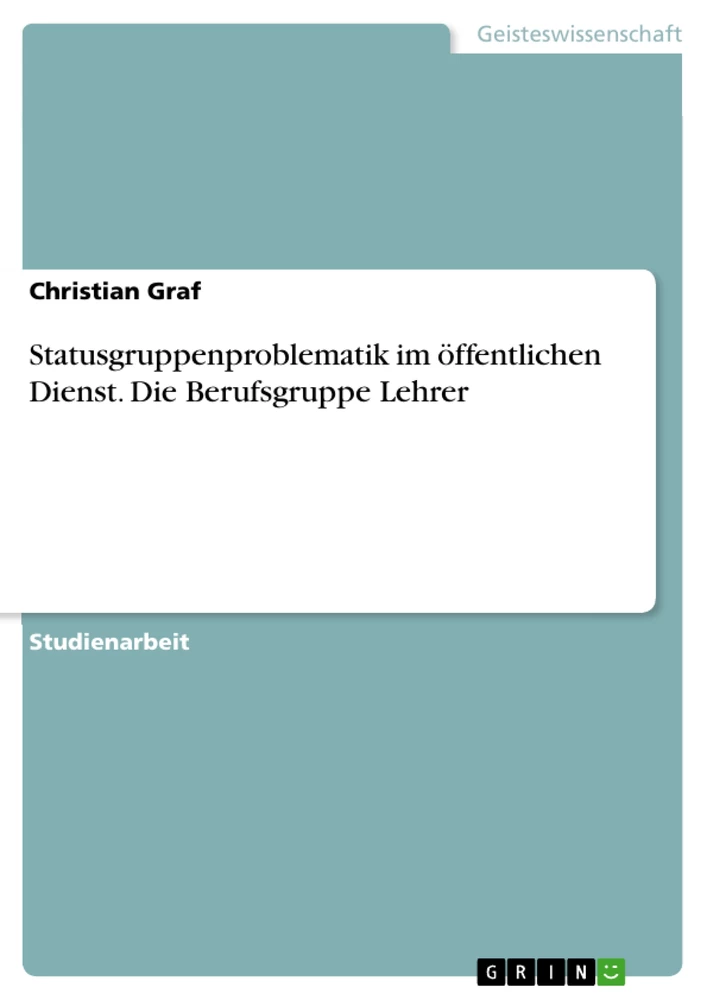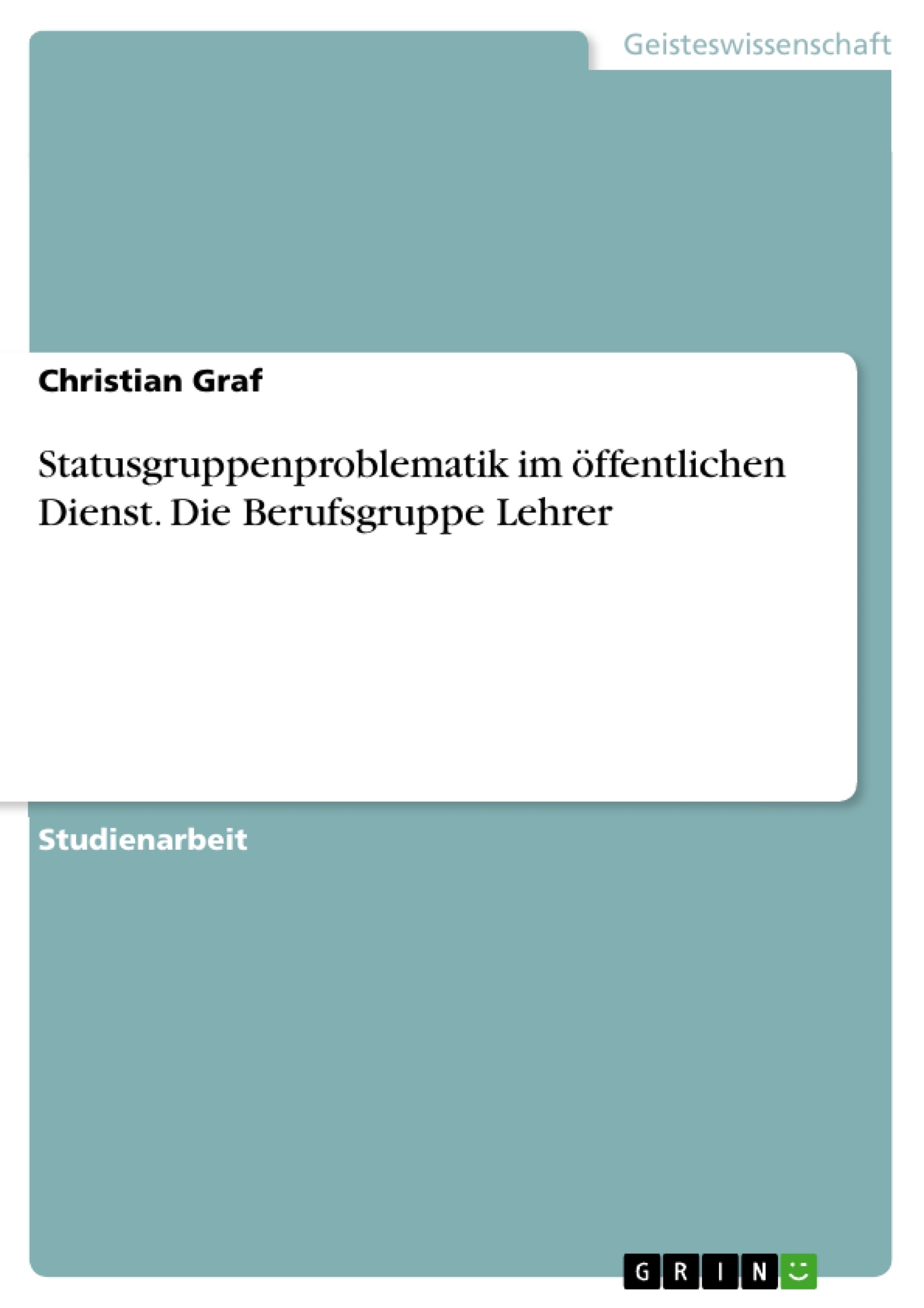Seit der Industrialisierung in der Bundesrepublik Deutschland gibt es den Dualismus der Statusgruppen Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Oftmals sind strikte Trennungen der beiden Statusgruppen nicht möglich, denn viele Tätigkeiten sind bei Beamten und Angestellten fast immer identisch. Das beste Beispiel hierfür ist die Berufsgruppe der Lehrer in Deutschland, weshalb diese Arbeit den Schwerpunkt auf das Amt der Lehrerschaft legt. Es gibt verbeamtete und angestellte Lehrer, doch viele angestellte Lehrer klagen über die herrschende Ungerechtigkeit, weil verbeamtete Kollegen viele „Sonderrechte“ genießen, die die angestellten nicht haben. Dies gilt als ein wesentliches Problem, welches zur sogenannten Statusgruppenproblematik zählt. Die entscheidende Frage also, mit der sich diese Arbeit beschäftigen wird, ist die Statusgruppenproblematik. Hierbei soll die Statusgruppenproblematik am Beispiel der Berufsgruppe der Lehrer analysiert und begründet werden. Die zentralen Fragen, die mit der Statusgruppenproblematik in Verbindung stehen, wie wodurch entsteht die Problematik oder welche konkreten Ungerechtigkeiten gibt es, insbesondere bei den Lehrern, sollen daher ebenfalls mitberücksichtigt und abgehandelt werden.
Zunächst soll genau geklärt werden, was mit Statusgruppenproblematik gemeint ist und welche Probleme es im Allgemeinen zwischen Beamten und Angestellten gibt. Als Ausgangssituation für die Erklärung der Statusgruppenproblematik in der BRD sollen hierbei der Artikel 33 des Grundgesetzes und die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums dienen, die im Einzelnen erklärt werden sollen. Auch die Problematik der hergebrachten Grundsätze, soll im ersten Kapitel kurz dargestellt werden und wie diese mit der Statusgruppenproblematik zusammenhängen. Im darauffolgenden Kapitel soll die Statusgruppenproblematik am Beispiel der Lehrer anhand verschiedener Vergleiche verdeutlicht werden. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen verbeamteten und angestellten Lehrern, wie sieht die Verbeamtungspraxis in Deutschland aus und warum werden Lehrer überhaupt verbeamtet? Zudem soll die Kostenfrage für die Einstellung der beiden Statusgruppen zur Unterstreichung der Ungerechtigkeit, die mit der Statusgruppenproblematik zusammenhängt, dienen. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit und die Darstellung von Limitationen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst der BRD
- Vergleiche der beiden Statusgruppen am Beispiel der Lehrer
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst Deutschlands, insbesondere im Kontext der Lehrerschaft. Ziel ist es, die Ungleichheiten zwischen verbeamteten und angestellten Lehrern zu beleuchten und die zugrundeliegenden Ursachen zu ergründen. Die Arbeit untersucht die historischen und rechtlichen Grundlagen der Problematik und vergleicht die Situation von Beamten und Angestellten anhand konkreter Beispiele.
- Der Dualismus von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst
- Die rechtlichen Grundlagen der Statusgruppenproblematik (Art. 33 GG)
- Vergleich der Arbeitsbedingungen und Rechte von verbeamteten und angestellten Lehrern
- Die Kostenfrage bei der Einstellung von Beamten und Angestellten
- Die Problematik der "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums"
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht die Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst Deutschlands, fokussiert auf die Unterschiede zwischen verbeamteten und angestellten Lehrern. Es wird die zentrale Frage nach den Ungerechtigkeiten und den Ursachen der Problematik gestellt und der methodische Ansatz der Arbeit skizziert. Die Bedeutung von Artikel 33 des Grundgesetzes und die "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums" werden als Ausgangspunkte für die Analyse benannt.
Die Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst der BRD: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Dualismus zwischen Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst. Es wird der zunehmende Angleichungsprozess beider Statusgruppen beschrieben und die Problematik der fließenden Grenzen zwischen ihnen hervorgehoben. Die Arbeit verdeutlicht, dass trotz der oft identischen Tätigkeiten und Arbeitszeiten wesentliche Unterschiede in den Beschäftigungsverhältnissen bestehen. Artikel 33 GG und die Problematik der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums werden im Kontext der Statusgruppenproblematik erläutert.
Schlüsselwörter
Statusgruppenproblematik, Beamte, Angestellte, Lehrer, öffentlicher Dienst, Artikel 33 GG, hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums, Verbeamtung, Ungleichbehandlung, hoheitliche Befugnisse.
Häufig gestellte Fragen zur Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst Deutschlands, insbesondere die Ungleichheiten zwischen verbeamteten und angestellten Lehrern. Sie untersucht die historischen und rechtlichen Grundlagen dieser Problematik und vergleicht die Situation beider Gruppen anhand konkreter Beispiele.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Dualismus von Beamten und Angestellten, die rechtlichen Grundlagen (Art. 33 GG), den Vergleich der Arbeitsbedingungen und Rechte von verbeamteten und angestellten Lehrern, die Kostenfrage bei der Einstellung und die Problematik der "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst der BRD, ein Kapitel mit Vergleichen am Beispiel der Lehrer und einen Schluss. Die Einführung skizziert die Problematik und den methodischen Ansatz. Das Hauptkapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Dualismus und die Unterschiede trotz oft identischer Tätigkeiten. Das Kapitel zu den Lehrern vertieft den Vergleich beider Statusgruppen in diesem Berufsfeld.
Welche Rolle spielt Artikel 33 des Grundgesetzes?
Artikel 33 GG und die "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums" bilden zentrale Ausgangspunkte für die Analyse der Statusgruppenproblematik. Die Arbeit untersucht deren Bedeutung im Kontext der Ungleichheiten zwischen Beamten und Angestellten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Statusgruppenproblematik, Beamte, Angestellte, Lehrer, öffentlicher Dienst, Artikel 33 GG, hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums, Verbeamtung, Ungleichbehandlung, hoheitliche Befugnisse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Ungleichheiten zwischen verbeamteten und angestellten Lehrern im öffentlichen Dienst zu beleuchten und die zugrundeliegenden Ursachen zu ergründen.
Wie wird die Problematik der Statusgruppen im Kontext der Lehrer dargestellt?
Die Arbeit vergleicht die Situation verbeamteter und angestellter Lehrer, um die konkreten Auswirkungen der Statusgruppenproblematik zu verdeutlichen. Dieser Vergleich dient als Fallstudie zur Illustration der allgemeinen Problematik.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, um die Unterschiede zwischen Beamten und Angestellten aufzuzeigen. Die Analyse stützt sich auf die rechtlichen Grundlagen und die historische Entwicklung des Dualismus.
- Quote paper
- Christian Graf (Author), 2013, Statusgruppenproblematik im öffentlichen Dienst. Die Berufsgruppe Lehrer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278816