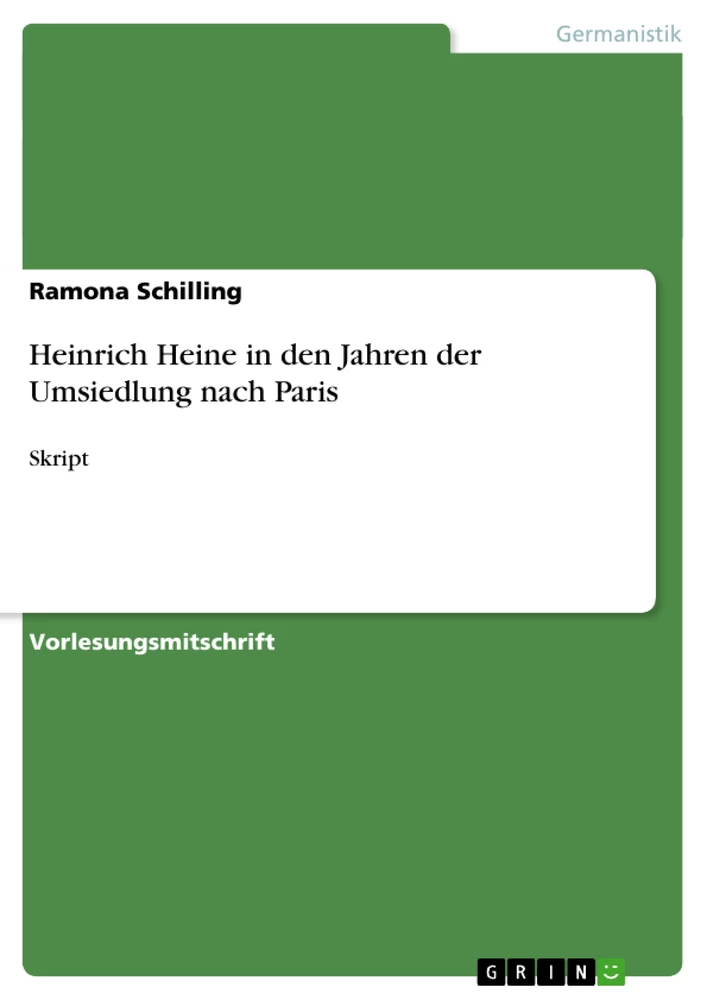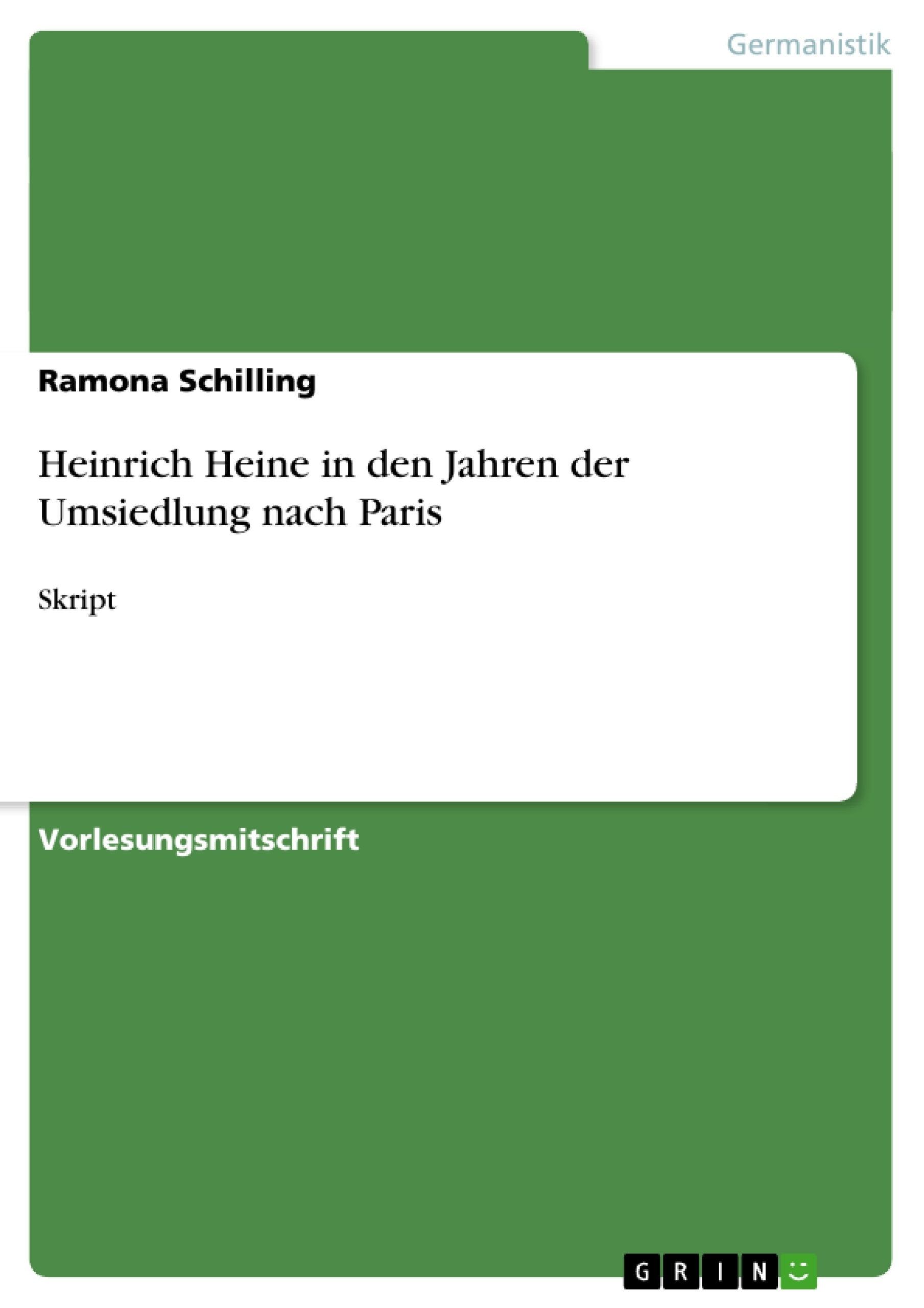Heinrich Heine nach der Juli-Revolution von 1830 und das komische Versepos „Atta Troll“ (1841/42)
Inhaltsverzeichnis
- Das Jahr 1830
- „Atta Toll. Ein Sommernachtstraum“ (1841/1842): Politik und Kunst
- St. Simonismus
- Luther
- Spinoza
- 3 Schritte zur Revolution in Deutschland
- Französische Zustände (1831/32)
- Die unvollendete Neuordnung Europas
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich Heines Schaffen im Kontext der Juli-Revolution von 1830 und beleuchtet insbesondere das komische Versepos „Atta Troll“ (1841/42). Sie untersucht Heines politische und künstlerische Positionierung in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche und analysiert die Bedeutung des Werkes im Spannungsfeld zwischen Romantik, politischer Kritik und Kunst um der Kunst willen.
- Heines politische und künstlerische Positionierung nach der Juli-Revolution
- Die Bedeutung von „Atta Troll“ als komisches Versepos
- Heines Kritik an der Tendenzpoesie und die Betonung der Kunst um der Kunst willen
- Die Rolle des Christentums und des Pantheismus in Heines Denken
- Heines Auseinandersetzung mit Luther, Spinoza und Napoleon
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die politische und gesellschaftliche Situation in Europa im Jahr 1830, insbesondere die Juli-Revolution in Frankreich und die Auswirkungen auf Deutschland. Es wird Heines Übersiedlung nach Paris und seine Einbindung in die Pariser Salons beschrieben.
Das zweite Kapitel analysiert Heines komisches Versepos „Atta Troll“ und beleuchtet die darin enthaltenen politischen und künstlerischen Botschaften. Es werden die Kritik an der Tendenzpoesie, die Betonung der Kunst um der Kunst willen und die Auseinandersetzung mit verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen, wie dem Kommunismus und dem frühen Kapitalismus, untersucht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Heines Auseinandersetzung mit dem St. Simonismus und seiner Interpretation des Christentums. Es werden Heines Gedanken zur Rolle des Christentums in der Zivilisationsgeschichte, seine „Zwei-Prinzipienlehre“ und seine Vorstellung von einer „Religion der Freude“ erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert Heines „Französische Zustände“ (1831/32) und beleuchtet seine Berichterstattung aus Frankreich für ein deutsches Publikum. Es werden die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Heine schrieb, sowie seine Kritik an Metternich, Hegel und Schleiermacher dargestellt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Heines Vorstellung von einer unvollendeten Neuordnung Europas und seiner Rezeption des Napoleon-Mythos. Es wird die Bedeutung Napoleons als „verhüllter Mann der Zeit“ und seine Rolle als Heiland in Heines Denken untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Heinrich Heine, Juli-Revolution, „Atta Troll“, Kunst um der Kunst willen, Tendenzpoesie, St. Simonismus, Christentum, Pantheismus, Luther, Spinoza, Napoleon, Französische Zustände, Neuordnung Europas, Romantik, politische Kritik, Gesellschaft, Kultur, Literatur.
- Citar trabajo
- Bachelor Ramona Schilling (Autor), 2011, Heinrich Heine in den Jahren der Umsiedlung nach Paris, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278626