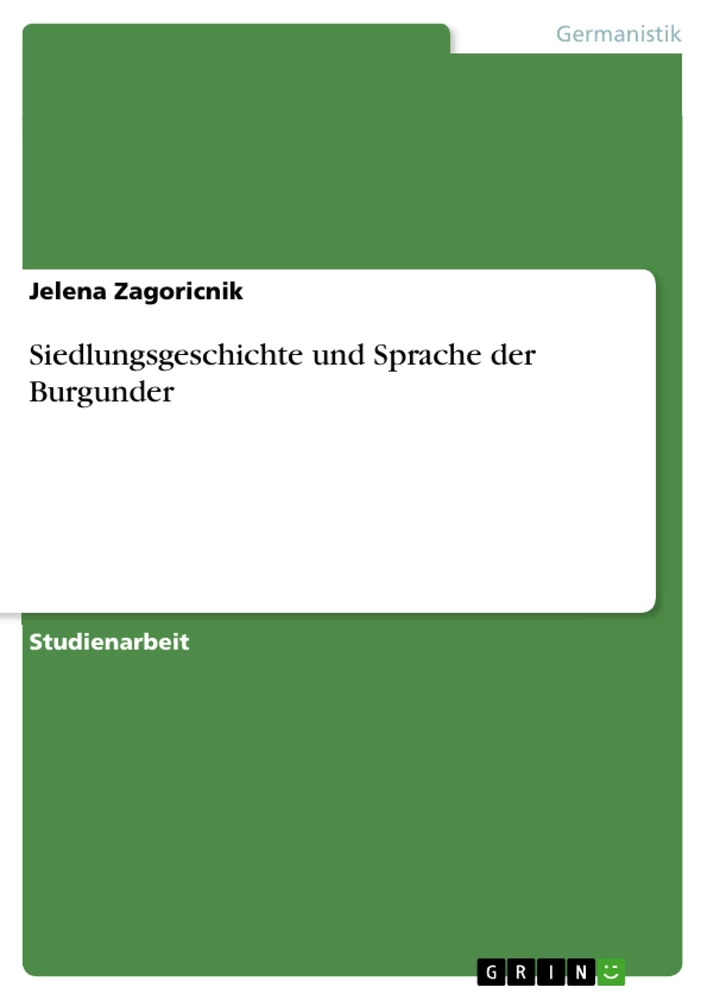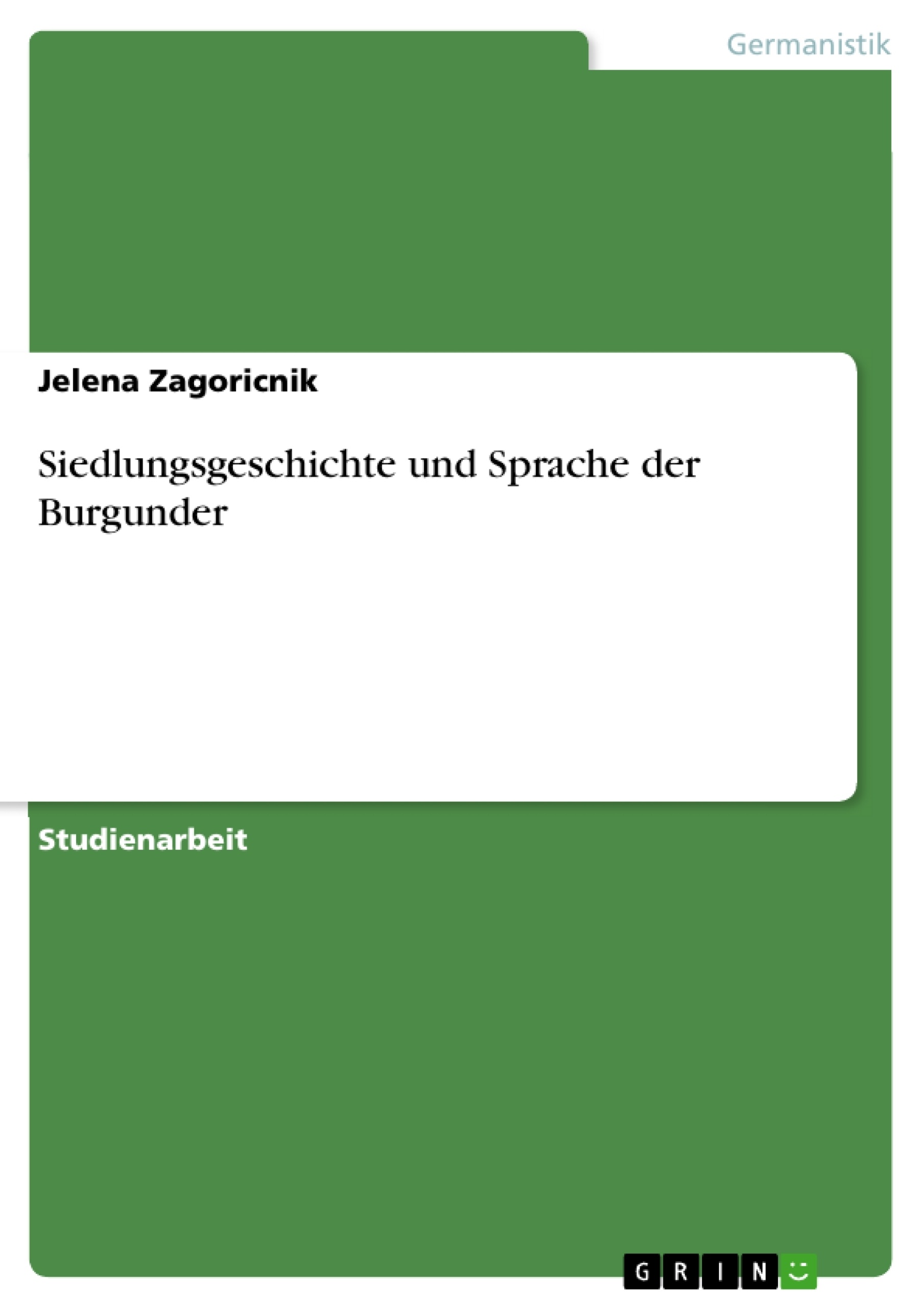Das heutige Burgund – die Region Bourgogne in Frankreich – ist vor allem für seine Weine, seine Kirchen, Paläste und Schlösser bekannt. Doch wie sieht es aus mit dem spätantiken namhaften Volk der Burgunder? Dieses kennen die Meisten aus Sagen wie dem Nibelungenlied, der Thidrekssaga Dietrichs von Bern, dem Siegfried-, Dietrich-, Brunhild- oder Atlilied aus der Liederedda, welche inhaltlich in die Völkerwanderungszeit zurückreichen. Den Sagen zufolge, die den historischen Stoff mit weiteren mündlich überlieferten germanischen Heldensagen verflochten, hatte der burgundische König Gunther seinen Hauptsitz in Worms, was Literaturwissenschaftler, Historiker und Archäologen dazu veranlasste in diesem Gebiet nach den historischen Spuren des burgundischen Volkes zu suchen; bis heute jedoch ohne Erfolg. Auch historische literarische, inschriftliche und die wenigen archäologischen Quellen aus der Zeit des Römischen Reichs konnten bei diesem Unternehmen nicht weiterhelfen.
Auch über die Identität und Kultur der Burgunder erfahren wir äusserst wenig durch die Römer, die in der Sapaudia ab 443 mit ihnen Landbesitz und Nachbarschaft teilten; dies z. B. aus Sidonius Apollinaris’ sarkastischem Gedicht an Catullinus (MGH, AA 8, 1887, 230f.), wo er die Burgunder als ein vielfrässiges, germanisch sprechendes Volk mit barbarischem Betragen, langen mit ranziger Butter eingeschmierten Haaren, das zwar sehr gern und auch gut sang, aber dennoch am morgen früh schon nach Knoblauch und Zwiebeln stank (vgl. Beck 1981, 229). Über die rechts vom Rhein sesshaften Burgunder erfahren wir durch Sokrates, dass sie friedlich von der Landwirtschaft, ihrer Pferdezucht, dem Handel und ihrem Lohn als Handwerker (Holzbauleute), und nicht von Beutezügen lebten (vgl. Kaiser 2004, 31 und 34f.).
Es stellen sich weitere Fragen, wie: Woher kamen die Burgunder und wo genau siedelten sie über längere Zeit nach ihrer Teilnahme an der Völkerwanderung? Wie mag ihre Sprache geklungen haben und welcher Sprachgruppe würde man das Burgundische heute am ehesten zuweisen? Welche sprachlichen Gemeinsamkeiten hat es mit dem West- und Ostgermanischen und welche Charakteristika unterscheiden es von beiden? Wie lange wurde das Burgundische gesprochen? Und zuletzt: Welchen Einfluss hatte das Lateinische auf das Burgundische oder es selbst auf andere Sprachen, wie das Frankoprovenzalische? ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Geschichte der Burgunder (2. v. Chr. – 6. Jh. n. Chr.)
- 2. Siedlungsgeschichte der Burgunder
- 2.1. Ortsnamen mit dem Suffix -ing
- 3. Die burgundische Sprache
- 3.1. Phonologie, Morphologie und Lexik des Burgundischen
- 3.1.1. Gemeinsamkeiten mit den ostgermanischen Sprachen
- 3.1.2. Gemeinsamkeiten mit den westgermanischen Sprachen
- 3.1.3. Eigenheiten des Burgundischen
- 3.2. Lehnwörter im und aus dem Burgundischen
- 3.2.1. Frankoprovenzalische Wörter burgundischen Ursprungs
- 3.2.2. Burgundische Wörter lateinischen Ursprungs
- Schlusswort
- Bibliographie
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geschichte, Siedlungsgeschichte und Sprache der Burgunder, einem spätantiken germanischen Volk. Ziel ist es, anhand historischer Quellen und sprachwissenschaftlicher Analysen ein umfassendes Bild dieses Volkes zu zeichnen. Die Arbeit beleuchtet die Herkunft der Burgunder, ihre Wanderungen und ihre Siedlungsgebiete, sowie die Entwicklung und Charakteristika ihrer Sprache.
- Die Geschichte der Burgunder vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr.
- Die Siedlungsgeschichte der Burgunder anhand von Ortsnamen mit dem Suffix -ing
- Die phonologischen, morphologischen und lexikalischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Burgundischen zu den ost- und westgermanischen Sprachen
- Die Eigenheiten des Burgundischen
- Der Einfluss des Lateinischen auf das Burgundische und umgekehrt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfragen vor. Kapitel 1 beleuchtet die Geschichte der Burgunder von ihren möglichen Ursprüngen in Skandinavien bis zu ihrer Niederlassung im heutigen Burgund. Es werden die wichtigsten Quellen und Thesen zur Geschichte der Burgunder vorgestellt und diskutiert. Kapitel 2 widmet sich der Siedlungsgeschichte der Burgunder anhand von Ortsnamen mit dem typischen burgundischen Suffix -ing. Die Analyse dieser Ortsnamen ermöglicht es, das Siedlungsgebiet der Burgunder im 5. und 6. Jahrhundert genauer zu bestimmen. Kapitel 3 befasst sich mit der burgundischen Sprache. Es werden die phonologischen, morphologischen und lexikalischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Burgundischen zu den ost- und westgermanischen Sprachen untersucht. Darüber hinaus werden die Eigenheiten des Burgundischen sowie der Einfluss des Lateinischen auf diese Sprache beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Burgunder, die Völkerwanderungszeit, die Siedlungsgeschichte, die Sprache, das Burgundische, die ostgermanischen Sprachen, die westgermanischen Sprachen, das Lateinische, das Frankoprovenzalische, Ortsnamen, Phonologie, Morphologie, Lexik, Lehnwörter.
- Quote paper
- Jelena Zagoricnik (Author), 2013, Siedlungsgeschichte und Sprache der Burgunder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278362