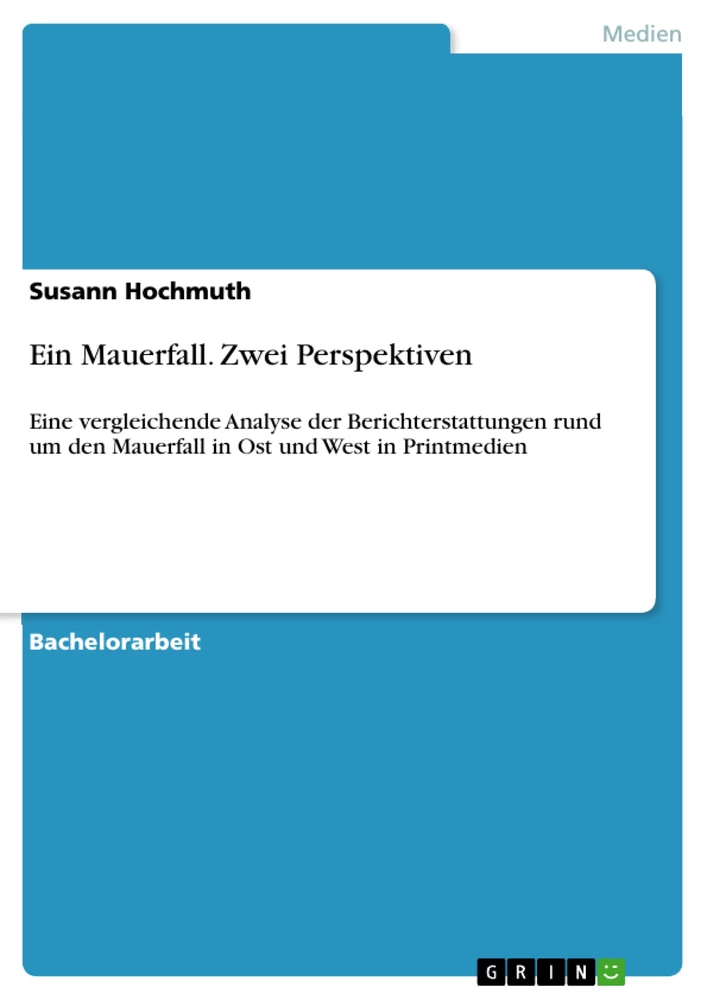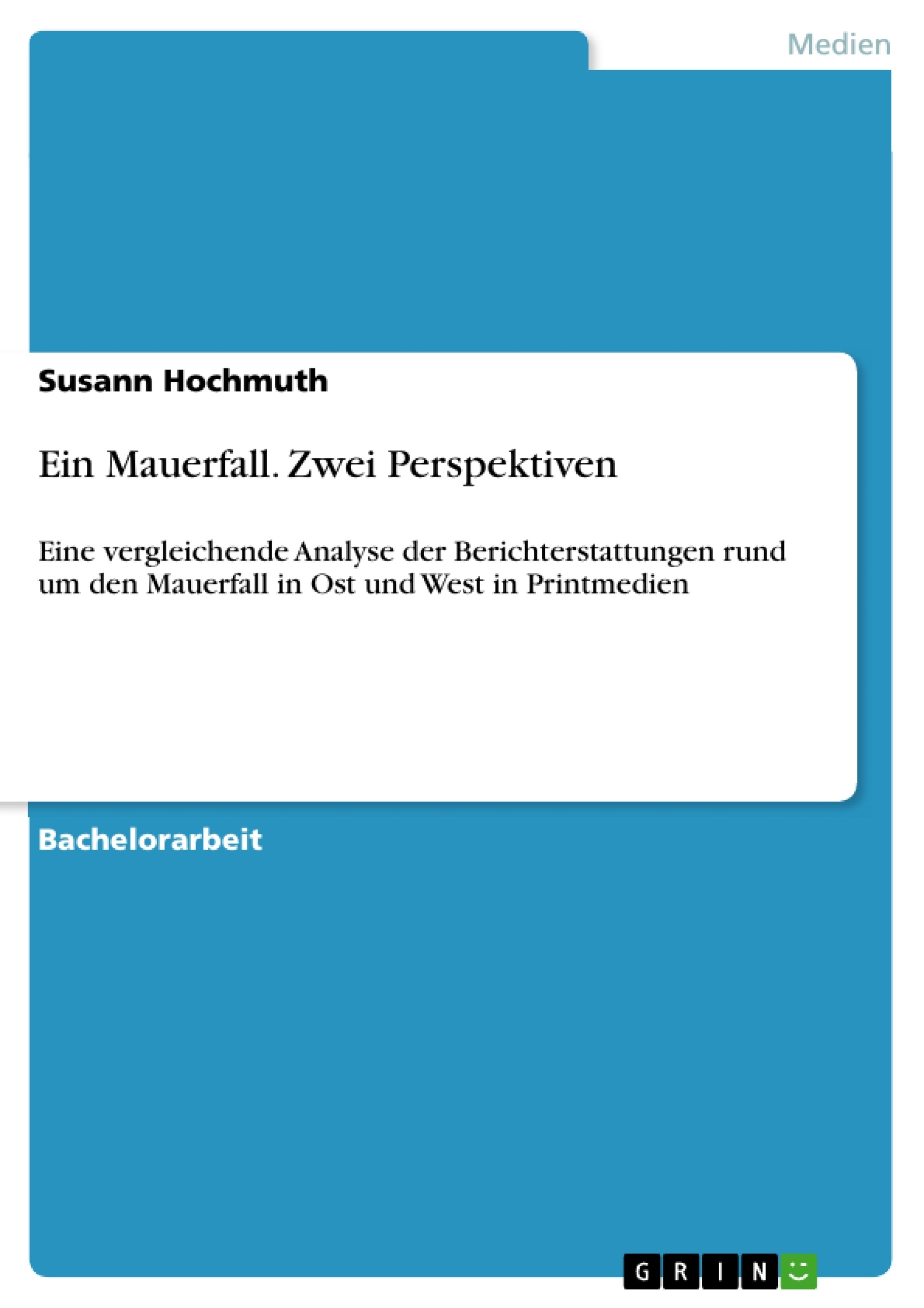Eine vergleichende Analyse der Berichterstattungen rund um den Mauerfall in Ost und West in Printmedien.
„Die Mauer wird noch in 50 oder 100 Jahren bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind“ versicherte der Generalsekretär der DDR, Erich Honecker, noch im Januar 1989. Tatsächlich „fiel“ die Mauer nur zehn Monate später. Heute sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen und die Bundesrepublik Deutschland kann im Oktober diesen Jahres den zwanzigsten Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung feiern. Anlässlich dieses Jubiläums wird der Einigungsprozess 1989 bis 1990 Thema vieler Berichterstattungen sein, wie auch der Mauerfall, der sich bereits im letzten November zum zwanzigsten Mal jährte. Im Mittelpunkt dieser Berichte standen persönliche Geschichten sowie die historischen Geschehnisse, die den Weg zur deutschen Einheit ebneten. Damals überschlugen sich die Ereignisse nahezu. Angestoßen von dem Abbau ungarischer
Grenzanlagen nach Österreich und der darauffolgenden Fluchtversuche unzähliger DDR-Bürger über die Volksrepublik in den Westen, sowie den nachgewiesenen Wahlfälschungen der SED, entfaltete sich eine Kette von historischen Geschehnissen. Was noch am Anfang des Jahres niemand für denkbar hielt, ereignete sich nun im Herbst 1989 innerhalb kürzester Zeit. In nur wenigen Wochen zerbrach das Regime nach vierzigjähriger Vorherrschaft wie im Zeitraffer. Geschwächt von den zahlreichen Fluchtversuchen und öffentlichen Protesten im Sommer geriet die Partei immer mehr unter Druck. Als Ungarn sich schließlich im September entschied, die Grenze nach Österreich endgültig zu öffnen, was den Flüchtlingsstrom in den Westen noch mehr antrieb, sah sich die SED in einer ausweglosen Lage und traf daher eine folgenreiche Entscheidung. Honecker war laut der Parteimitglieder nicht mehr dazu fähig, einen Umschwung der Situation zu bewirken, weswegen man ihn am 18. Oktober absetzte. Mit der Nachfolge von Egon Krenz als Generalsekretär wuchs die Kritik an der Regierung. Alle Versuche der Politiker, die Regierung wieder zu stabilisieren, schlugen fehl. Selbst die Ankündigung neuer Reiseregelungen änderte nichts daran. Die Oppositionsbewegungen, die ihren Höhepunkt im November in Berlin fanden, sowie die Fluchtversuche aus der Republik nahmen kein Ende. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand der Arbeit und Motivation
- Methoden und Aufbau der Arbeit
- Theoretische Vorüberlegungen und Hintergründe
- Die Rolle der Medien in den deutsch-deutschen Beziehungen
- Rolle der ostdeutschen Medien
- Rolle der westdeutschen Medien
- Stereotypen - und Perzeptionstheorie
- Nationenbild – nationales Selbstbild – nationales Fremdbild
- Nationalstereotypen
- Zur Konstruktion von Nationenbildern und Verwendung von Stereotypen in den Medien
- Kurzporträts der ausgewählten DDR- und BRD- Zeitungen
- Neues Deutschland und Berliner Zeitung
- Frankfurter Allgemeine Zeitung und Tagesspiegel
- Die Rolle der Medien in den deutsch-deutschen Beziehungen
- DDR- Berichterstattung 1989: Vergleich ostdeutscher Artikel des ND und der BZ mit westdeutschen Artikeln der FAZ und des Tagesspiegels
- Der letzte Wahlbetrug der SED
- Historischer Kontext
- Vergleichende Inhaltsanalyse der Berichterstattungen
- Das Bild der BRD und der DDR in den Berichterstattungen
- Das erste Loch im „Eisernen Vorhang"
- Historischer Kontext
- Vergleichende Inhaltsanalyse der Berichterstattungen
- Das Bild der BRD und der DDR in den Berichterstattungen
- Machtwechsel von Honecker zu Krenz
- Historischer Kontext
- Vergleichende Inhaltsanalyse der Berichterstattungen
- Das Bild der BRD und der DDR in den Berichterstattungen
- Der Fall der Mauer
- Historischer Kontext
- Vergleichende Inhaltsanalyse der Berichterstattungen
- Das Bild der BRD und der DDR in den Berichterstattungen
- Der letzte Wahlbetrug der SED
- Zusammenfassung der deutsch-deutschen Berichterstattung
- Berichterstattung aus der BRD - Perspektive
- Berichterstattung aus der DDR - Perspektive
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit einer vergleichenden Analyse der Berichterstattung rund um den Mauerfall in Ost- und Westdeutschland. Ziel ist es, die Unterschiede in der Darstellung der Ereignisse in ausgewählten Printmedien der DDR und der BRD zu untersuchen und die jeweiligen Perspektiven aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie die Medien die Ereignisse interpretierten, welche Bilder von den jeweiligen Gesellschaften vermittelt wurden und welche Stereotypen dabei zum Einsatz kamen.
- Die Rolle der Medien in der deutsch-deutschen Beziehung
- Die Konstruktion von Nationenbildern und die Verwendung von Stereotypen in den Medien
- Die unterschiedlichen Perspektiven der Berichterstattung in Ost- und Westdeutschland
- Die Darstellung der Ereignisse des Mauerfalls in den ausgewählten Printmedien
- Die Entwicklung des deutsch-deutschen Verhältnisses im Kontext des Mauerfalls
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Gegenstand und die Motivation der Untersuchung. Sie beleuchtet die historische Bedeutung des Mauerfalls und die Rolle der Medien in diesem Prozess. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Vorüberlegungen und Hintergründen der Arbeit. Es beleuchtet die Rolle der Medien in den deutsch-deutschen Beziehungen und die Bedeutung von Stereotypen und Perzeptionstheorie für die Analyse der Berichterstattung. Das Kapitel stellt die ausgewählten Zeitungen vor und gibt einen Überblick über deren politische Ausrichtung und journalistische Tradition.
Das dritte Kapitel analysiert die Berichterstattung in den ausgewählten Zeitungen zu verschiedenen Schlüsselereignissen des Jahres 1989. Es werden die Berichterstattung zum letzten Wahlbetrug der SED, zum ersten Loch im „Eisernen Vorhang", zum Machtwechsel von Honecker zu Krenz und zum Fall der Mauer untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Unterschiede in der Darstellung der Ereignisse, die jeweiligen Perspektiven und die Verwendung von Stereotypen.
Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse der deutsch-deutschen Berichterstattung zusammen. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Ereignisse, die jeweiligen Perspektiven und die Verwendung von Stereotypen herausgearbeitet. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Medien für die Wahrnehmung und Interpretation der Ereignisse des Mauerfalls.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Mauerfall, die deutsch-deutsche Beziehung, die Rolle der Medien, die Berichterstattung in Ost- und Westdeutschland, Stereotypen, Nationenbilder, Perzeptionstheorie, Vergleichende Inhaltsanalyse, Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel.
- Arbeit zitieren
- Susann Hochmuth (Autor:in), 2010, Ein Mauerfall. Zwei Perspektiven, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278256