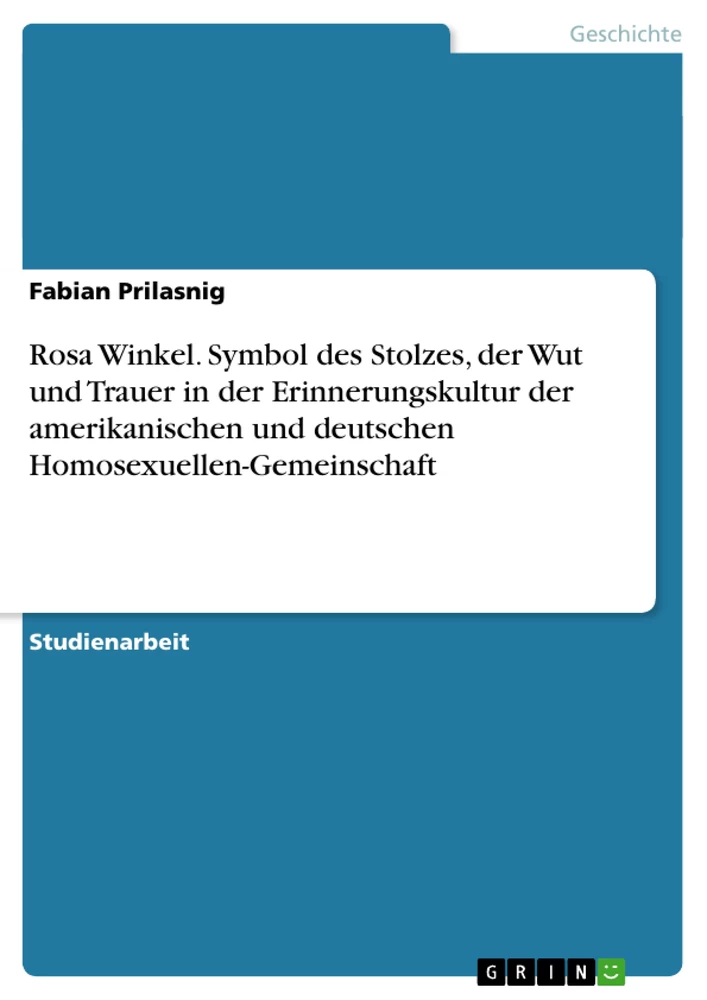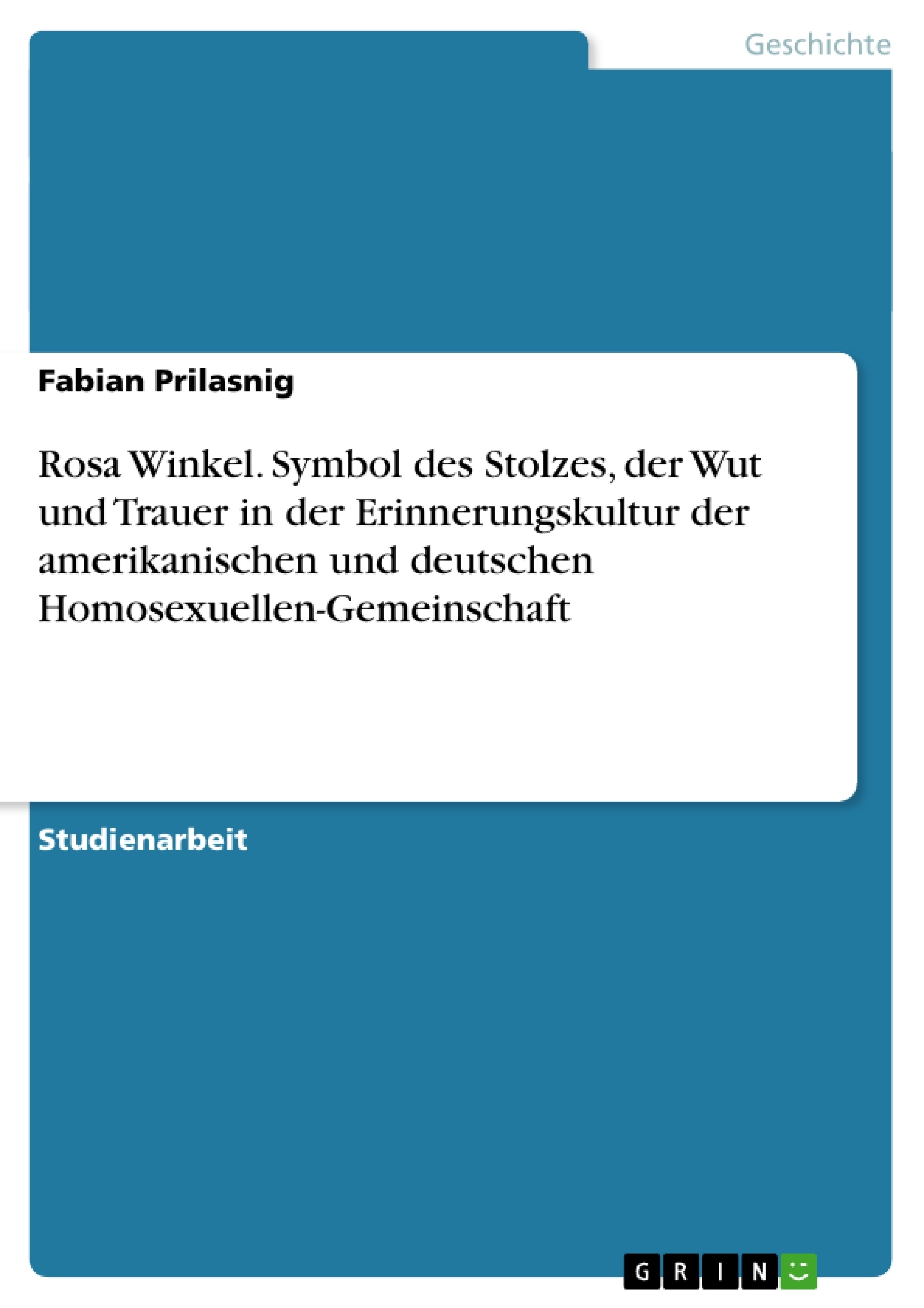Ab den 1970er Jahren begann seitens der homosexuellen Männer und Frauen in Westdeutschland sowie in den USA die Aufarbeitung ihrer Geschichte, indem Archive, Forschungsprojekte und „Oral history“-Kollektionen eingerichtet wurden. So musste der Mythos des homosexuellen Nationalsozialisten, den Sozialisten und Kommunisten aus politischem Nutzen ins Leben gerufen hatten, zuerst beseitigt werden, da in der unmittelbaren Nachkriegszeit kaum etwas über die NS-Verfolgung Homosexueller geschrieben worden ist. Daher wurde der Rosa Winkel als Symbol der neuen Homosexuellenbewegung verwendet, um diesen Mythos endgültig zu entkräften.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Situation in den NS-Konzentrationslagern:
- Zur Forschung über nationalsozialistische Anti-Homosexuellen-Politik:
- Zur Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses in der amerikanischen und deutschen Homosexuellen-Gemeinschaft:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation lesbischer Frauen im Nationalsozialismus und die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses an die Verfolgung Homosexueller in der amerikanischen und deutschen Homosexuellen-Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen homosexuelle Männer und Frauen im NS-Regime gegenüberstanden, die Forschungslandschaft zu diesem Thema und die Reaktionen der Homosexuellen-Bewegung auf die historische Verfolgung.
- Die Lebensbedingungen homosexueller Männer und Frauen in NS-Konzentrationslagern
- Die Forschungsgeschichte zur nationalsozialistischen Anti-Homosexuellen-Politik
- Die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses an die NS-Verfolgung Homosexueller
- Die Rolle des Rosa Winkels als Symbol
- Der Vergleich zwischen der deutschen und amerikanischen Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Situation in den NS-Konzentrationslagern: Dieser Abschnitt beschreibt die extrem schwierige Lage homosexueller Männer in den NS-Konzentrationslagern, gekennzeichnet durch den Rosa Winkel. Die Homophobie der SS und die Ablehnung durch Mitgefangene führten zu einer hohen Sterberate. Im Gegensatz zu anderen Häftlingsgruppen fehlte es an Selbstorganisation und Selbstschutz, was die Überlebenschancen erheblich reduzierte. Der Schutz einzelner Funktionshäftlinge war oft mit sexuellen Gegenleistungen verbunden. Statistische Daten aus Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen belegen eine Todesrate von 60% für die Rosa-Winkel-Häftlinge, deutlich höher als bei anderen Gruppen.
Zur Forschung über nationalsozialistische Anti-Homosexuellen-Politik: Die Forschung zu diesem Thema hatte von Anfang an eine politische Dimension, da es darum ging, die Betroffenen als Opfer anzuerkennen und zu entschädigen. Die Ergebnisse trugen maßgeblich zur politischen Bewusstseinsbildung homosexueller Männer bei, die den Rosa Winkel als Symbol des neu gewonnenen Selbstbewusstseins verwendeten. Trotz zahlreicher Publikationen seit den 1970er Jahren blieben diese Themen in der Öffentlichkeit im Vergleich zu anderen Opfergruppen weitgehend unbeachtet. Die politische Auseinandersetzung um die Anerkennung der Verfolgung Homosexueller als nationalsozialistisches Unrecht dauerte lange an, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland.
Zur Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses in der amerikanischen und deutschen Homosexuellen-Gemeinschaft: Die Debatte um die Verwendung des Rosa Winkels als Symbol der homosexuellen Identität in den 1990er Jahren illustriert die anhaltende Bedeutung dieses Symbols. Die historische Erinnerung mobilisierte die Wachsamkeit gegenüber heutiger Unterdrückung. In den 1970er Jahren entstand im Kontext der Gay Liberation ein gemeinsames Gedächtnis der NS-Verfolgung, verzögert durch das Fehlen einer freien Presse und organisierten Gemeinschaft sowie den Mangel an Zeugenaussagen. Die Homosexuellenbewegung begann, ihre Geschichte aufzuarbeiten und den Rosa Winkel als Symbol der neuen Bewegung zu verwenden, um den Mythos des homosexuellen Nationalsozialisten zu entkräften. In den USA zog die Homosexuellenbewegung häufiger Parallelen zur NS-Verfolgung, um Unterstützung zu gewinnen. Die Aids-Epidemie und die NS-Verfolgung wurden als zentrale Katastrophen des 20. Jahrhunderts wahrgenommen. Lesbische Frauen entwickelten in den 1980er Jahren eine eigene Erinnerungskultur, da sie sich innerhalb der gemeinsamen Bewegung benachteiligt fühlten und den Schwarzen Winkel als Symbol beanspruchten. Ab den 1980er Jahren entwickelte sich eine Denkmalkultur in beiden Ländern als Antwort auf die Aids-Epidemie und den Wunsch nach einem Holocaust-Gedenken.
Schlüsselwörter
Rosa Winkel, Nationalsozialismus, Homosexualität, Lesben, Schwule, Konzentrationslager, Erinnerungskultur, Homosexuellenbewegung, Antihomophobie, Opfer, Verfolgung, kollektives Gedächtnis, Paragraph 175.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Situation lesbischer Frauen im Nationalsozialismus und Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Situation lesbischer Frauen im Nationalsozialismus und die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses an die Verfolgung Homosexueller in der amerikanischen und deutschen Homosexuellen-Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie beleuchtet die spezifischen Herausforderungen für homosexuelle Männer und Frauen im NS-Regime, die Forschungslandschaft und die Reaktionen der Homosexuellen-Bewegung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Lebensbedingungen homosexueller Männer und Frauen in NS-Konzentrationslagern, die Forschungsgeschichte zur nationalsozialistischen Anti-Homosexuellen-Politik, die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses an die NS-Verfolgung Homosexueller, die Rolle des Rosa Winkels als Symbol und einen Vergleich zwischen der deutschen und amerikanischen Erinnerungskultur.
Wie beschreibt die Arbeit die Situation in den NS-Konzentrationslagern?
Der Abschnitt beschreibt die extrem schwierige Lage homosexueller Männer, gekennzeichnet durch den Rosa Winkel, die Homophobie der SS, die Ablehnung durch Mitgefangene und eine hohe Sterberate. Es fehlte an Selbstorganisation und Selbstschutz, und der Schutz einzelner Funktionshäftlinge war oft an sexuelle Gegenleistungen gebunden. Statistische Daten belegen eine Todesrate von 60% für Rosa-Winkel-Häftlinge.
Was wird über die Forschung zur nationalsozialistischen Anti-Homosexuellen-Politik gesagt?
Die Forschung hatte von Anfang an eine politische Dimension, da es um die Anerkennung und Entschädigung der Betroffenen ging. Die Ergebnisse trugen zur politischen Bewusstseinsbildung bei, obwohl die Themen in der Öffentlichkeit lange Zeit im Vergleich zu anderen Opfergruppen unbeachtet blieben. Die politische Auseinandersetzung um die Anerkennung der Verfolgung dauerte lange an.
Wie wird die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses dargestellt?
Die Debatte um den Rosa Winkel als Symbol in den 1990er Jahren illustriert dessen anhaltende Bedeutung. Die historische Erinnerung mobilisierte die Wachsamkeit gegenüber heutiger Unterdrückung. In den 1970er Jahren entstand im Kontext der Gay Liberation ein gemeinsames Gedächtnis, verzögert durch das Fehlen einer freien Presse und organisierten Gemeinschaft. Die Homosexuellenbewegung begann, ihre Geschichte aufzuarbeiten und den Rosa Winkel als Symbol zu verwenden. In den USA zog die Bewegung häufiger Parallelen zur NS-Verfolgung. Lesbische Frauen entwickelten in den 1980er Jahren eine eigene Erinnerungskultur und beanspruchten den Schwarzen Winkel. Ab den 1980er Jahren entwickelte sich eine Denkmalkultur in beiden Ländern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Rosa Winkel, Nationalsozialismus, Homosexualität, Lesben, Schwule, Konzentrationslager, Erinnerungskultur, Homosexuellenbewegung, Antihomophobie, Opfer, Verfolgung, kollektives Gedächtnis, Paragraph 175.
- Quote paper
- DI MMag Fabian Prilasnig (Author), 2014, Rosa Winkel. Symbol des Stolzes, der Wut und Trauer in der Erinnerungskultur der amerikanischen und deutschen Homosexuellen-Gemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278242