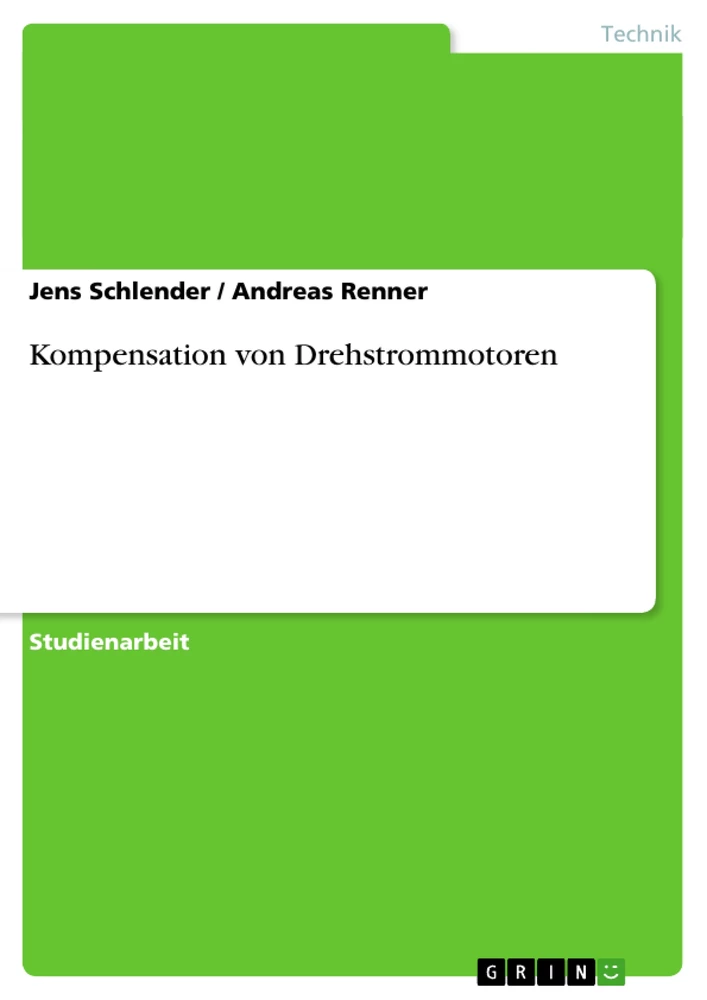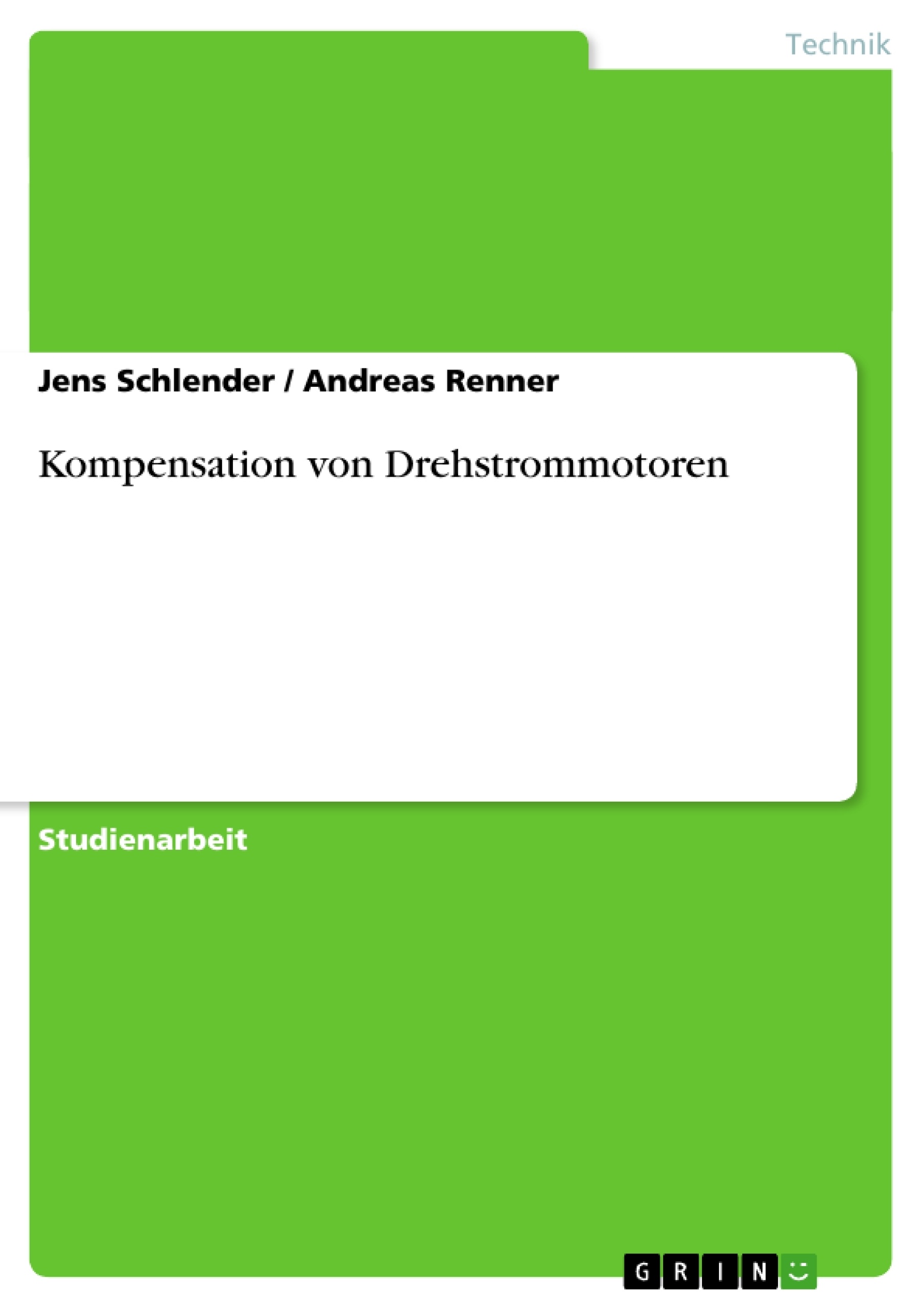Aufgrund des stetig wachsenden Einsatzes elektrotechnischer Maschinen und Geräte, speziell im Produktions- und Fertigungsbereich, erscheint es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um energieeffizienter und preiswerter zu produzieren. Eine Möglichkeit, Energie ökonomisch sinnvoller zu nutzen, ist die Kompensation von Blindströmen beim Einsatz von Drehstrommotoren. Durch Kompensation dieser Blindströme können Energiekosten eingespart und öffentliche Energieversorgungsnetze entlastet werden.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Kompensation von Blindstrom bei Drehstrommotoren. Anhand eines Asynchrondrehstrommotors sollen über praktische Versuchsdurchführungen und theoretische Berechnungen die Effizienz einer Kompensation nachgewiesen und veranschaulicht werden.
Die Arbeit zum Thema „Kompensation von Drehstrommotoren“ umfasst 8 Kapitel. Im ersten Kapitel wird eine Übersicht über das Wesen der Kompensation gegeben. Neben einer allgemeinen Definition der Kompensation wird darüber hinaus eine Grundlagenbetrachtung vorgenommen, um Grundlagenwissen speziell zur Kompensationsbetrachtung aufzufrischen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Gründen, Arten, Auswirkungen, Möglichkeiten und Richtlinien der Kompensation. Im dritten Kapitel werden erste Berechnungen zum Asynchronmotor ohne Kompensation vorgenommen.
Theoretische Berechnungen zur Kompensation folgen im anschließenden vierten Kapitel, welche im fünften Kapitel mittels eines Versuchsaufbaus praktisch umgesetzt werden.
Im sechsten Kapitel werden ausführliche Betrachtungen zum Asynchronmotor vorgenommen. Dabei werden unter anderem statische Motordaten erfasst.
Das folgende siebente Kapitel beschäftigt sich mit der Anlagenbestimmung, in der der Versuchsmotor anhand eines Beispiels in eine bestehende Anlage eingebunden wird.
Im Kapitel acht werden Kosten- und Nutzenfaktoren einer Blindstromkompensation verglichen. Niedergeschriebene Zusammenhänge und Formelbeziehungen dienen der Vereinfachung, diese Faktoren entsprechend auszuloten und ökonomisch sinnvolle Entscheidungen in Bezug auf den Einsatz einer eventuellen Blindstromkompensationsanlage zu treffen.
Das neunte und gleichzeitig letzte Kapitel beschäftigt sich mit den Arten von Kompensationskondensatoren, wobei verstärkt auf PCB-haltige Kondensatoren eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wesen der Kompensation
- 1.1 Übertragung und rationelle Anwendung elektrischer Energie
- 1.2 Definition von Kompensation
- 1.3 Grundlagenbetrachtung zur Kompensation
- 1.3.1 Wirkwiderstand, induktiver Blindwiderstand, kapazitiver Blindwiderstand und Scheinwiderstand
- 1.3.2 Wirkstrom, induktiver Blindstrom und kapazitiver Blindstrom
- 1.3.2.1 Äquivalente Schaltungen
- 1.3.3 Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Leistungsfaktor cos φ
- 1.3.3.1 Wirkleistung
- 1.3.3.2 Blindleistung
- 1.3.3.3 Wirk- und induktive Blindleistung
- 1.3.3.4 Scheinleistung
- 1.3.3.5 Leistungsfaktor cos φ
- 1.3.4 Drehstrom (dreiphasiger Wechselstrom)
- 1.3.4.1 Entstehung des Drehstromes
- 1.3.4.2 Phasenverkettung
- 1.3.4.3 Verkettung
- 1.3.5 Wirkungsgrad
- 2 Gründe, Arten, Auswirkungen, Möglichkeiten und Richtlinien der Kompensation (laut TAB und EVU)
- 2.1 Gründe der Kompensation
- 2.2 Kompensationsarten
- 2.3 Auswirkungen und Möglichkeiten der Kompensation
- 2.4 Richtlinien der Kompensation laut TAB und EVU
- 3 Berechnungen zum Anschluss eines Asynchronmotors ohne Kompensation und äquivalente Schaltungsbetrachtung
- 3.1 Asynchronmotor in Dreieckbeschaltung
- 3.2 Asynchronmotor in Sternbeschaltung
- 3.3 Berechnung der induktiven und wirksamen Stromanteile im Motorstrang, mit Hilfe der äquivalenten Schaltung
- 3.3.1 Motor in Dreieckschaltung
- 3.3.2 Motor in Sternschaltung
- 4 Berechnungen zur Kompensation eines Asynchronmotors (Vergleich Kompensation auf: cos φ = 0,9; auf cos φ = 1; auf cos φ = -0,9 (überkompensiert))
- 5 Praktische Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse im Laborversuch
- 5.1 Schaltungs- und Versuchsaufbau
- 5.2 Vergleich und Auswertung der gemessenen und berechneten Messdaten (Kompensation von cos φ = 0,7 auf cos φ = 0,9)
- 5.2.1 Tabellarischer Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Kompensation von Drehstrommotoren. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Kompensation zu erläutern und anhand von Berechnungen und einem Laborversuch die Auswirkungen verschiedener Kompensationsgrade auf den Stromverbrauch und den Leistungsfaktor zu demonstrieren.
- Grundlagen der Drehstromtechnik und Kompensation
- Berechnung der Kompensationswerte für verschiedene Szenarien
- Auswirkungen der Kompensation auf den Leistungsfaktor
- Vergleich von theoretischen Berechnungen und praktischen Messergebnissen
- Analyse verschiedener Kompensationsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Wesen der Kompensation: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der Kompensation von Drehstrommotoren. Es erklärt die Übertragung elektrischer Energie, definiert den Begriff der Kompensation und beschreibt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Wirkwiderstand, Blindwiderstand und Scheinwiderstand sowie den entsprechenden Strömen und Leistungen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Drehstromsystem und der Berechnung des Leistungsfaktors gewidmet, da dies entscheidend für die Effizienz der Kompensation ist. Die Kapitelteile beleuchten detailliert die einzelnen Komponenten des Stromkreises und deren Wechselwirkungen.
2 Gründe, Arten, Auswirkungen, Möglichkeiten und Richtlinien der Kompensation (laut TAB und EVU): Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Aspekten der Kompensation. Es werden die Gründe für die Kompensation von Blindleistung erläutert, verschiedene Kompensationsarten vorgestellt und die Auswirkungen einer optimalen oder suboptimalen Kompensation diskutiert. Es bezieht sich auf Richtlinien und Vorschriften von technischen Anschlussbedingungen (TAB) und Energieversorgungsunternehmen (EVU), um den gesetzlichen Rahmen zu beleuchten und die Notwendigkeit einer fachgerechten Kompensation hervorzuheben. Die Bedeutung der Einhaltung dieser Richtlinien wird für die Wirtschaftlichkeit und die Sicherheit des Betriebs betont.
3 Berechnungen zum Anschluss eines Asynchronmotors ohne Kompensation und äquivalente Schaltungsbetrachtung: In diesem Kapitel werden Berechnungen zum Anschluss eines Asynchronmotors ohne Kompensation durchgeführt. Es werden sowohl Dreieck- als auch Sternschaltungen betrachtet, und mithilfe äquivalenter Schaltungen werden die induktiven und wirksamen Stromanteile im Motorstrang ermittelt. Diese Berechnungen bilden die Basis für den Vergleich mit den später durchgeführten Kompensationsberechnungen, um die Effekte der Kompensation deutlich zu machen. Die detaillierte Analyse der Stromverläufe in beiden Schaltungsarten ist zentral für das Verständnis des Kapitels.
4 Berechnungen zur Kompensation eines Asynchronmotors: Dieses Kapitel ist das Herzstück der Arbeit und beschreibt detailliert die Berechnungen zur Kompensation eines Asynchronmotors. Es werden verschiedene Kompensationsgrade (cos φ = 0,9; cos φ = 1; cos φ = -0,9) simuliert, wobei sowohl Dreieck- als auch Sternschaltungen betrachtet werden. Für jede Kompensationsstufe werden die notwendigen Kondensatorwerte berechnet und die Auswirkungen auf die Ströme (Kapazitiver Strangstrom, kapazitiver Leiterstrom, Leiterstrom des Motors und Gesamtleiterstrom) analysiert. Die detaillierten Berechnungen zeigen die Auswirkungen der Kompensation auf die Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung auf.
5 Praktische Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse im Laborversuch: Dieses Kapitel beschreibt den praktischen Teil der Arbeit, die Durchführung eines Laborversuchs zur Kompensation eines Asynchronmotors. Der Aufbau des Versuchs und die gemessenen Daten werden dokumentiert und mit den theoretischen Berechnungen aus Kapitel 4 verglichen. Die Auswertung der Messergebnisse liefert Informationen über die Genauigkeit der Berechnungen und die praktische Anwendbarkeit der theoretischen Erkenntnisse. Eine tabellarische Gegenüberstellung der berechneten und gemessenen Werte ermöglicht eine fundierte Bewertung des Experiments.
Schlüsselwörter
Kompensation, Drehstrommotor, Blindleistung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, cos φ, Asynchronmotor, Dreieckschaltung, Sternschaltung, Kondensator, äquivalente Schaltung, Berechnungen, Laborversuch, Messdaten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Kompensation von Drehstrommotoren
Was ist das Thema dieser Projektarbeit?
Die Projektarbeit befasst sich mit der Kompensation von Drehstrommotoren. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Kompensation zu erläutern und anhand von Berechnungen und einem Laborversuch die Auswirkungen verschiedener Kompensationsgrade auf den Stromverbrauch und den Leistungsfaktor zu demonstrieren.
Welche Inhalte werden in der Projektarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die theoretischen Grundlagen der Drehstromtechnik und Kompensation, Berechnungen der Kompensationswerte für verschiedene Szenarien (u.a. Asynchronmotor in Dreieck- und Sternschaltung, mit verschiedenen cos φ Werten), die Auswirkungen der Kompensation auf den Leistungsfaktor, einen Vergleich von theoretischen Berechnungen und praktischen Messergebnissen aus einem Laborversuch sowie eine Analyse verschiedener Kompensationsmethoden.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und was sind deren Schwerpunkte?
Kapitel 1 erläutert das Wesen der Kompensation, einschließlich der Grundlagen von Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie Drehstromsystemen. Kapitel 2 behandelt die Gründe, Arten, Auswirkungen, Möglichkeiten und Richtlinien der Kompensation gemäß TAB und EVU. Kapitel 3 beschreibt Berechnungen zum Anschluss eines Asynchronmotors ohne Kompensation. Kapitel 4 zeigt Berechnungen zur Kompensation eines Asynchronmotors für verschiedene cos φ Werte (0,9; 1; -0,9). Kapitel 5 dokumentiert die praktische Umsetzung im Laborversuch, inklusive Schaltungsaufbau, Messungen und Vergleich mit den berechneten Daten.
Welche Berechnungen werden durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet Berechnungen zur Bestimmung der induktiven und wirksamen Stromanteile in Asynchronmotoren (Dreieck- und Sternschaltung), Berechnungen zur Kompensation des Asynchronmotors für verschiedene Leistungsfaktoren (cos φ = 0,9; cos φ = 1; cos φ = -0,9), sowie die Berechnung der benötigten Kondensatorwerte für die Kompensation.
Wie wird der Laborversuch beschrieben?
Der Laborversuch umfasst den Aufbau einer Schaltung zur Kompensation eines Asynchronmotors, die Durchführung von Messungen und den Vergleich der gemessenen Daten mit den theoretischen Berechnungen. Eine tabellarische Gegenüberstellung der Ergebnisse ermöglicht eine Bewertung der Genauigkeit der Berechnungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Projektarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kompensation, Drehstrommotor, Blindleistung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, cos φ, Asynchronmotor, Dreieckschaltung, Sternschaltung, Kondensator, äquivalente Schaltung, Berechnungen, Laborversuch, Messdaten, TAB, EVU.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit den Grundlagen der Elektrotechnik und insbesondere der Kompensation von Drehstrommotoren befassen möchten. Sie eignet sich für Studierende, Auszubildende und Fachkräfte im Bereich der Elektrotechnik.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Inhalt der einzelnen Kapitel?
Die detaillierten Inhalte der einzelnen Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis der Projektarbeit (siehe oben) und in den Kapitelzusammenfassungen im Dokument selbst aufgeführt.
- Quote paper
- Jens Schlender (Author), Andreas Renner (Author), 2003, Kompensation von Drehstrommotoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27823