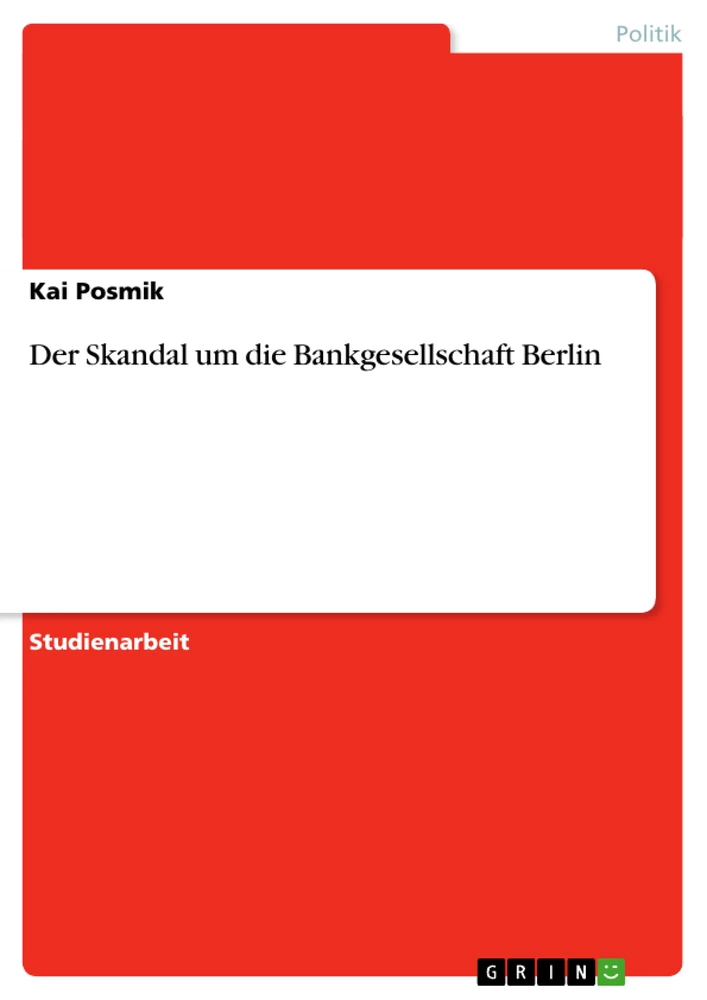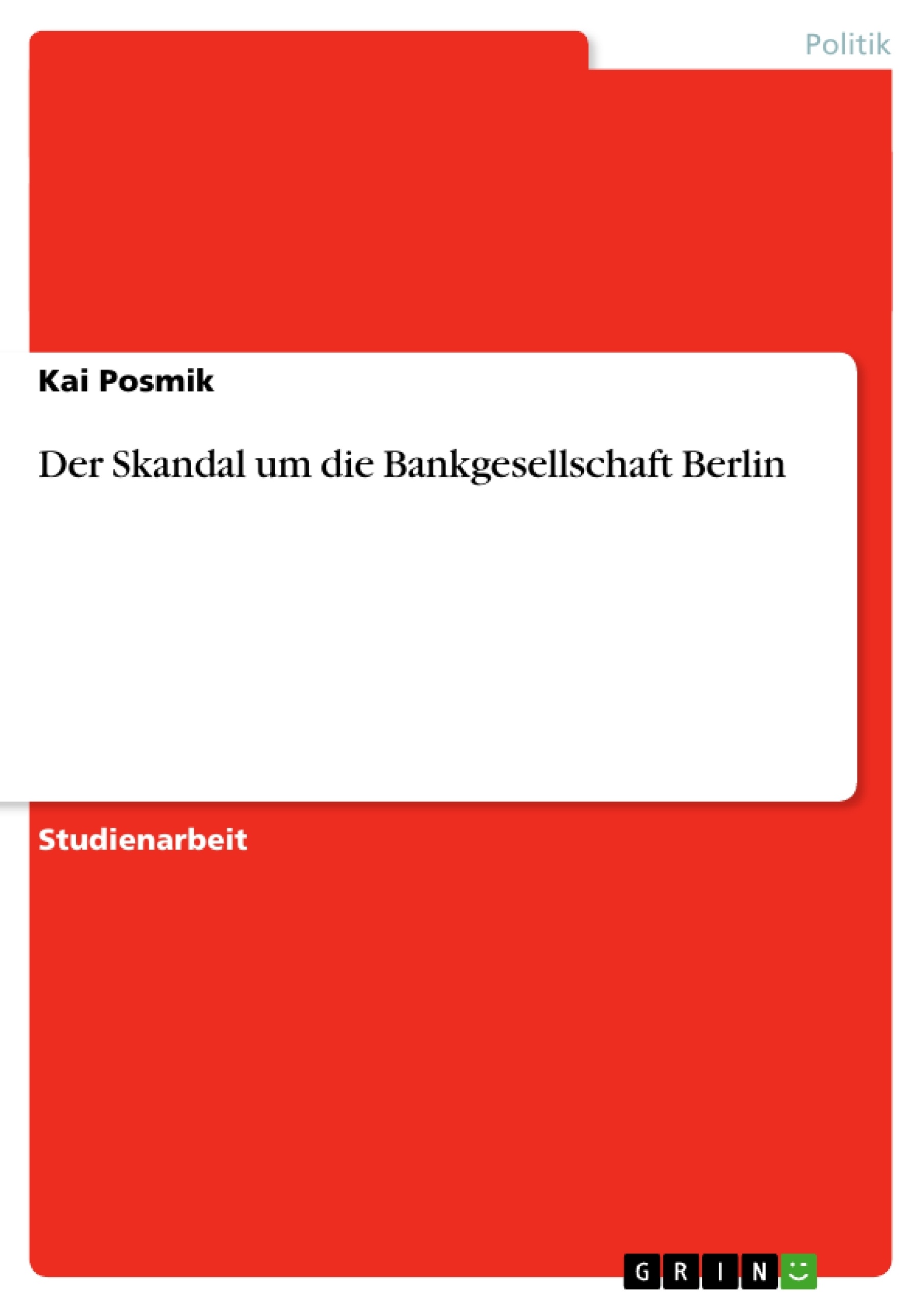Die Bürger der Stadt Berlin sind wahrlich nicht zu beneiden. Zunächst der rasante Aufstieg zur, zumindest europäischen, Metropole, zu einer Stadt in der die Einwohnerzahl von deutlich unter einer halben Million noch im Jahre 1850 auf über 4,2 Mio. in 1933 anstieg 1 , in der sich Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, wie in keiner anderen Stadt des europäischen Kontinents entwickelten 2 . Dann der noch rasantere Niedergang. Zwölf unsägliche Jahre eines menschenverachtenden Regimes waren nur nötig, bis die Physis und die Psyche der Stadt zerstört waren. Nichts war 1945 mehr übrig vom Berlin vor der Nazi-Zeit. Und diese zwölfjährige Demütigung sollte noch fortdauern: Aufgeteilt in vier Besatzungszonen fremder Länder, aus denen später de facto zwei Zonen werden sollten. Zwei Zonen, die zwei scheinbar unversöhnliche politische Blöcke symbolisierten, welche die Welt aufgeteilt hatten und sich, praktisch mit Blickkontakt, auf nur wenigen Quadratkilometern gegenüberstanden.
Und nachdem es um ganz Berlin in Folge des Viermächte-Abkommens vom Herbst 1971 zunehmend ruhiger wurde, konnte sich, zunächst begrenzt auf West-Berlin, nach der Wende auch in der ganzen Stadt, ein neues Berlin entwickeln: Das Berlin der politischen Affären und des Filzes, ein Berlin, das die Bürger dieser Stadt nicht verdient haben. Neben unzähligen “Skandälchen“ quer durch alle Berliner Parteien, gab es in der Stadt regelmäßig aufsehenerregende und folgenschwere politische Skandale: Im Zuge der sogenannten “Garski-Affäre“ musste 1981 der Senat um Bürgermeister Dietrich Stobbe (SPD) zurücktreten 3 , aufgrund vorgezogener Neuwahlen, wurden die Abgeordneten der SPD - erstmals seit 1948 - in die Opposition geschickt 4 . Als der Baustadtrat und Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Charlottenburg, Wolfgang Antes, 1985 zugeben musste, hohe Bestechungsgelder angenommen zu haben, hatte Berlin seinen nächsten großen Skandal. Bald ging es nicht mehr nur um Antes selbst, auch andere CDU-Politiker, allen voran der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen, waren involviert 5 . Auch dieser Affäre wegen, wurde die CDU-F.D.P.-Koalition im Januar 1989 von den West-Berliner Bürgern abgewählt. Die neuste und in ihren politischen und vor allem finanziellen Auswirkungen meistbedeutende Affäre, will die vorliegenden Arbeit untersuchen: Der Skandal um die Milliardenverluste bei der Bankgesellschaft Berlin.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B. Die Bankgesellschaft Berlin
- B. I. Gründung und Konzernstruktur
- B. II. Geschäftsgegenstand
- C. Chronik eines Skandales
- C. I. Das "Vorspiel" – Eine Bank wird gegründet
- C. I. 1. Eine blühende Bank für blühende Landschaften?
- C. I. 2. Der West-Berliner Gründungsclub
- C. II. Grundsteinlegung einer Katastrophe – Vorgänge bis Ende 2000
- C. II. 1. Die Rundum-Sorglos-Fonds der BGB
- C. II. 2. Das ganz spezielle Angebot – Die Prominentenfonds
- C. II. 3. Ein Freund ein guter Freund
- C. III. Das Kartenhaus fällt zusammen
- C. I. Das "Vorspiel" – Eine Bank wird gegründet
- D. Die Folgen für das Land Berlin
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Skandal um die Milliardenverluste der Bankgesellschaft Berlin (BGB). Sie beleuchtet die Gründungsgeschichte der BGB, ihre Konzernstruktur und ihren Geschäftsgegenstand, insbesondere das Engagement im Immobiliengeschäft. Im Fokus stehen die Ereignisse, die zum finanziellen Desaster führten, sowie die daraus resultierenden Folgen für Berlin.
- Gründung und Struktur der Bankgesellschaft Berlin
- Das Geschäftsmodell der BGB, insbesondere der Bereich Immobiliengeschäft und geschlossene Fonds
- Die Rolle politischer Entscheidungsträger bei der Gründung und im Verlauf der Ereignisse
- Die finanziellen Risiken und die Entstehung der Verluste
- Die Konsequenzen des Skandals für Berlin
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext Berlins – vom Aufstieg zur Metropole über die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und die Teilung bis hin zur Wiedervereinigung und den folgenden politischen Skandalen. Sie führt in das Thema des Skandals um die Bankgesellschaft Berlin ein und formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit: die Gründungsgeschichte der BGB, ihr Geschäftsmodell, die Ursachen der finanziellen Schwierigkeiten, die Profiteure und die Folgen für Berlin.
B. Die Bankgesellschaft Berlin: Dieses Kapitel beschreibt die Gründung der Bankgesellschaft Berlin (BGB) im Jahr 1994 unter maßgeblicher Beteiligung von prominenten Politikern. Es erläutert die Konzernstruktur, die Zusammenführung der Landesbank Berlin mit weiteren Banken und die Aktienanteile der verschiedenen Eigentümer, wobei das Land Berlin den größten Anteil hält. Die Rolle von Klaus-Rüdiger Landowsky und Dr. Ditmar Staffelt in der Führungsstruktur wird hervorgehoben.
B. II. Geschäftsgegenstand: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Geschäftsfelder der BGB, die sich in Retail Banking, Wholesale Banking und Immobiliengeschäft unterteilen. Es erklärt detailliert das Prinzip geschlossener Immobilienfonds, die steuerlichen Vorteile für Anleger mit hohem Einkommen und die Bedeutung dieses Geschäftsmodells für die Entwicklung der finanziellen Probleme der BGB. Die Rolle der BerlinHyp und der Bavaria Objekt- und Betreuung GmbH bei der Emission dieser Fonds wird beschrieben.
C. Chronik eines Skandales: Dieses Kapitel, aufgeteilt in drei Unterkapitel, behandelt die Entwicklung des Skandals. Es analysiert die Vorgänge im Vorfeld der Krise, untersucht die Rolle der verschiedenen Akteure und die Mechanismen, die zu den massiven Verlusten führten. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Finanzprodukte und deren Risiken. Das dritte Unterkapitel behandelt schließlich den Zusammenbruch des Systems und die Folgen.
D. Die Folgen für das Land Berlin: Dieses Kapitel wird die finanziellen und politischen Folgen des Skandals für Berlin untersuchen. Es wird die Auswirkungen auf die Stadtfinanzen analysieren und potentiell die politischen Konsequenzen beleuchten, die sich aus den finanziellen Verlusten ergaben. Diese Analyse wird die langfristigen Auswirkungen des Skandals auf das Vertrauen in die Berliner Politik und Verwaltung in den Blick nehmen.
Schlüsselwörter
Bankgesellschaft Berlin (BGB), geschlossene Immobilienfonds, Landesbank Berlin, Berliner Bank, politische Affären, Finanzskandal, Steueroptimierung, Risikomanagement, Immobilienmarkt, Berlin, politische Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bankgesellschaft Berlin (BGB)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Skandal um die Milliardenverluste der Bankgesellschaft Berlin (BGB). Sie beleuchtet die Gründungsgeschichte der BGB, ihre Konzernstruktur und ihren Geschäftsgegenstand, insbesondere das Engagement im Immobiliengeschäft. Im Fokus stehen die Ereignisse, die zum finanziellen Desaster führten, sowie die daraus resultierenden Folgen für Berlin.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gründung und Struktur der BGB, ihr Geschäftsmodell (insbesondere geschlossene Immobilienfonds), die Rolle politischer Entscheidungsträger, die finanziellen Risiken und die Entstehung der Verluste, sowie die Konsequenzen des Skandals für Berlin. Die Kapitel befassen sich detailliert mit der Chronik des Skandals, beginnend mit der Gründung und der Entwicklung der Krise bis hin zum Zusammenbruch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, ein Kapitel zur Bankgesellschaft Berlin (inkl. Gründung und Geschäftsgegenstand), ein Kapitel zur Chronik des Skandals (unterteilt in Vorspiel, Grundsteinlegung der Katastrophe und den Zusammenbruch), ein Kapitel zu den Folgen für Berlin und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Rolle spielten geschlossene Immobilienfonds?
Geschlossene Immobilienfonds spielten eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell der BGB und waren maßgeblich an der Entstehung der finanziellen Probleme beteiligt. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise dieser Fonds, ihre steuerlichen Vorteile und die damit verbundenen Risiken.
Welche Bedeutung hatten politische Entscheidungsträger?
Die Arbeit untersucht die Rolle politischer Entscheidungsträger bei der Gründung der BGB und im Verlauf der Ereignisse. Der Einfluss und die Verantwortung prominenter Politiker werden analysiert.
Welche Folgen hatte der Skandal für Berlin?
Die Arbeit analysiert die finanziellen und politischen Folgen des Skandals für Berlin, einschließlich der Auswirkungen auf die Stadtfinanzen und das Vertrauen in die Berliner Politik und Verwaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bankgesellschaft Berlin (BGB), geschlossene Immobilienfonds, Landesbank Berlin, Berliner Bank, politische Affären, Finanzskandal, Steueroptimierung, Risikomanagement, Immobilienmarkt, Berlin, politische Verantwortung.
Wo finde ich weitere Informationen zum Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis ist im Dokument aufgeführt und enthält detaillierte Unterkapitel, die die einzelnen Aspekte des Skandals um die BGB vertiefen.
- Quote paper
- Kai Posmik (Author), 2003, Der Skandal um die Bankgesellschaft Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27801