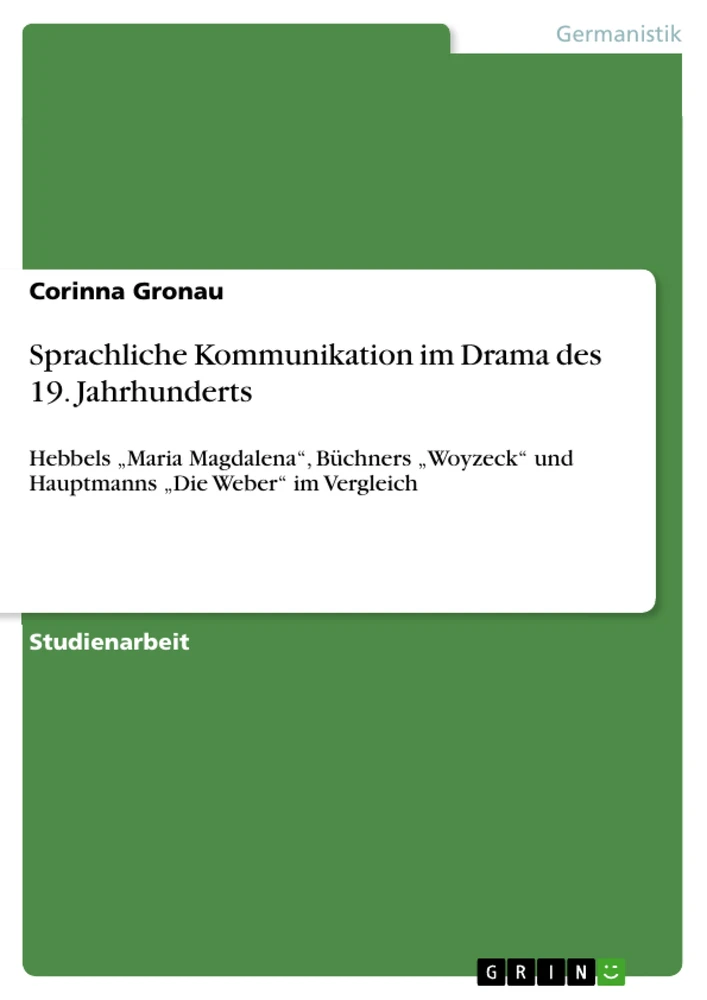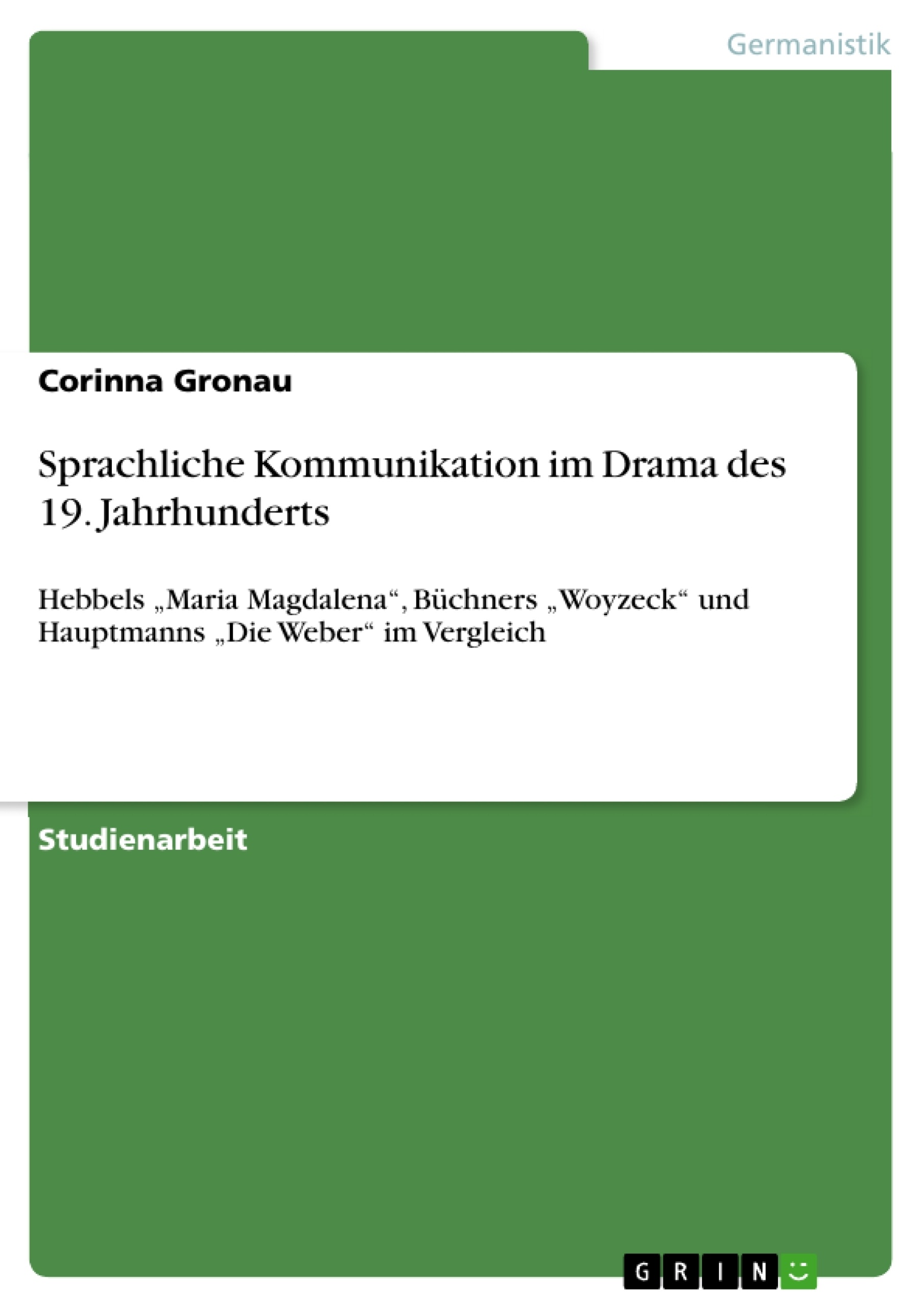Im 19. Jahrhundert stand das Drama an der Spitze der Dichtung. Diese Hochschätzung führte zu einer vermehrten Produktion von Dramen und zu einem ansteigenden Bau von Theatern.
Die Allgegenwart klassischer Vorbilder - die deutsche Klassik vertreten durch Schiller, Goethe und Lessing, Shakespeare mit seinen historischen Dramen und die antike Tragödie -kommt im Epigonenbewusstsein der Dramatiker, zum Beispiel bei Grillparzer oder Grabbe zum Vorschein. Dennoch ist auch eine schrittweise Modernisierung des Dramas zu konstatieren. Der Wandel, der sich vollzieht, führt vom eingreifend handelnden Menschen, über „leeres Heldenspiel“ bis zum Endpunkt der Reflexion, an dem die restlose Determination des Individuums steht.
Thematisch vollzieht sich eine Abkehr vom adeligen Personal, indem der Mittelstand bzw. die unteren Stände und Klassen tragikfähig werden. Die soziale Lage bedingt nun den Konflikt.
Hauptmann gilt als Fazit der Entwicklung des Dramas im 19. Jahrhundert. Sein Werk vereint alle Innovationen der Epoche, vor allem ästhetischer Art. Doch wie sehen diese Neuerungen auf dem Gebiet der sprachlichen Kommunikation aus?
In der vorliegenden Arbeit sollen die Veränderungen der Figurenrede anhand drei ausgesuchter Dramen aufgezeigt werden. Mit Friedrich Hebbels „Maria Magdalena“, zur Gattung des bürgerlichen Trauerspiels gehörend, geht die Abwendung von der heroischen Tragödie einher und damit auch vom Versdrama. Die „natürliche Sprache des Herzens“ soll nun in Prosa wiedergegeben werden. „Woyzeck“ von Georg Büchner markiert die Schnittstelle zwischen bürgerlichem Trauerspiel und sozialem Drama. Indem die Sprachautonomie des Subjekts aufgehoben wird, verändert sich die Kommunikation im Drama grundlegend. Mit Gerhart Hauptmanns „Die Weber“ kommt ein naturalistisches Sozialdrama der 1890er Jahre in den Blick, bei dem es zur Ausdifferenzierung eines milieugebundenen Sprechens kommt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprachliche Kommunikation im Drama
- 2.1 Dramenspezifische Eigenheiten
- 2.1.1 „Maria Magdalena“ - Reflexionsmonolog
- 2.1.2 „Woyzeck“ - Fragmentarischer Sprachstil
- 2.1.3 „Die Weber“ - Sprache der Gebärden
- 2.2 Vergleichende Gegenüberstellung
- 2.2.1 Verbale Kommunikation
- 2.2.2 Nonverbale Kommunikation
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen der Figurenrede im Drama des 19. Jahrhunderts anhand dreier ausgewählter Stücke: Hebbels „Maria Magdalena“, Büchners „Woyzeck“ und Hauptmanns „Die Weber“. Ziel ist es, die Entwicklung der sprachlichen Kommunikation im Drama aufzuzeigen, ausgehend vom bürgerlichen Trauerspiel bis hin zum naturalistischen Sozialdrama. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel und deren Funktion in der Charakterisierung der Figuren und der Darstellung des sozialen Kontextes.
- Entwicklung der Figurenrede im 19. Jahrhundert
- Vergleich verschiedener dramatischer Gattungen (bürgerliches Trauerspiel, soziales Drama, Naturalismus)
- Die Rolle von verbaler und nonverbaler Kommunikation
- Analyse sprachlicher Stilmittel und deren Wirkung
- Zusammenhang zwischen Sprache und sozialer Lage der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufschwung des Dramas im 19. Jahrhundert, die Bedeutung klassischer Vorbilder und den Wandel vom handelnden Helden hin zur Reflexion der individuellen Determination. Sie führt die thematische Abkehr vom Adel hin zu den unteren Ständen als tragikfähiges Personal ein und bezeichnet Hauptmann als Höhepunkt dieser Entwicklung. Die Arbeit kündigt die Analyse der Figurenrede in drei ausgewählten Dramen an: Hebbels "Maria Magdalena", Büchners "Woyzeck" und Hauptmanns "Die Weber".
2. Sprachliche Kommunikation im Drama: Dieses Kapitel untersucht die dramenspezifischen Eigenheiten der sprachlichen Kommunikation in den drei ausgewählten Dramen. Es gliedert sich in die Analyse der einzelnen Stücke und eine vergleichende Gegenüberstellung der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Die Analyse beleuchtet die jeweiligen sprachlichen Mittel und ihren Einfluss auf die Charakterisierung der Figuren und die Darstellung sozialer Kontexte.
2.1 Dramenspezifische Eigenheiten: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Analyse der sprachlichen Eigenheiten in den drei ausgewählten Dramen. Er untersucht die Unterschiede in der Sprache und wie diese die jeweilige Handlung und Charaktere beeinflusst. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der sprachlichen Entwicklung vom bürgerlichen Trauerspiel zum naturalistischen Sozialdrama.
2.1.1 „Maria Magdalena“ - Reflexionsmonolog: Die Analyse von Hebbels „Maria Magdalena“ konzentriert sich auf den Einsatz von Prosa anstelle des Blankverses, den Monologen der Figuren und die Verwendung rhetorischer Mittel. Die detaillierte Untersuchung der sprachlichen Gestaltung zeigt, wie Hebbel durch verschachtelte Satzstrukturen, Metaphern und Aposiopesen die innere Zerrissenheit und die emotionale Verfassung der Figuren, insbesondere Klaras, zum Ausdruck bringt. Die Monologe bieten Einblicke in das Innere der Figuren, während der Dialog oft unterbrochen und von Reflexionen geprägt ist. Die Analyse beleuchtet auch die Verwendung von Beiseitesprechen als stilistisches Mittel, um dem Publikum Einblicke in die unbewussten Regungen der Figuren zu gewähren.
Schlüsselwörter
Drama, 19. Jahrhundert, Sprachliche Kommunikation, Figurenrede, bürgerliches Trauerspiel, soziales Drama, Naturalismus, Hebbel, Büchner, Hauptmann, „Maria Magdalena“, „Woyzeck“, „Die Weber“, Reflexionsmonolog, verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Stilmittel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Sprachliche Kommunikation im Drama des 19. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der sprachlichen Kommunikation im Drama des 19. Jahrhunderts anhand der Dramen "Maria Magdalena" (Hebbel), "Woyzeck" (Büchner) und "Die Weber" (Hauptmann). Der Fokus liegt auf der Figurenrede und deren Funktion in der Charakterisierung und Darstellung des sozialen Kontextes.
Welche Dramen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei Schlüsselwerke des 19. Jahrhunderts: Friedrich Hebbels "Maria Magdalena", Georg Büchners "Woyzeck" und Gerhart Hauptmanns "Die Weber". Diese Dramen repräsentieren unterschiedliche dramatische Gattungen und Entwicklungsstufen des Dramas im 19. Jahrhundert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Figurenrede im 19. Jahrhundert, den Vergleich verschiedener dramatischer Gattungen (bürgerliches Trauerspiel, soziales Drama, Naturalismus), die Rolle von verbaler und nonverbaler Kommunikation, die Analyse sprachlicher Stilmittel und deren Wirkung sowie den Zusammenhang zwischen Sprache und sozialer Lage der Figuren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur sprachlichen Kommunikation im Drama mit Unterkapiteln zur Analyse der einzelnen Dramen und einem Vergleich der Kommunikationsformen, und ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt.
Was sind die dramenspezifischen Eigenheiten der analysierten Stücke?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen sprachlichen Eigenheiten der drei Dramen. Bei "Maria Magdalena" wird der Fokus auf Reflexionsmonologe und rhetorische Mittel gelegt, "Woyzeck" zeichnet sich durch einen fragmentarischen Sprachstil aus, und "Die Weber" verwendet die Sprache der Gebärden als wichtiges Element.
Welche sprachlichen Mittel werden analysiert?
Die Analyse umfasst verschiedene sprachliche Mittel, darunter Monologe, Dialoge, rhetorische Figuren (Metaphern, Aposiopesen), Satzstrukturen, Beiseitesprechen und die Verwendung von Prosa anstatt Blankvers. Es wird untersucht, wie diese Mittel die Charakterisierung der Figuren und die Darstellung der sozialen Kontexte beeinflussen.
Wie werden verbale und nonverbale Kommunikation verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Formen der verbalen und nonverbalen Kommunikation in den drei Dramen und untersucht deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation der Stücke. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kommunikation im Drama aufzeigen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zeigt die Entwicklung der sprachlichen Kommunikation im Drama des 19. Jahrhunderts auf. Es wird die Bedeutung der Sprache für die Charakterisierung der Figuren und die Darstellung des sozialen Kontextes hervorgehoben. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im vorliegenden Auszug nicht enthalten.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Drama, 19. Jahrhundert, Sprachliche Kommunikation, Figurenrede, bürgerliches Trauerspiel, soziales Drama, Naturalismus, Hebbel, Büchner, Hauptmann, „Maria Magdalena“, „Woyzeck“, „Die Weber“, Reflexionsmonolog, verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, Stilmittel.
- Quote paper
- Corinna Gronau (Author), 2010, Sprachliche Kommunikation im Drama des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277909