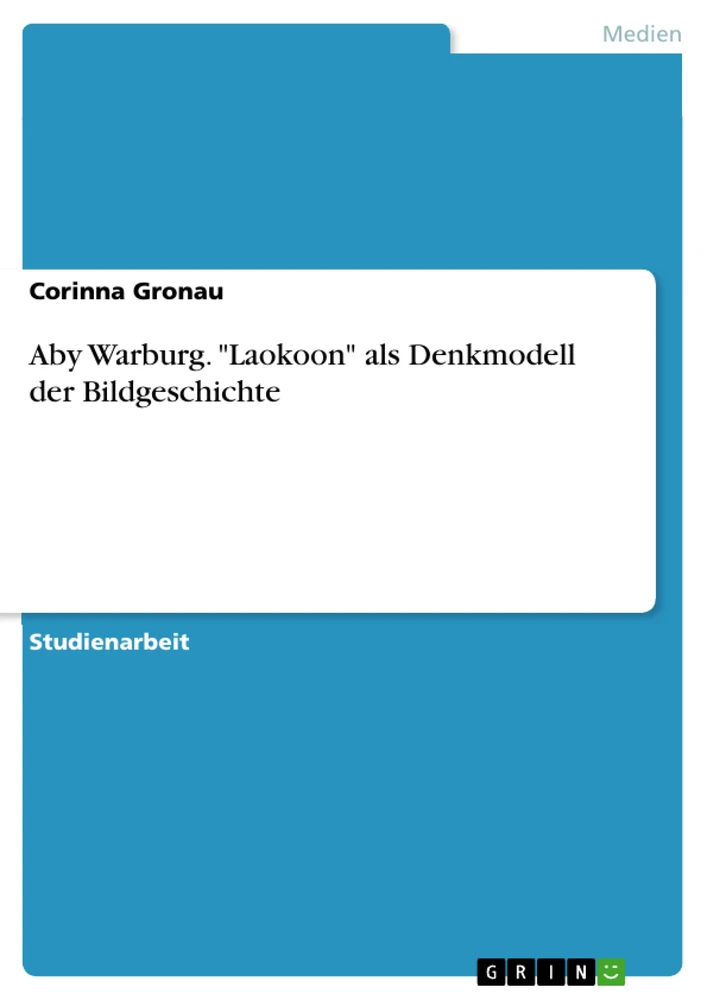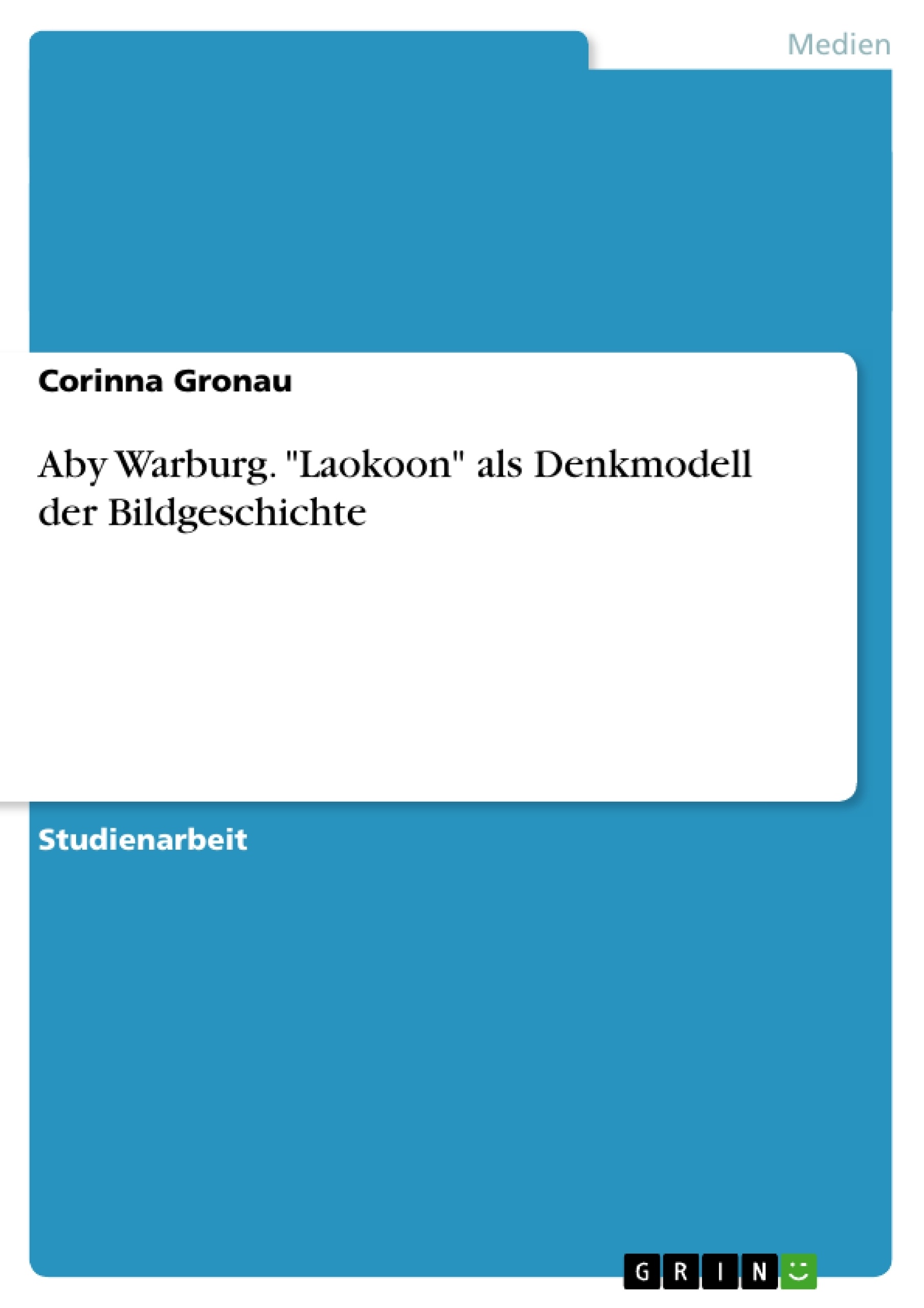Aus einem einzigen Steinblock schufen <den Laokoon>, seine Söhne und die wunderbaren Windungen der Schlangen nach übereinstimmendem Plan die hervorragenden Künstler Hagesandros, Polydoros und Athenodoros, alle <drei> aus Rhodos.
Dieses Zitat von Plinius dem Älteren stammt aus dessen Enzyklopädie „Naturalia historia“ um 79 n.Chr. und stellt die früheste Erwähnung des Kunstwerkes dar.
Der aus der griechischen und römischen Mythologie stammende trojanische Poseidonpriester Laokoon wurde in Vergils „Aeneis“ mitsamt seiner zwei Söhne von zwei Schlangen getötet, nachdem er die Trojaner vor der List der Griechen, dem Trojanischen Pferd, gewarnt hat. Die Trojaner sahen darin die Strafe der Götter für die Entweihung des Geschenkes, was letztlich zum Untergang Trojas führte. Die oben erwähnte Plastik zeigt Laokoon und seine beiden Söhne im Todeskampf mit den Schlangen (siehe Abb. 1).
Bis 1506 blieb die antike Skulptur aus der Zeit des Hellenismus verschollen. Nach der Wiederentdeckung begann eine Phase der intensiven künstlerischen Auseinandersetzung: Künstler zeichneten die Gruppe und fertigten Stiche, sowie Skulpturen in Bronze und Marmor.
Im 18. Jahrhundert setzte dann mit Winckelmanns „Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst“ die intensive literarische Beschäftigung mit der Laokoon-Gruppe durch Dichter wie Goethe, Lessing und Schiller ein, wodurch die Plastik besondere Bedeutung für die Ästhetik der deutschen Aufklärung und der Weimarer Klassik gewann .
Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jh. findet die Skulptur wieder Beachtung, und zwar in den Arbeiten des Hamburger Kunsthistorikers Aby Warburg. Warburg beschäftigte sich intensiv mit dem „Nachleben der Antike“ in der florentinischen Kunst der Frührenaissance, unter anderem auch am Beispiel der
Laokoon-Gruppe.
In der vorliegenden Arbeit sollen anhand ausgesuchter Tafeln des Mnemosyne-Atlas, dem letzten Großprojekt Warburgs, die Ideen und das methodische Vorgehen Warburgs beleuchtet werden. Dabei wird der Fokus auf den künstlerischen Darstellungen des Laokoon liegen und deren Bedeutung für die Bildgeschichte herausgearbeitet. Einleitend soll die Wirkung von Lessings Schrift „Laokoon“ für Warburgs Denken und seine Theoriebildung untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lessings „Laokoon“ als Denkanstoß
- Der Mnemosyne-Atlas
- Kurze Einführung
- Tafel 4-8
- „Urworte menschlicher Gebärdensprache“
- Tafel 6: tragisches Pathos: vom Menschenopfer bis zum Totentanz
- Tafel 41 und 41a
- Die Rolle vorgeprägter antiker Ausdrucksgebärden in der Kunst der Renaissance
- Tafel 41a: Laokoon – Leidenspathos
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Aby Warburgs Ideen und methodisches Vorgehen im Rahmen seines letzten Großprojekts, dem Mnemosyne-Atlas. Der Fokus liegt dabei auf der künstlerischen Darstellung des Laokoon und ihrer Bedeutung für die Bildgeschichte.
- Der Einfluss Lessings „Laokoon“ auf Warburgs Denken und Theoriebildung
- Die Bedeutung der „Urworte der pathetischen Gebärdensprache“
- Die Rolle der Antike in der Kunst der Renaissance
- Die Analyse von Warburgs Bildsammlung im Mnemosyne-Atlas
- Die Frage nach dem „Nachleben der Antike“ in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Laokoon-Gruppe vor und beschreibt ihren historischen Kontext. Sie beleuchtet die Wiederentdeckung der Skulptur und ihre Rezeption in der Kunstgeschichte, insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert.
- Lessings „Laokoon“ als Denkanstoß: Dieser Abschnitt analysiert Lessings Einfluss auf Warburgs Denken und untersucht die Relevanz von Lessings Schrift „Laokoon“ für Warburgs Theorie der „Pathosformeln“
- Der Mnemosyne-Atlas: Kurze Einführung: Dieses Kapitel erläutert die Entstehung und Konzeption von Warburgs Bilderatlas „Mnemosyne“, dessen Ziel es ist, die Frage nach dem Einfluss der Antike auf die Kunst der Renaissance zu beleuchten.
- Der Mnemosyne-Atlas: Tafel 4-8: Hier wird Warburgs Analyse von „Urworten menschlicher Gebärdensprache“ vorgestellt. Die Tafeln 4-8 des Mnemosyne-Atlas zeigen „tragisches Pathos“ in verschiedenen Formen, vom Menschenopfer bis zum Totentanz.
- Der Mnemosyne-Atlas: Tafel 41 und 41a: In diesem Abschnitt werden die Tafeln 41 und 41a des Mnemosyne-Atlas näher betrachtet. Die Rolle antiker Ausdrucksgebärden in der Kunst der Renaissance und die Darstellung von „Leidenspathos“ im Laokoon werden analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Laokoon-Gruppe, Lessings „Laokoon“, Aby Warburgs „Mnemosyne-Atlas“, die „Pathosformeln“, die „Urworte der pathetischen Gebärdensprache“, die Renaissance, die Antike und der Einfluss antiker Ausdrucksgebärden auf die Kunst der Renaissance.
- Quote paper
- Corinna Gronau (Author), 2010, Aby Warburg. "Laokoon" als Denkmodell der Bildgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277871