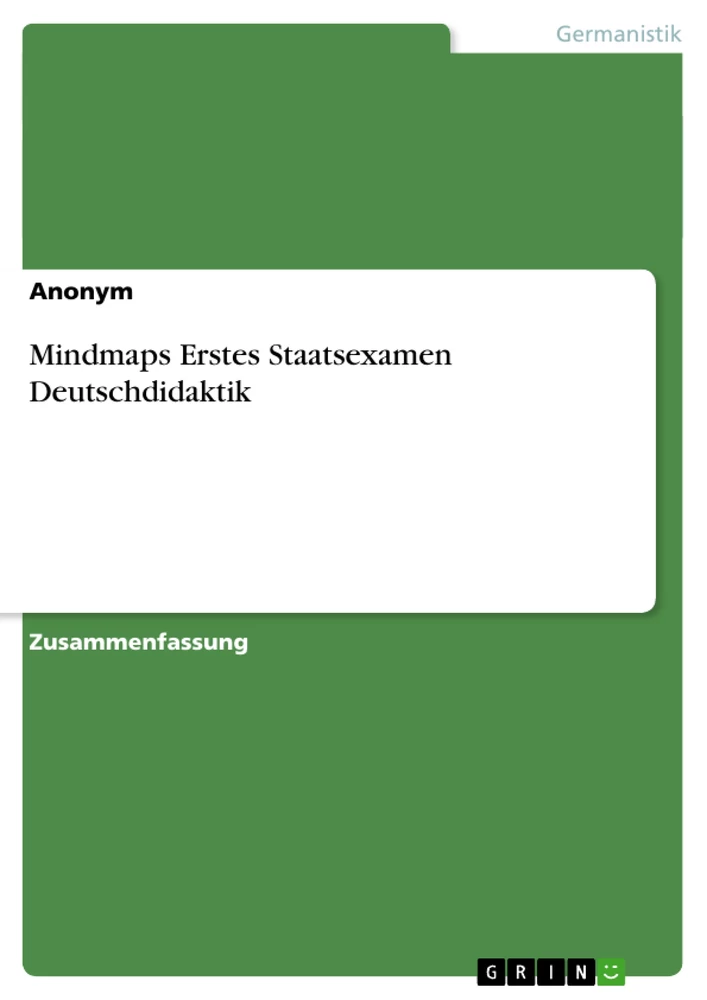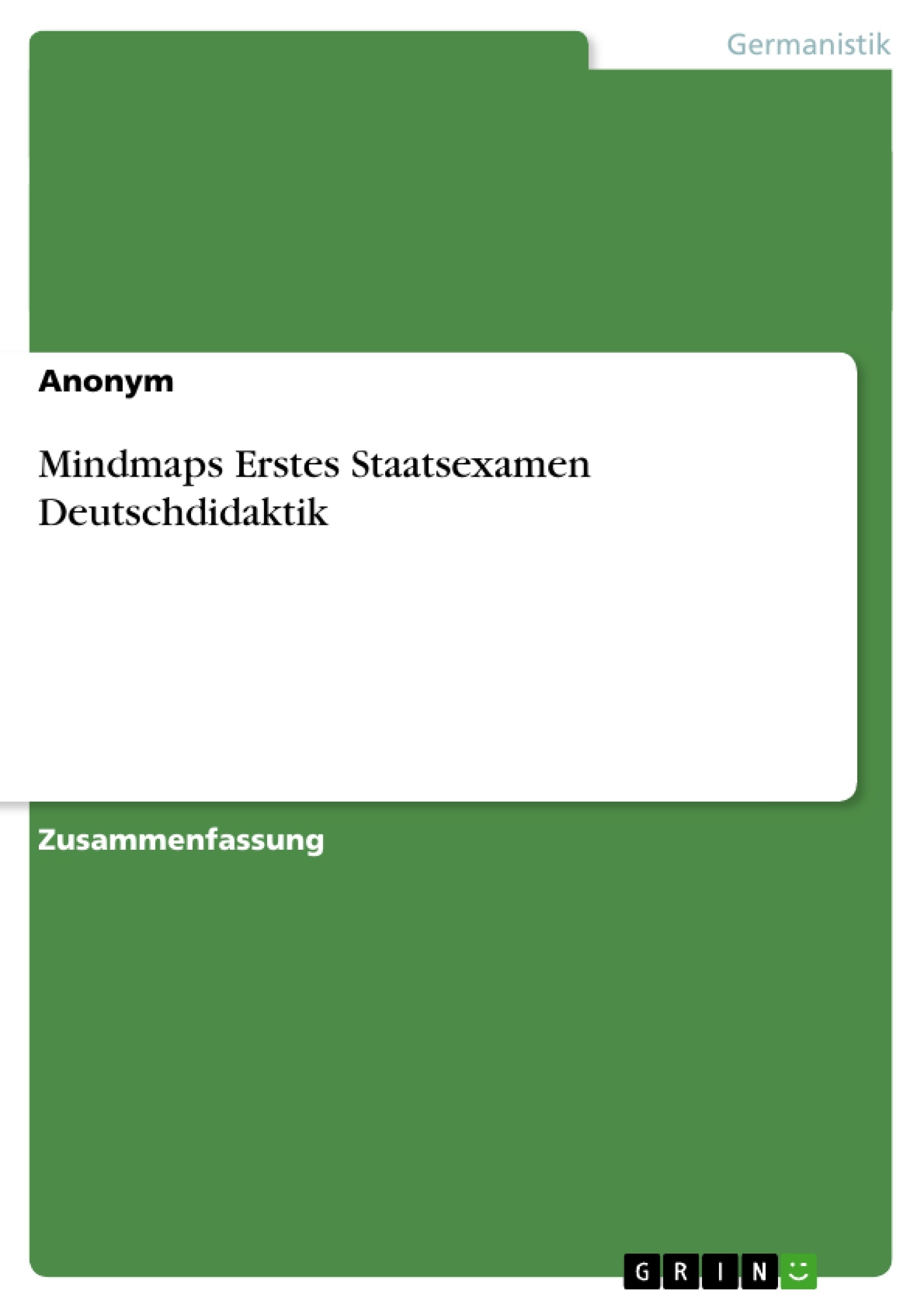Die Arbeit enthält detaillierte Mindmaps für das Erste Staatsexamen im Fach Deutschdidaktik: Literaturdidaktik, Lernen in der (neuen) Medienlandschaft, allgemeine Methoden für die Literaturdidaktik, Kinder- und Jugendliteratur, Mediendidaktik und Sprachdidaktik. Zur Mediendidaktik gehören außerdem: Akustisch-auditive Medien im Unterricht, Computerspiele, E-Learning & Handys, Film, Kurzfilm, Video, Internet, PC.
Inhaltsverzeichnis
- Literaturdidaktik allgemein (Teil 1)
- Literaturdidaktik allgemein (Teil 2)
- Literaturdidaktik allgemein (Teil 3): Lernen in der (neuen) Medienlandschaft
- Literaturdidaktik (Allgemeine Methoden)
- Literaturdidaktik (Kinder- und Jugendliteratur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Literaturdidaktik, insbesondere mit dem Lese- und Lernprozess von Kindern und Jugendlichen. Sie untersucht verschiedene Aspekte des Lesens, von kognitiven und metakognitiven Strategien bis hin zur Rolle neuer Medien und der Entwicklung von Lesemotivation.
- Lesestrategien und ihre Wirkung auf das Textverständnis und die Memorierbarkeit
- Die Entwicklung des Leseinteresses im Laufe der Lebensjahre und die Herausforderungen der Lesesozialisation
- Der Einfluss neuer Medien auf das Leseverhalten und die Literaturdidaktik
- Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren im Literaturunterricht
- Die Auswahl und didaktische Behandlung von Kinder- und Jugendliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Literaturdidaktik allgemein (Teil 1): Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Literaturdidaktik, indem es Konstruktivismus, kognitionspsychologische Leseforschung und die Bedeutung emotionaler Beteiligung beim Lesen beleuchtet. Es werden verschiedene Lesestrategien und deren Effektivität auf die Textverarbeitung untersucht, mit dem Schwerpunkt auf der aktiven und elaborativen Auseinandersetzung mit dem Text. Die Ziele des Literaturunterrichts nach Spinner (2006) werden vorgestellt, welche literarische Bildung, Identitätsfindung und Empathieförderung beinhalten. Der integrative Textbegriff nach Brinker (2001) und verschiedene Definitionen von Lesekompetenz, Lesesozialisation, Lesemotivation und Lesekultur werden diskutiert. Der Abschnitt unterstreicht die aktive Rolle des Lesers bei der Sinnkonstruktion und betont die Notwendigkeit von Anschlusskommunikation.
Literaturdidaktik allgemein (Teil 2): Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie zum Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen, insbesondere die Lesekrisen im Laufe der Schulzeit und die geschlechterspezifischen Unterschiede im Leseverhalten. Es werden verschiedene Theorien und Hypothesen zum unterschiedlichen Leseverhalten von Mädchen und Jungen diskutiert, darunter biologische, lektüregeschichtliche, sozialpsychologische und bildungspolitische Faktoren. Die Bedeutung der Primär- und Sekundärsozialisation, sowie die Rolle des Elternhauses und der Medien, insbesondere des Fernsehens, für die Lesesozialisation werden erläutert. Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf den Lernerfolg wird ebenfalls thematisiert.
Literaturdidaktik allgemein (Teil 3): Lernen in der (neuen) Medienlandschaft: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten des Lernens in der digitalen Medienlandschaft. Es untersucht den Einfluss von Film, Hörspiel und Internet auf das Leseverhalten und die Lesegewohnheiten von Kindern und Jugendlichen. Es werden verschiedene mediendidaktische Ansätze diskutiert, wie die Nutzung von Film und Hörspiel als Einstieg oder Ergänzung zum Lesen, sowie die Integration neuer Medien in den Literaturunterricht. Die Konfrontation von Kindern und Jugendlichen mit Intermedialität und die potentielle Konkurrenzsituation zwischen Buch und neuen Medien werden analysiert, und Ansätze zur Synthese von traditionellen und neuen Medien im Unterricht werden vorgestellt. Die Problematik des nicht-linearen Lesens im Internet wird ebenfalls betrachtet.
Literaturdidaktik (Allgemeine Methoden): Das Kapitel präsentiert verschiedene allgemeine Methoden für den Literaturunterricht, mit Fokus auf handlungs- und produktionsorientierte Verfahren. Textnahes Lesen und Rezeptionsdidaktik werden im Detail erläutert, wobei die poststrukturalistische Texttheorie und die Rezeptionstheorie/Rezeptionsästhetik als philosophische Hintergründe hervorgehoben werden. Die Bedeutung des kompetenzorientierten Leseunterrichts und die Auswahl geeigneter Kinder- und Jugendliteratur mithilfe einer Klassenjury werden diskutiert. Verschiedene Verfahren zur Textauswahl und Textverarbeitung, inklusive analytischer, synthetischer, integrativer und entschulter Verfahren, werden beschrieben.
Literaturdidaktik (Kinder- und Jugendliteratur): Dieses Kapitel definiert und kategorisiert Kinder- und Jugendliteratur (KJL), unterteilt in intentionale, intendierte und nicht-intendierte KJL, sowie positiv und negativ sanktionierte KJL. Es werden die verschiedenen Gattungen der KJL (Epik, Lyrik, Drama, Sachtexte) sowie die geschichtliche Entwicklung der KJL und deren didaktische Behandlung im Unterricht beleuchtet. Die Entwicklung der KJL von der reinen Informationsvermittlung hin zu ästhetischen Texten und den heutigen handlungs- und produktionsorientierten Ansätzen wird nachgezeichnet.
Schlüsselwörter
Literaturdidaktik, Lesekompetenz, Lesestrategien, Lesemotivation, Lesesozialisation, Kinder- und Jugendliteratur, Medienlandschaft, Handlungsorientierung, Produktionsorientierung, Rezeptionsdidaktik, Textverständnis, PISA-Studie, Konstruktivismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Literaturdidaktik - Lese- und Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Literaturdidaktik, insbesondere den Lese- und Lernprozess von Kindern und Jugendlichen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des Lesens, von kognitiven und metakognitiven Strategien bis hin zur Rolle neuer Medien und der Entwicklung von Lesemotivation.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 und 2 befassen sich mit grundlegenden Aspekten der Literaturdidaktik, inklusive Konstruktivismus, kognitionspsychologischer Leseforschung, Lesestrategien, PISA-Studien-Ergebnisse, Lesekrisen, geschlechterspezifische Unterschiede im Leseverhalten und den Einfluss von Sozialisation und sozioökonomischem Status. Kapitel 3 behandelt das Lernen in der digitalen Medienlandschaft und den Einfluss neuer Medien auf das Lesen. Kapitel 4 konzentriert sich auf allgemeine Methoden im Literaturunterricht, wie handlungs- und produktionsorientierte Verfahren und Rezeptionsdidaktik. Kapitel 5 schließlich definiert und kategorisiert Kinder- und Jugendliteratur, untersucht deren Gattungen und historische Entwicklung und deren didaktische Behandlung im Unterricht.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Die Arbeit untersucht den Lese- und Lernprozess von Kindern und Jugendlichen und beleuchtet verschiedene Aspekte des Lesens. Die Zielsetzung umfasst die Analyse von Lesestrategien, die Entwicklung des Leseinteresses, den Einfluss neuer Medien, handlungs- und produktionsorientierte Verfahren im Literaturunterricht und die Auswahl und didaktische Behandlung von Kinder- und Jugendliteratur. Es geht um die Förderung von literarischer Bildung, Identitätsfindung und Empathieförderung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Literaturdidaktik, Lesekompetenz, Lesestrategien, Lesemotivation, Lesesozialisation, Kinder- und Jugendliteratur, Medienlandschaft, Handlungsorientierung, Produktionsorientierung, Rezeptionsdidaktik, Textverständnis, PISA-Studie, Konstruktivismus.
Welche Theorien und Modelle werden im Dokument verwendet?
Das Dokument bezieht sich auf verschiedene Theorien und Modelle, darunter der Konstruktivismus, die kognitionspsychologische Leseforschung, die Rezeptionstheorie/Rezeptionsästhetik, die poststrukturalistische Texttheorie und verschiedene mediendidaktische Ansätze. Es werden auch Ergebnisse der PISA-Studie analysiert und verschiedene Theorien zum unterschiedlichen Leseverhalten von Mädchen und Jungen diskutiert (biologische, lektüregeschichtliche, sozialpsychologische und bildungspolitische Faktoren).
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Lehramtsstudierende, Lehrer*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen im Bereich der Literaturdidaktik und alle, die sich mit dem Lese- und Lernprozess von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Es bietet einen fundierten Überblick über aktuelle Theorien und Methoden in der Literaturdidaktik.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist übersichtlich strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung zur Zielsetzung und zu den Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und einer Liste der Schlüsselbegriffe. Diese Struktur erleichtert den Zugriff auf die relevanten Informationen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Mindmaps Erstes Staatsexamen Deutschdidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277739