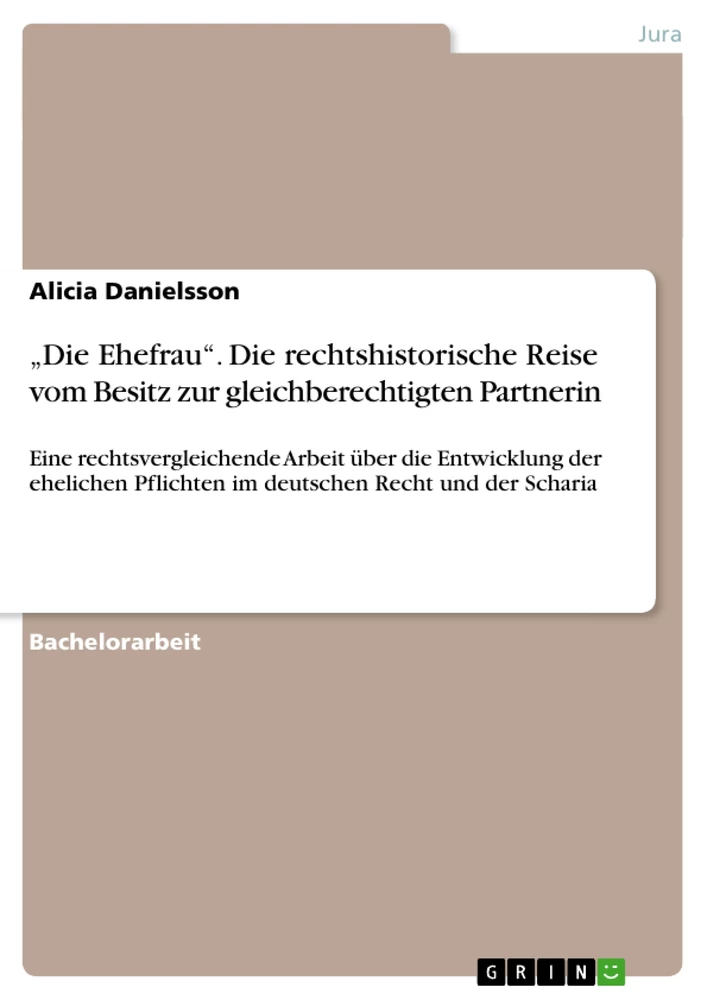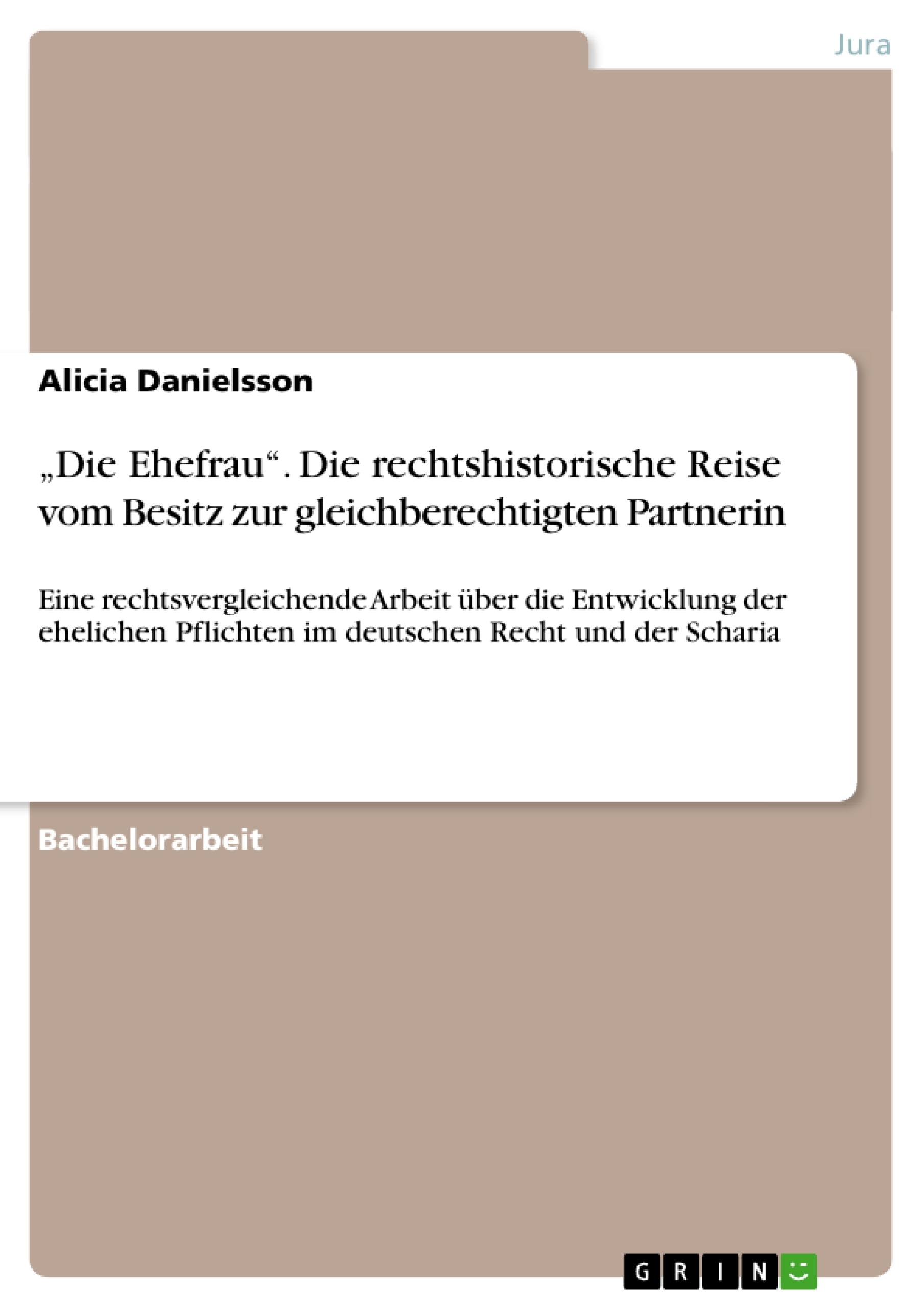Gleichberechtigung – Ein Wort, welches aktuell überall zu hören ist,
jedoch auch grade aus diesem Grund schon fast an Aussagekraft verloren
hat. Es geht sogar so weit, dass Stimmen laut werden, welche sich über
die sogenannte „positive Diskriminierung“ beschweren. Besonders bei
der Gleichberechtigung der Geschlechter werden diese Stimmen laut, da
diese mittlerweile oftmals als Selbstverständlichkeit gilt. Hierbei wird
kaum noch daran zurückgedacht, was für ein langer Weg in der
Geschichte zurückgelegt werden musste, um die heutige Situation im
deutschen Recht zu ermöglichen. Als besonders langwierig gestaltete
sich die vollständige Umsetzung von Gleichberechtigung im Eherecht.
Noch in den 1950er Jahren besaßen Ehemänner ein einseitiges
Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten. Vergewaltigung
in der Ehe stellte vor nicht einmal 15 Jahren im deutschen Strafrecht
keinen Straftatbestand dar. Oft wird mit Geschlechterdiskriminierung,
insbesondere im Familienrecht, der Islam verbunden. Medien berichten
kritisch über Menschenrechtsverletzungen unter der Scharia. Es werden
Bilder von komplett verhüllten Frauen in den Nachrichten gezeigt. Doch
wie kam es dazu, dass in Deutschland im letzten Jahrhundert plötzlich
die Gleichstellung der Geschlechter derart vorangebracht werden konnte?
Wie gestaltete sich diese Entwicklung? Was sind die Gründe dafür, dass
ein jahrtausendealtes Patriarchat in der Ehe in einem Land umgeworfen
wird, während es in einem anderen bestehen bleibt?
Um dies zu erörtern, sollen die Entwicklungen im deutschen
Rechtssystem mit denen in der Scharia einander gegenüber gestellt
werden. Hierbei ist es sinnvoll, beide Entwickelungen zunächst einzeln
zu erläutern, um dann später die Ergebnisse zu vergleichen. Als
Ausgangspunkt für den Vergleich wurden die Entwicklungen der
ehelichen Pflichten in den jeweiligen Rechtssystemen gewählt, da diese
die gleiche oder ungleiche Rollenverteilung in der Ehe anschaulich
darstellen.
Die Arbeit beginnt mit einem allgemeinen Überblick über die Ehe und
wie sich hieraus die ehelichen Pflichten ableiten. Anschließend wird betrachtet, wie sich das Eherecht seit der Antike entwickelt hat, um ein
Verständnis dafür zu entwickeln, worauf das Eherecht in Europa
ursprünglich aufbaute, bevor zum eigentlichen Vergleich der
Entwicklungen der beiden Rechtssysteme übergegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Ehe
- I. Definition
- II. Zweck
- III. Anerkennung
- IV. Mit der Ehe verbundene Rechte und Pflichten
- C. Die Entwicklung der Ehe und deren Rechte und Pflichten in Europa
- I. In der europäischen Antike
- II. Das Kanonische Recht
- III. Die Trennung von Kirche und Staat
- D. Die rechtliche Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe und deren Einfluss auf die ehelichen Pflichten im deutschen Recht und der Scharia
- I. Deutschland
- 1. Die einheitliche zivile Anerkennung der Ehe
- 2. Die rechtliche Situation in Deutschland vor 1900
- a) Rechtszersplitterung
- b) Das Römische Recht (Gemeines Recht)
- 3. Die erste bürgerliche Frauenbewegung
- 4. Das Inkrafttreten des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
- 5. Die weitere Entwicklung des Bürgerlichen Gesetzbuches hinsichtlich der Rechtsstellung der Frau in der Ehe
- 6. Die Ära des Nationalsozialismus und die rechtliche Abspaltung des Ehegesetzes
- 7. Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes sowie die Auswirkungen von Artikel 3 GG auf das deutsche Familienrecht
- i,a) BVerfGE 3, 225 und der darauf folgende “gesetzlose Zustand”
- b) Das deutsche Gleichberechtigungsgesetz 1957
- 8. Das Eherechtsreformgesetz 1977
- 9. Der Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe
- 10. Die aktuelle Situation im deutschen Familienrecht
- II. Die Scharia
- 1. Einführung in die Scharia
- 2. Das Familienrecht / Eherecht der Scharia im Allgemeinen
- 3. Menschenrechte und die Scharia
- 4. Refah Partisi vs Turkey
- 5. Islamischer Feminismus
- 6. Zusammenfassung
- I. Deutschland
- E. Vergleich der Entwicklungsprozesse in beiden Systemen
- I. Gegenüberstellung der beiden Entwicklungen
- II.Analyse anhand der “Mastery” und “Equality” Theorien
- F. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtshistorische Entwicklung der Ehefrau vom Besitz zur gleichberechtigten Partnerin, indem sie den Wandel der ehelichen Pflichten im deutschen Recht und in der Scharia rechtsvergleichend analysiert. Ziel ist es, die unterschiedlichen Entwicklungspfade aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
- Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe
- Rechtsvergleich zwischen deutschem Recht und Scharia
- Wandel der ehelichen Pflichten im Laufe der Zeit
- Einfluss von gesellschaftlichen und politischen Veränderungen
- Theorien zur Ehe und Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der rechtshistorischen Entwicklung der Ehefrau vom Besitz zur gleichberechtigten Partnerin ein und beschreibt den Ansatz der rechtsvergleichenden Arbeit, die das deutsche Recht und die Scharia in den Fokus nimmt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
B. Die Ehe: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Definition der Ehe, erläutert deren Zweck und gesellschaftliche Anerkennung und beschreibt die mit der Ehe verbundenen Rechte und Pflichten. Es legt den Rahmen für die anschließende rechtshistorische und rechtsvergleichende Analyse.
C. Die Entwicklung der Ehe und deren Rechte und Pflichten in Europa: Die Entwicklung der Ehe in Europa wird von der Antike über das kanonische Recht bis zur Trennung von Kirche und Staat nachgezeichnet. Hier werden die grundlegenden Veränderungen der rechtlichen und gesellschaftlichen Sichtweise auf die Ehe und die Rolle der Frau dargelegt, um den europäischen Kontext für den Vergleich mit der Scharia zu schaffen.
D. Die rechtliche Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe und deren Einfluss auf die ehelichen Pflichten im deutschen Recht und der Scharia: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die rechtliche Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe in Deutschland vom Vormoderne bis zur Gegenwart, mit besonderem Fokus auf den Wandel der ehelichen Pflichten. Parallel dazu wird die Entwicklung des Familienrechts in der Scharia beleuchtet, einschließlich der Rolle der Frau und der ehelichen Pflichten im islamischen Kontext. Die Kapitelteile zu Deutschland und der Scharia untersuchen die unterschiedlichen Rechtsordnungen und die historischen und gesellschaftlichen Faktoren, die die Entwicklung beeinflusst haben. Besonders werden die Gleichstellungsbestrebungen im deutschen Recht und die Diskussion um Menschenrechte und Scharia im islamischen Recht behandelt.
E. Vergleich der Entwicklungsprozesse in beiden Systemen: In diesem Kapitel werden die Entwicklungen im deutschen Recht und in der Scharia systematisch gegenübergestellt und anhand von Theorien wie "Mastery" und "Equality" analysiert. Es wird untersucht, inwieweit sich die jeweiligen Rechtssysteme der Gleichstellung der Ehepartner annähern oder welche Unterschiede bestehen bleiben.
Schlüsselwörter
Ehe, Frauenrechte, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Deutsches Recht, Scharia, Eheliche Pflichten, Gleichberechtigung, Geschlechterrollen, Familienrecht, Menschenrechte, Islamischer Feminismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Rechtshistorischen Entwicklung der Ehefrau
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht rechtsvergleichend die rechtshistorische Entwicklung der Ehefrau vom Besitz zur gleichberechtigten Partnerin. Der Fokus liegt auf dem Wandel der ehelichen Pflichten im deutschen Recht und in der Scharia.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die unterschiedlichen Entwicklungspfade der Frauenrechte in der Ehe im deutschen Recht und der Scharia aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe, einen Rechtsvergleich zwischen deutschem Recht und Scharia, den Wandel der ehelichen Pflichten im Laufe der Zeit, den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Veränderungen und Theorien zur Ehe und Geschlechterrollen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, ein Kapitel zur Definition der Ehe, ein Kapitel zur Entwicklung der Ehe in Europa, ein Kernkapitel zum Vergleich der Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe im deutschen Recht und der Scharia, ein Kapitel zum Vergleich der Entwicklungsprozesse in beiden Systemen und eine Schlussfolgerung. Die einzelnen Kapitel behandeln die jeweiligen Themen detailliert und analysieren die historischen und rechtlichen Entwicklungen.
Wie wird der Vergleich zwischen deutschem Recht und Scharia durchgeführt?
Der Vergleich zwischen deutschem Recht und Scharia erfolgt durch eine systematische Gegenüberstellung der Entwicklungen in beiden Rechtssystemen. Die Analyse wird unter anderem mithilfe von Theorien wie "Mastery" und "Equality" durchgeführt.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung der Frauenrechte in der Ehe von der europäischen Antike bis zur Gegenwart, sowohl im deutschen Recht als auch in der Scharia. Im deutschen Kontext werden die Entwicklungen vor und nach 1900, die Zeit des Nationalsozialismus und die Einflüsse des Grundgesetzes berücksichtigt.
Welche Aspekte des deutschen Rechts werden behandelt?
Im deutschen Kontext werden Aspekte wie die Rechtszersplitterung vor 1900, das Römische Recht, die erste bürgerliche Frauenbewegung, das BGB, das Gleichberechtigungsgesetz 1957, die Eherechtsreform 1977 und die aktuelle Situation im deutschen Familienrecht behandelt.
Welche Aspekte der Scharia werden behandelt?
Die Scharia wird im Kontext des Familienrechts und Eherechts behandelt, mit Fokus auf Menschenrechte, den Fall Refah Partisi vs. Turkey und den Islamischen Feminismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ehe, Frauenrechte, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Deutsches Recht, Scharia, Eheliche Pflichten, Gleichberechtigung, Geschlechterrollen, Familienrecht, Menschenrechte, Islamischer Feminismus.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zur vollständigen Arbeit eingefügt werden, falls verfügbar).
- Citar trabajo
- Alicia Danielsson (Autor), 2011, „Die Ehefrau“. Die rechtshistorische Reise vom Besitz zur gleichberechtigten Partnerin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277729