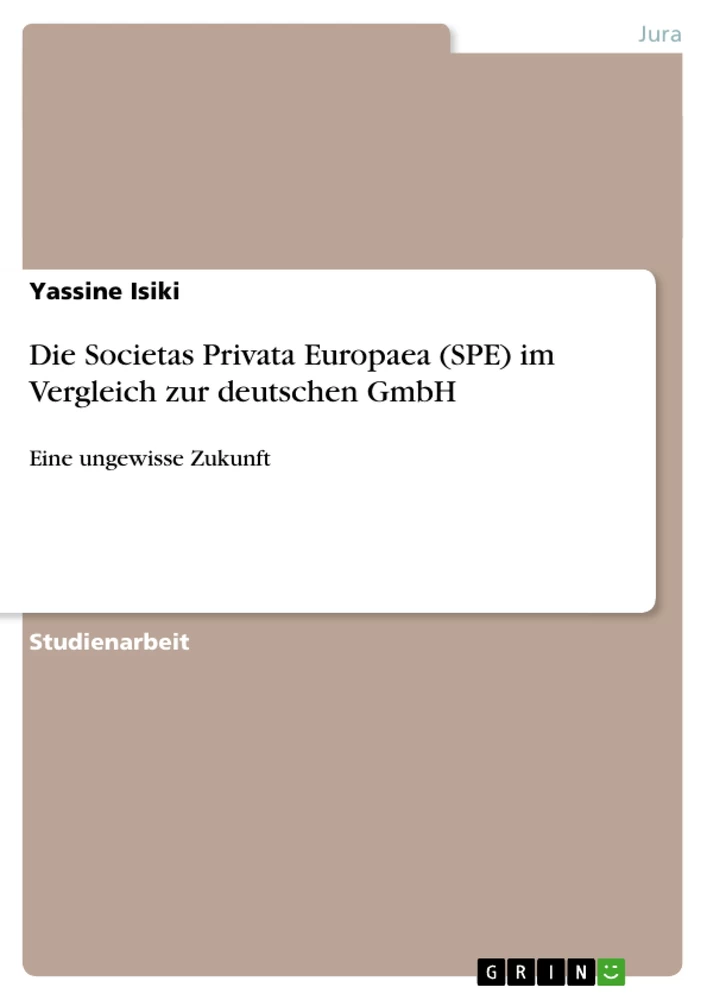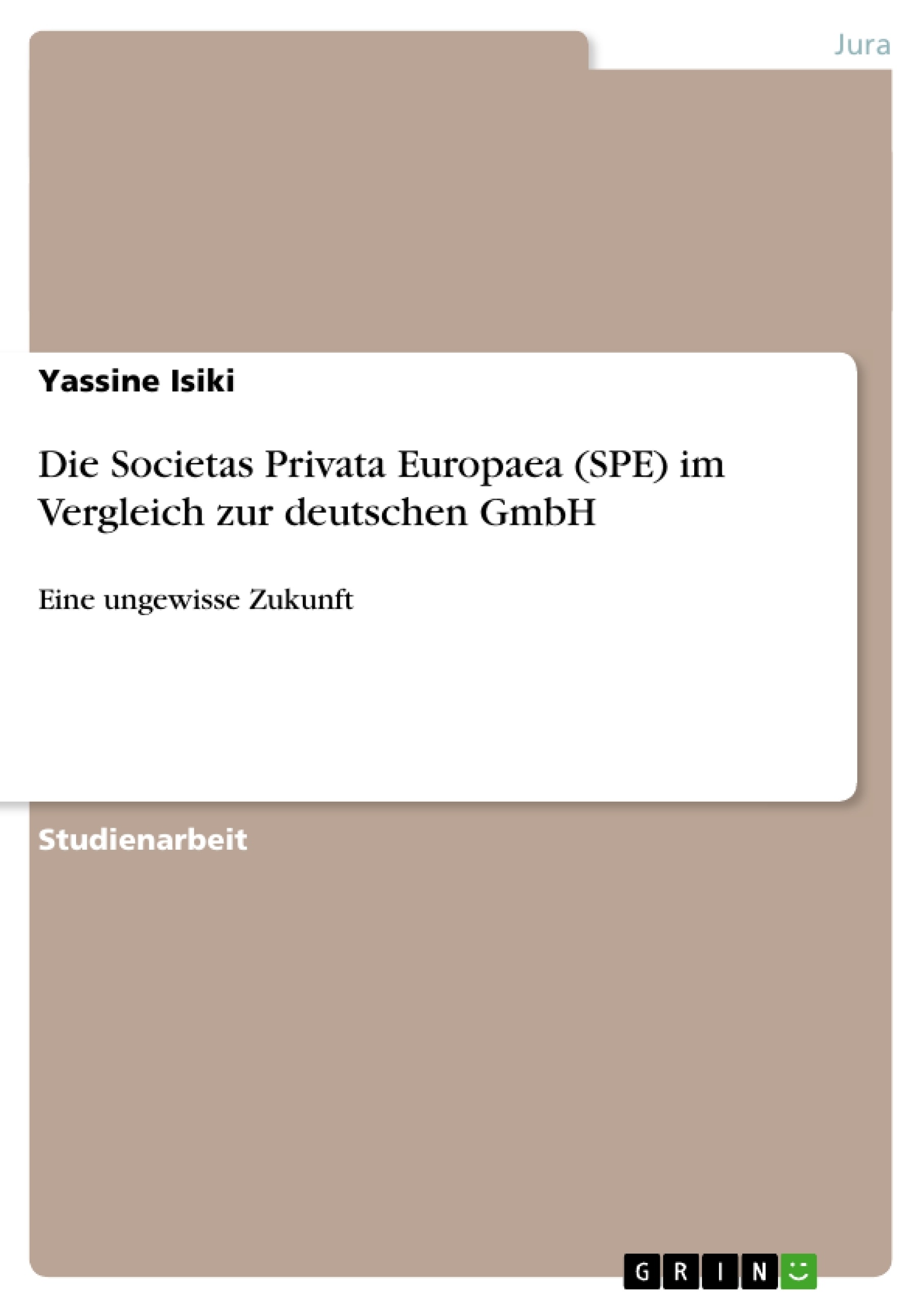Gegenstand dieser Arbeit wird die Analyse der geplanten Europäischen Privatgesellschaft (lat. Societas Privata Europaea, nachfolgend SPE) sein. An gegebenen Stellen wird der Vergleich mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (nachfolgend GmbH) gezogen und die Vor- und Nachteile näher erläutert.
Mit der Europäischen Privatgesellschaft verfolgt die Europäische Union (nachfolgend EU) bereits seit mehreren Jahren das Ziel, eine EU-weite Gesellschaftsform für kleinere und mittlere Unternehmen (nachfolgend KMU) zu schaffen. Man will dem ökonomischen Bedürfnis des Mittelstandes nach einer supranationalen Gesellschaft genüge tragen.1 Als eine Rechtsform der europäischen Kapitalgesellschaften, soll die Europäische Privatgesellschaft eine Ergänzung zur Europäischen Aktiengesellschaft (nachfolgend SE) darstellen und die rechtlichen wie administrativen Hindernisse auf dem Binnenmarkt reduzieren. Sie ist als eine supranationale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, speziell für einen geschlossenen Gesellschafterkreis konzipiert.2
Wie andere supranationale Gesellschaftsformen soll die Europäische Privatgesellschaft die rechtlichen wie administrativen Hindernisse am Binnenmarkt reduzieren.3 Es gilt eine einheitliche Gesellschaftsform, für alle EU-Mitgliedsstaaten zu etablieren. Im Gegensatz zur Europäischen Aktiengesellschaft versucht man bei der Europäischen Privatgesellschaft eine einheitlich geltende Regelung auf EU-Ebene zu schaffen, mit möglichst wenig nationalem Einfluss. Nur so kann eine Europäische Privatgesellschaft unter fairen und gleichen Bedingungen in Europa gewährleistet werden. Diesbezüglich verfolgt man das Ziel die Europäische Privatgesellschaft in einer europäischen Verordnung zu regeln. Eine Verordnung auf EU-Ebene entfaltet gemäß Art. 288 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine Durchgriffswirkung. Das heißt, dass die Verordnungen mit Beschluss allgemeine Geltung entfalten und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat verbindlich gelten. Sie müssen von den EU-Mitgliedstaaten nicht erst noch in nationales Recht umgesetzt werden.
Die sogenannte „Europa-GmbH“ wie die Europäische Privatgesellschaft im deutschen Schrifttum auch bezeichnet wird, hat als Ziel die schnelle und unbürokratische Neugründung einer europäischen Gesellschaft zu ermöglichen. Des weitern verfolgt man mit der Europäischen Privatgesellschaft die Kosten für Beratungen einzusparen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Der Wunsch nach einer „echten" supranationalen Gesellschaftsform für die KMU
- II. Die Entwicklungsgeschichte der Europäischen Privatgesellschaft
- B. SPE im Vergleich zur GmbH - Die Europäische Privatgesellschaft als Konkurrenz zur GmbH ?
- I. Normenhierarchie und Grundstruktur der SPE
- II. Gründungsablauf
- 1. Gründung
- 2. Eintragung und Bekanntmachung
- 3. Register- und Verwaltungssitz
- 4. Grenzüberschreitender Bezug in der SPE
- 5. Mindestkapital
- III. Verschmelzung
- IV. Umwandlung
- V. Haftung
- VI. Organisation
- 1. Leitungsstrukturen
- 2. Gesellschafterversammlung
- 3. Durchführung der Gesellschafterversammlung und die Beschlussfassung
- 4. Unternehmensleitung
- 5. Verwaltungsorgan
- 6. Aufsichtsrat
- 7. Rechte und Pflichten eines Gesellschafters
- VII. Arbeitnehmermitbestimmung in der SPE
- VIII. Kapital
- 1. Kapitalaufbringung und Mindestkapital
- 2. Geschäftsanteile
- 3. Ausschüttung
- 4. Kapital herabsetzung
- IX. Jahresabschluss bzw. Publizität
- X. Auflösung
- XI. Modellsatzung
- C. Zwischenfazit
- D. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise und Einsatzmöglichkeit der Europäischen Privatgesellschaft
- E. Offene Regelungen
- F. Schlussfazit
- G. Ausblick
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die geplante Europäische Privatgesellschaft (SPE) und vergleicht sie mit der deutschen GmbH. Sie untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Bedeutung der SPE im Kontext des europäischen Binnenmarktes. Die Arbeit zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile der SPE für KMU aufzuzeigen und die potenziellen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Binnenmarkt zu beleuchten.
- Entwicklungsgeschichte und Ausgangslage der Europäischen Privatgesellschaft
- Rechtliche Rahmenbedingungen der SPE im Vergleich zur GmbH
- Wirtschaftliche Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten der SPE
- Potenzielle Auswirkungen der SPE auf die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Binnenmarkt
- Offene Regelungen und zukünftige Entwicklungen der SPE
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Europäische Privatgesellschaft (SPE) als eine geplante EU-weite Gesellschaftsform für KMU vor und erläutert die Ziele und Hintergründe der Initiative. Sie beleuchtet den Wunsch nach einer supranationalen Gesellschaftsform, die die rechtlichen und administrativen Hindernisse auf dem Binnenmarkt reduziert und die Wettbewerbsfähigkeit von KMU stärkt. Die Einleitung beleuchtet auch die historische Entwicklung der SPE und die verschiedenen Verordnungsvorschläge, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
Das Kapitel "SPE im Vergleich zur GmbH" analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der SPE im Vergleich zur deutschen GmbH. Es untersucht die Normenhierarchie und die Grundstruktur der SPE, den Gründungsablauf, die Haftung, die Organisation, die Kapitalstruktur, den Jahresabschluss und die Auflösung. Der Vergleich mit der GmbH ermöglicht es, die Vor- und Nachteile der SPE für KMU zu erkennen und die potenziellen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Binnenmarkt zu beurteilen.
Das Zwischenfazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus den ersten beiden Kapiteln zusammen und stellt die wichtigsten Unterschiede zwischen der SPE und der GmbH heraus. Es bewertet die potenziellen Vorteile und Herausforderungen der SPE für KMU und diskutiert die Bedeutung der SPE für die zukünftige Entwicklung des europäischen Binnenmarktes.
Das Kapitel "Die wirtschaftliche Betrachtungsweise und Einsatzmöglichkeit der Europäischen Privatgesellschaft" analysiert die wirtschaftlichen Aspekte der SPE und untersucht die potenziellen Einsatzmöglichkeiten für KMU. Es beleuchtet die Vorteile der SPE in Bezug auf die Kostenreduktion, die Vereinfachung von grenzüberschreitenden Transaktionen und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Das Kapitel diskutiert auch die potenziellen Herausforderungen und Risiken, die mit der SPE verbunden sind.
Das Kapitel "Offene Regelungen" behandelt die noch offenen Fragen und Streitpunkte im Zusammenhang mit der SPE. Es diskutiert die verschiedenen Ansätze und Positionen der EU-Mitgliedstaaten und die Herausforderungen, die bei der Umsetzung der SPE-Verordnung auftreten können. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung der Harmonisierung des Gesellschaftsrechts in der EU und die Notwendigkeit einer einheitlichen Rechtsgrundlage für die SPE.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Europäische Privatgesellschaft (SPE), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), den europäischen Binnenmarkt, KMU, Wettbewerbsfähigkeit, rechtliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Bedeutung, grenzüberschreitende Transaktionen, Harmonisierung des Gesellschaftsrechts, offene Regelungen und zukünftige Entwicklungen.
- Citar trabajo
- Yassine Isiki (Autor), 2013, Die Societas Privata Europaea (SPE) im Vergleich zur deutschen GmbH, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277477