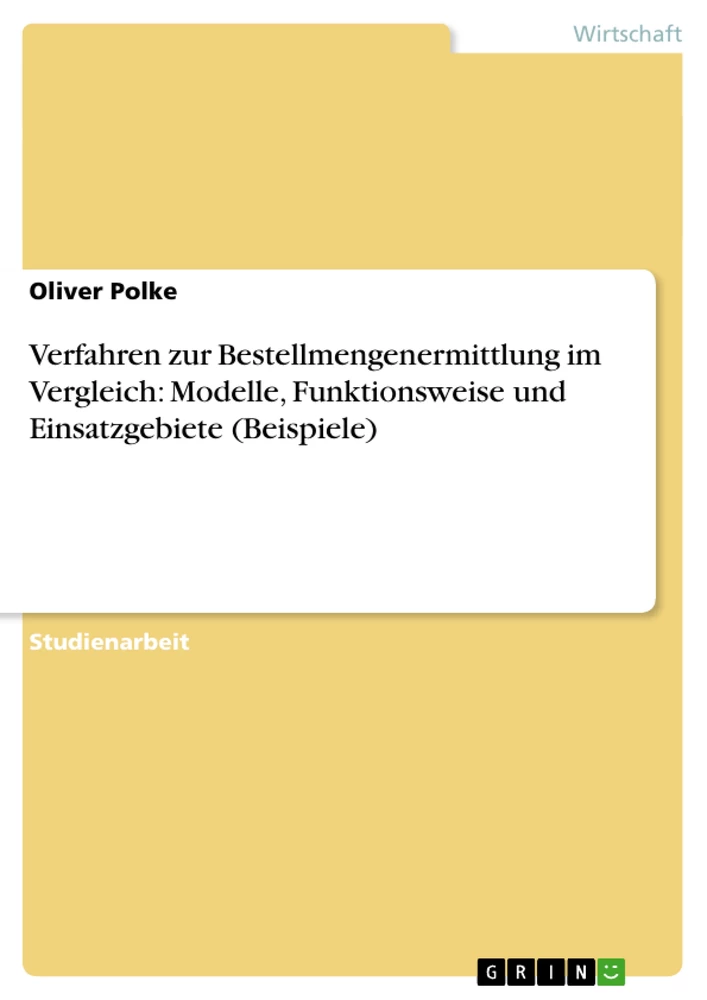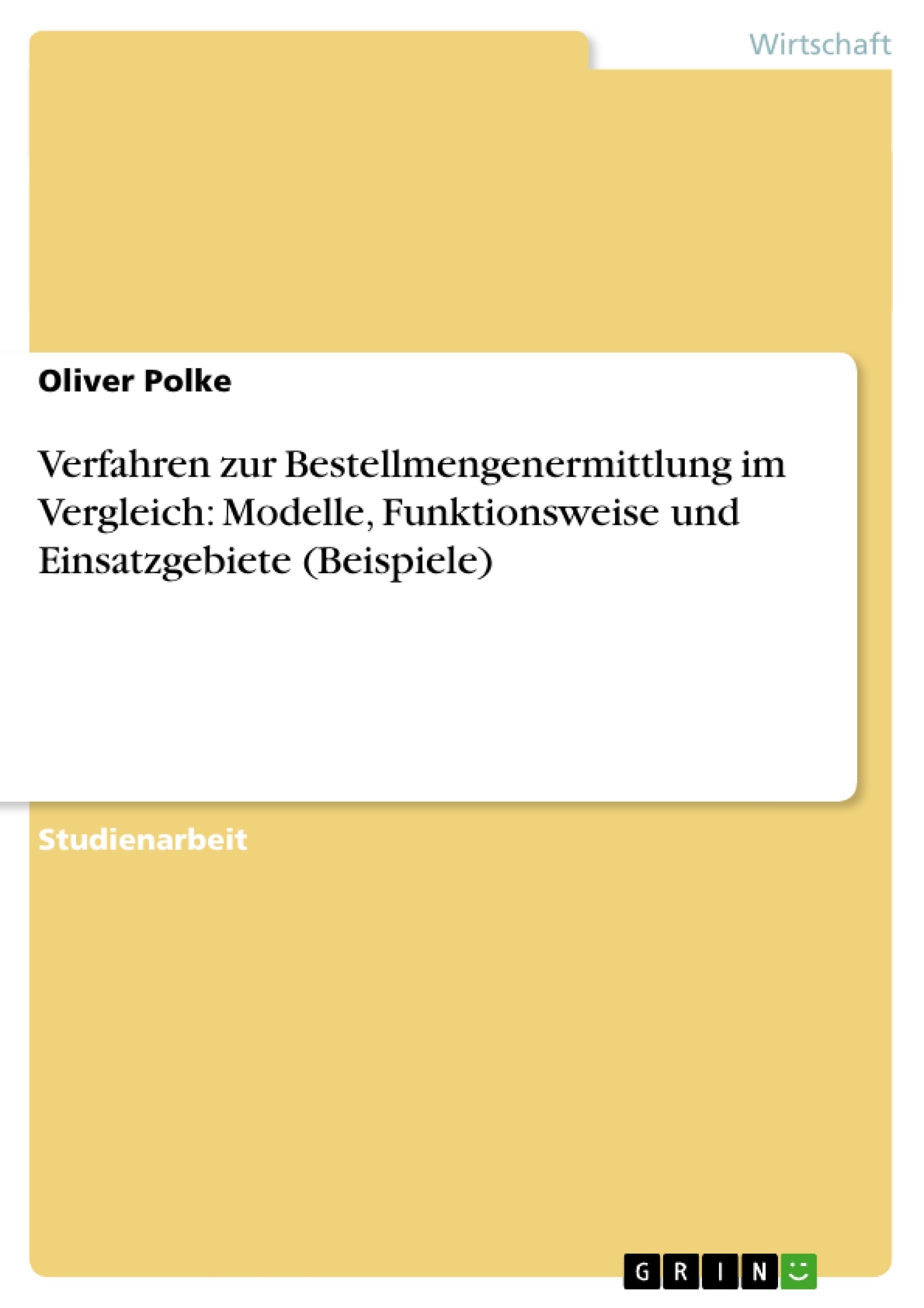Die Aufgabe der Bestellmengenermittlung besteht darin, festzulegen, wie viele Einheiten eines gleichartigen Gutes gleichzeitig in einer zusammenhängenden Lieferung zu beschaffen sind. Diese Problemstellung ergibt sich vor allem dann, wenn Verfahren wie JiT unwirtschaftlich oder nicht verwirklichbar sind [BOGA96, S. 1142]. Die zwei Extrempolitiken der Bestellmengenermittlung bestehen darin, dass man entweder den gesamten Bedarf für einen betrachteten Zeitraum zu einer Bestellung zusammenfasst oder jede einzelne Mengeneinheit bedarfsgenau bestellt. Da die erste Variante aber hohe Lagerhaltungs- und niedrige Bestellkosten mit sich bringt, während sich dieses Verhältnis im zweiten Fall genau umkehrt, gilt es für das jeweilige Unternehmen, eine wirtschaftliche Bestelllosgröße zu finden [BLOE01, S. 196; BLOH97, S. 316; TEMP03, S. 135f.]. Wie man erkennen kann, verlaufen die beiden relevanten Kostenblöcke gegenläufig, wodurch das Optimierungsproblem entsteht. Die Materialkosten der Güter kann man bei dieser Berechnung außer Acht lassen, da konstante Preise (ohne Mengenrabatte etc.) angenommen werden. Dadurch wird dieser Kostenblock für die Entscheidung irrelevant, da der Gesamtbedarf bei jeder Bestellpolitik somit insgesamt immer gleich viel kostet [BLOE01, S. 198]. Da es in der Praxis verschiedene Problemstellungen für die einzelnen Unternehmen gibt, wurden viele verschiedene Modelle für die Ermittlung der wirtschaftlichen Bestellmenge entwickelt, die im folgenden näher erklärt werden sollen. Bei den statischen wird dabei im Gegensatz zu den dynamischen Modellen eine Unveränderlichkeit der Parameterwerte vorausgesetzt. Die deterministischen Modelle gehen von bekannten Gesamtbedarfmengen (z.B. durch Stücklistenauflösung [BOGA88, S. 11]) aus, während die stochastischen Modelle versuchen, eine gewisse Unsicherheit abzubilden [BLOE01, S. 195, S. 238, DOMS97, S. 70].
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Deterministische Modelle
- 2.1 Klassisches (statisches) Bestellmengenmodell
- 2.2 Dynamische Verfahren
- 2.2.1 Grundlagen der dynamischen Modelle
- 2.2.2 Verfahren von Wagner und Whitin
- 2.2.3 Dynamische Heuristiken
- 3 Stochastische Lagerhaltungsmodelle
- 4 Einsatzgebiete der Verfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bestellmengenermittlung und verschiedenen Modellen zur Bestimmung der wirtschaftlichen Bestellmenge. Ziel ist es, verschiedene Verfahren zu vergleichen und ihre Anwendbarkeit in der Praxis zu erläutern. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der zugrundeliegenden Annahmen und der Herausforderungen bei der Anwendung der Modelle.
- Deterministische vs. stochastische Modelle zur Bestellmengenermittlung
- Das klassische (statische) Bestellmengenmodell und seine Annahmen
- Dynamische Verfahren zur Berücksichtigung schwankender Bedarfe
- Optimierung der Bestellmenge unter Berücksichtigung von Kostenfaktoren
- Praktische Anwendung und Grenzen der Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Bestellmengenermittlung ein. Es beschreibt die Aufgabe, optimale Bestellmengen zu ermitteln, um die Kosten für Lagerhaltung und Bestellungen zu minimieren. Es werden die zwei Extrempolitiken (Gesamtbedarf auf einmal bestellen vs. bedarfsgenaue Bestellung) vorgestellt und deren Nachteile erläutert. Die Problemstellung wird auf die Gegenläufigkeit von Lagerhaltungs- und Bestellkosten zurückgeführt und die Notwendigkeit optimaler Modelle betont. Materialkosten werden aufgrund der Annahme konstanter Preise als irrelevant betrachtet.
2 Deterministische Modelle: Dieses Kapitel behandelt deterministische Modelle zur Bestellmengenermittlung, die von bekannten und konstanten Bedarfsmengen ausgehen. Es beginnt mit dem klassischen (statischen) Bestellmengenmodell von Harris und Andler, welches auf vereinfachenden Annahmen wie konstantem Bedarf und Null-Lagerbeständen am Ende des Planungszeitraums basiert. Die Ableitung der optimalen Bestellmenge mithilfe der Kostenfunktionen für Lagerhaltung und Bestellung wird ausführlich dargestellt, inklusive der grafischen Darstellung und der Interpretation der Ergebnisse. Die Grenzen des Modells aufgrund realitätsferner Annahmen werden ebenfalls angesprochen. Der Kapitelteil zu dynamischen Verfahren skizziert die Notwendigkeit, schwankende Bedarfe zu berücksichtigen, und führt in die Grundlagen der dynamischen Modellierung ein, inklusive der Unterteilung des Planungshorizonts in Perioden.
3 Stochastische Lagerhaltungsmodelle: Dieses Kapitel, dessen Inhalt im Ausgangstext nur in der Überschrift genannt wird, würde sich voraussichtlich mit Modellen beschäftigen, die Unsicherheiten im Bedarf berücksichtigen. Es würde wahrscheinlich verschiedene Ansätze zur Modellierung von stochastischen Prozessen und deren Einfluss auf die optimale Bestellmenge vorstellen. Vermutlich werden auch Methoden zur Bestimmung von Sicherheitsbeständen erläutert, um Fehlmengen zu vermeiden.
4 Einsatzgebiete der Verfahren: Dieses Kapitel (ebenfalls nur der Titel im Ausgangstext vorhanden) würde die verschiedenen Modelle im Kontext ihrer Anwendungsszenarien vergleichen und diskutieren. Es würde vermutlich detaillierte Fallbeispiele und Anwendungsbereiche der verschiedenen Modelle darstellen und die jeweilige Eignung für verschiedene Branchen und Unternehmenstypen untersuchen.
Schlüsselwörter
Bestellmengenermittlung, wirtschaftliche Bestellmenge, deterministische Modelle, stochastische Modelle, Lagerhaltungskosten, Bestellkosten, dynamisches Programmieren, Heuristiken, optimale Losgröße, Sägezahnkurve, Kostenminimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bestellmengenermittlung - Deterministische und Stochastische Modelle
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Bestellmengenermittlung und verschiedenen Modellen zur Bestimmung der wirtschaftlichen Bestellmenge. Ziel ist der Vergleich verschiedener Verfahren und die Erläuterung ihrer Anwendbarkeit in der Praxis. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der zugrundeliegenden Annahmen und Herausforderungen bei der Anwendung der Modelle.
Welche Modelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl deterministische als auch stochastische Modelle zur Bestellmengenermittlung. Zu den deterministischen Modellen gehört das klassische (statische) Bestellmengenmodell sowie dynamische Verfahren wie das Verfahren von Wagner und Whitin und dynamische Heuristiken. Stochastische Modelle werden zwar nur in der Überschrift erwähnt, aber es ist zu erwarten, dass sie Modelle umfassen, die Unsicherheiten im Bedarf berücksichtigen, inklusive Methoden zur Bestimmung von Sicherheitsbeständen.
Was ist das klassische (statische) Bestellmengenmodell?
Das klassische Modell (nach Harris und Andler) basiert auf vereinfachenden Annahmen wie konstantem Bedarf und Null-Lagerbeständen am Ende des Planungszeitraums. Es ermittelt die optimale Bestellmenge durch die Minimierung der Kosten für Lagerhaltung und Bestellung. Die Ableitung der optimalen Bestellmenge wird anhand von Kostenfunktionen und grafisch dargestellt.
Welche Bedeutung haben dynamische Verfahren?
Dynamische Verfahren berücksichtigen schwankende Bedarfe im Gegensatz zum statischen Modell. Sie unterteilen den Planungshorizont in Perioden und ermöglichen eine optimierte Bestellmengenplanung für jeden Zeitraum.
Wie werden stochastische Modelle behandelt?
Der Ausgangstext erwähnt stochastische Modelle nur in der Überschrift eines Kapitels. Es ist jedoch zu erwarten, dass dieses Kapitel Modelle beschreibt, die Unsicherheiten im Bedarf berücksichtigen und Methoden zur Bestimmung von Sicherheitsbeständen zur Vermeidung von Fehlmengen erläutert.
Welche Kostenfaktoren spielen eine Rolle?
Die Hauptkostenfaktoren sind Lagerhaltungskosten und Bestellkosten. Materialkosten werden aufgrund der Annahme konstanter Preise als irrelevant betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Deterministische Modelle, 3. Stochastische Lagerhaltungsmodelle und 4. Einsatzgebiete der Verfahren.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist der Vergleich verschiedener Verfahren zur Bestellmengenermittlung und die Erläuterung ihrer Anwendbarkeit in der Praxis. Es soll ein Verständnis für die zugrundeliegenden Annahmen und die Herausforderungen bei der Anwendung der Modelle geschaffen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bestellmengenermittlung, wirtschaftliche Bestellmenge, deterministische Modelle, stochastische Modelle, Lagerhaltungskosten, Bestellkosten, dynamisches Programmieren, Heuristiken, optimale Losgröße, Sägezahnkurve, Kostenminimierung.
Welche Extrempolitiken werden im Zusammenhang mit der Bestellmengenermittlung erwähnt?
Es werden zwei Extrempolitiken beschrieben: den Gesamtbedarf auf einmal zu bestellen und die bedarfsgenaue Bestellung. Beide Ansätze haben jeweils Nachteile, die die Notwendigkeit optimaler Modelle unterstreichen.
- Citation du texte
- Oliver Polke (Auteur), 2004, Verfahren zur Bestellmengenermittlung im Vergleich: Modelle, Funktionsweise und Einsatzgebiete (Beispiele), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27744