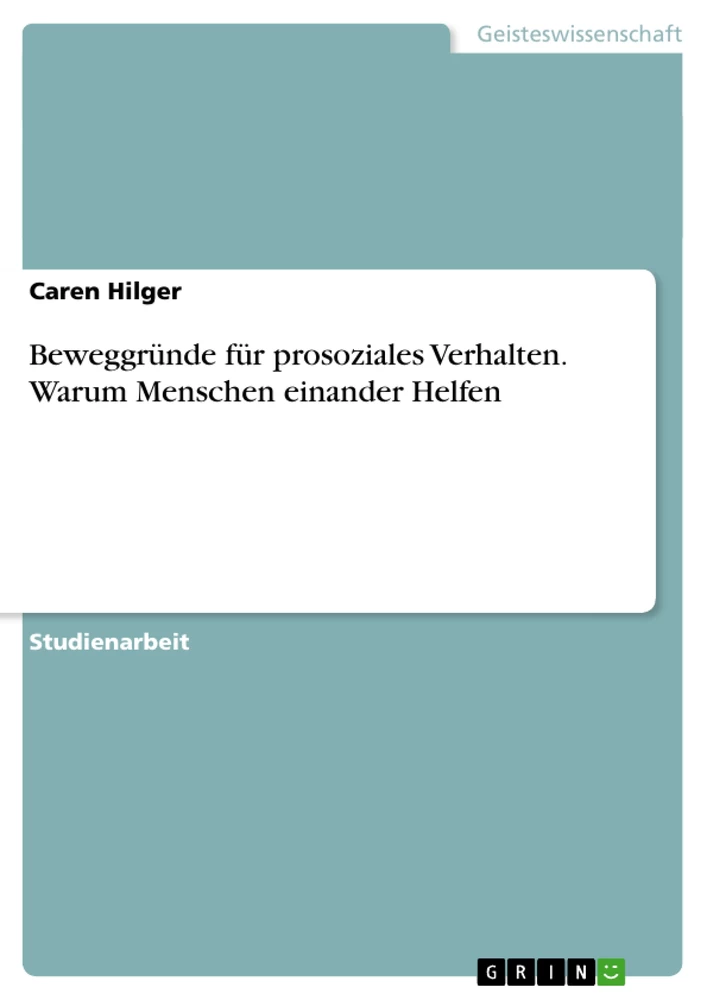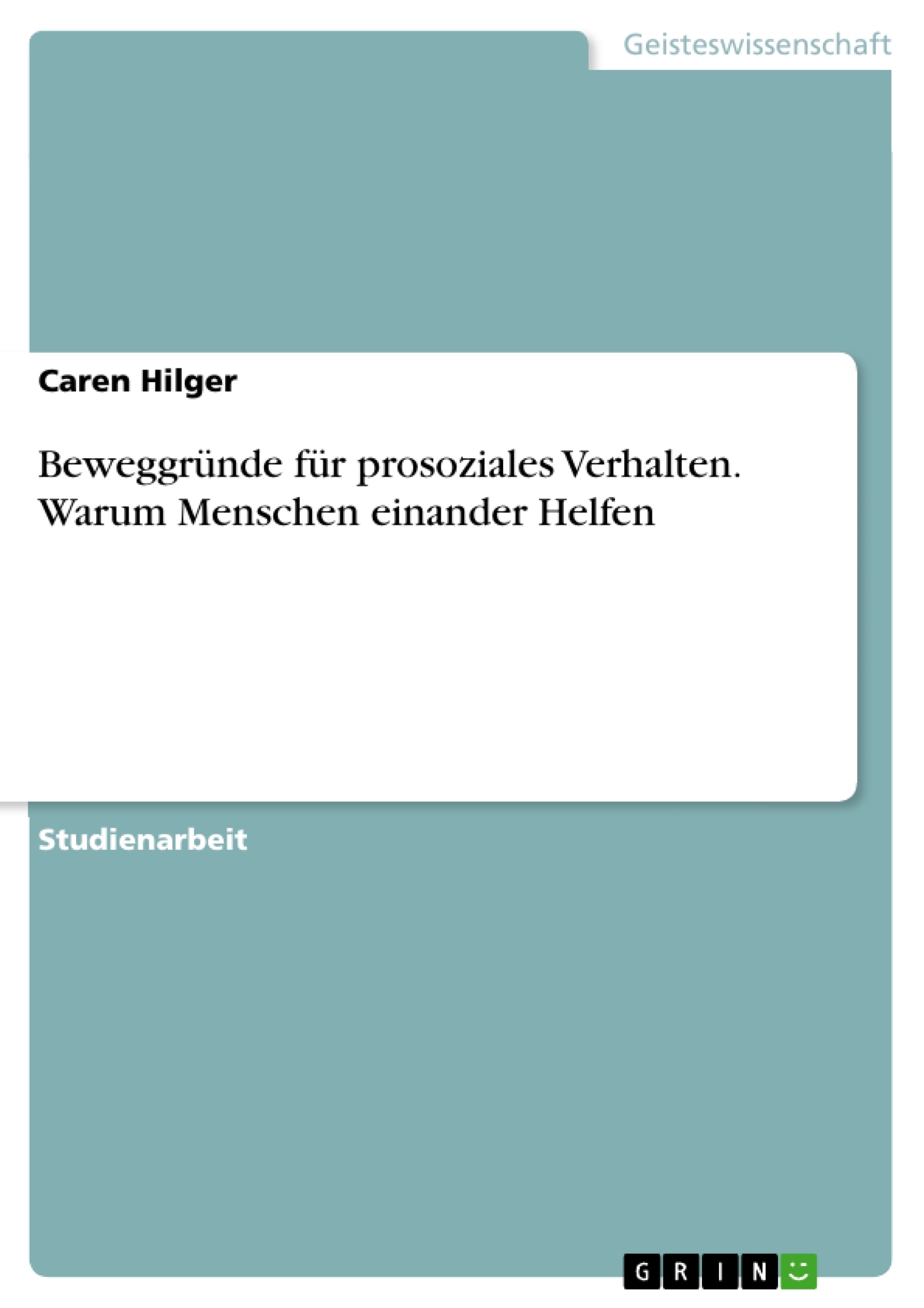Dass Menschen sich gegenseitig helfen, lässt sich im Alltag oft beobachten, z. B. [...] wenn ein jüngerer Mensch einem Senioren die Einkaufstüten trägt. Neben solchen alltäglichen Hilfestellungen gibt es aber noch viele weitere Arten, in denen sich Hilfeverhalten äußern kann: Menschen können einander darüber hinaus beispielsweise psychologische (z. B. einer anderen Person zuhören) und logistische Hilfe, was die Bereitstellung finanzieller und anderer Mittel meint (z. B. Geld- oder Textilspenden), leisten (Prof. Dr. A. Gerlach, Vorlesung „Klinische Psychologie I“, 18.04.2012). Eine weitere Form von Hilfeverhalten ist freiwilliges soziales Engagement. Seit Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland im Jahr 2011 kann man [...] im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes soziale Arbeit leisten. Informationen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zufolge, war die Nachfrage für die ersten 35.000 eingerichteten Plätze so groß, dass diese Zahl nun aufgestockt werden soll (BAFzA, 2012). Dieses Beispiel veranschaulicht, dass Menschen offenbar eine starke Tendenz aufweisen, einander zu helfen. Schließlich können Menschen sich auch durch akute Krisenintervention gegenseitig unterstützen. Dies geschah z. B. im Jahr 2005 nachdem der Hurrikan „Katrina“ auf die Golfküste der USA traf und dort breite Flächen des Landes, vor allem aber die Stadt New Orleans, zerstörte und viele Menschen anreisten, um vor Ort Hilfe zu leisten (z.B. Ehrhardt, 2005). Auch nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 fuhren viele freiwillige Helfer in das Land um z.B. bei der Suche nach verschütteten Personen oder bei der Versorgung der Opfer, vor allem mit Trinkwasser, hilfreich zu sein (z.B. Wild & Das Gupta, 2010). [...]
In der Psychologie werden solche Handlungsweisen, bei denen Menschen anderen Individuen Hilfe leisten, unter dem Begriff des „prosozialen Verhaltens“ zusammengefasst. [...] Nun stellt sich die Frage, warum Menschen zu prosozialem Verhalten neigen und einander helfen. Gegenstand dieser Hausarbeit sind die Beweggründe prosozialen Verhaltens. Dabei werden verschiedene Erklärungsansätze für dieses Phänomen betrachtet. [...]
Letztendlich postulieren neuere Theorien (Iredale, Van Vugt & Dunbar, 2008), dass altruistisches Hilfeverhalten eine wichtige Rolle im Kontext der Partnerwahl zukommen würde: Demnach würden vor allem Männer anderen Individuen aus selbstlosen Gründen helfen, um potentielle Partner des anderen Geschlechts zu beeindrucken.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Grundlegende Theorien Prosozialen Verhaltens
- Negative-State-Relief
- Empathie und Altruismus
- Gegenüberstellung beider Ansätze
- Neuere Ansätze zur Erklärung prosozialen Verhaltens
- Resumé
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beweggründe für prosoziales Verhalten, also warum Menschen einander helfen. Ziel ist es, verschiedene theoretische Ansätze zu diesem Phänomen zu beleuchten und zu vergleichen.
- Negative-State-Relief-Theorie
- Empathie-Altruismus-Hypothese
- Evolutionäre Perspektiven auf prosoziales Verhalten im Kontext der Partnerwahl
- Verschiedene Formen prosozialen Verhaltens (alltägliche Hilfe, freiwilliges Engagement, Krisenintervention, Hilfe unter Lebensgefahr)
- Empirische Belege für die verschiedenen Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema prosoziales Verhalten ein und illustriert dessen Vielfältigkeit anhand von Beispielen, die von alltäglichen Hilfestellungen bis hin zu lebensgefährdenden Eingriffen reichen. Sie verdeutlicht die weitreichende Bedeutung des Phänomens und leitet zur zentralen Fragestellung nach den Beweggründen für prosoziales Handeln über. Die verschiedenen Formen des Hilfeverhaltens, vom Wegweiser bis zur Organspende, werden vorgestellt und bilden die Grundlage für die anschließende theoretische Auseinandersetzung.
Grundlegende Theorien Prosozialen Verhaltens: Dieses Kapitel präsentiert zwei grundlegende Theorien, die das prosoziale Verhalten zu erklären versuchen. Die „Negative-State-Relief“-Theorie postuliert, dass Hilfeleistung egoistisch motiviert ist und der Verbesserung der eigenen Stimmung dient. Im Gegensatz dazu betont die Empathie-Altruismus-Hypothese die selbstlose Motivation, das Leid anderer zu lindern, die durch Empathie ausgelöst wird. Der Abschnitt endet mit einer Gegenüberstellung der beiden Ansätze, ihre Stärken und Schwächen vergleichend und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinweisend.
Neuere Ansätze zur Erklärung prosozialen Verhaltens: Dieses Kapitel beleuchtet neuere Theorien, die einen evolutionären Ansatz verfolgen. Hier wird die Rolle von altruistischem Verhalten im Kontext der Partnerwahl diskutiert, wobei insbesondere der Einfluss auf die Partnerfindung bei Männern betont wird. Die Integration evolutionärer Perspektiven erweitert das Verständnis von prosozialem Verhalten um einen wichtigen Aspekt.
Schlüsselwörter
Prosoziales Verhalten, Negative-State-Relief, Empathie, Altruismus, Partnerwahl, Evolutionäre Psychologie, Hilfeverhalten, Selbstlosigkeit, Egoismus, freiwilliges Engagement, Krisenintervention.
Häufig gestellte Fragen zu: Prosoziales Verhalten - Eine umfassende Übersicht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Theorien und Ansätze zum Verständnis prosozialen Verhaltens. Sie beinhaltet eine Zusammenfassung, Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Beweggründe menschlichen Hilfeverhaltens.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Negative-State-Relief-Theorie und die Empathie-Altruismus-Hypothese als grundlegende Erklärungsansätze für prosoziales Verhalten. Zusätzlich werden neuere, evolutionäre Perspektiven, insbesondere im Kontext der Partnerwahl, beleuchtet. Die verschiedenen Theorien werden verglichen und ihre Stärken und Schwächen diskutiert.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themenschwerpunkte sind die unterschiedlichen Motivationen hinter prosozialem Handeln (egoistisch vs. altruistisch), die Rolle von Empathie und die Bedeutung evolutionärer Faktoren. Die Arbeit untersucht verschiedene Formen prosozialen Verhaltens, von alltäglicher Hilfe bis hin zu lebensgefährdenden Eingriffen, und beleuchtet diese anhand empirischer Belege.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: eine Einleitung, ein Kapitel zu grundlegenden Theorien (Negative-State-Relief und Empathie-Altruismus), ein Kapitel zu neueren Ansätzen (evolutionäre Perspektiven) und abschließende Resümees und Literaturangaben. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis bietet eine Übersicht über die einzelnen Abschnitte.
Welche Arten von prosozialem Verhalten werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet eine Bandbreite an prosozialem Verhalten, von alltäglichen Hilfestellungen (z.B. Wegweisung) über freiwilliges Engagement bis hin zu Krisenintervention und Hilfe unter Lebensgefahr (z.B. Organspende). Diese Vielfalt an Beispielen unterstreicht die Komplexität des Phänomens.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Prosoziales Verhalten, Negative-State-Relief, Empathie, Altruismus, Partnerwahl, Evolutionäre Psychologie, Hilfeverhalten, Selbstlosigkeit, Egoismus, freiwilliges Engagement und Krisenintervention.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen theoretischen Ansätze zum Verständnis von prosozialem Verhalten zu beleuchten und zu vergleichen. Sie soll ein umfassendes Bild der Beweggründe menschlichen Hilfeverhaltens liefern und die unterschiedlichen Perspektiven auf dieses komplexe Phänomen aufzeigen.
- Quote paper
- Caren Hilger (Author), 2012, Beweggründe für prosoziales Verhalten. Warum Menschen einander Helfen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276449