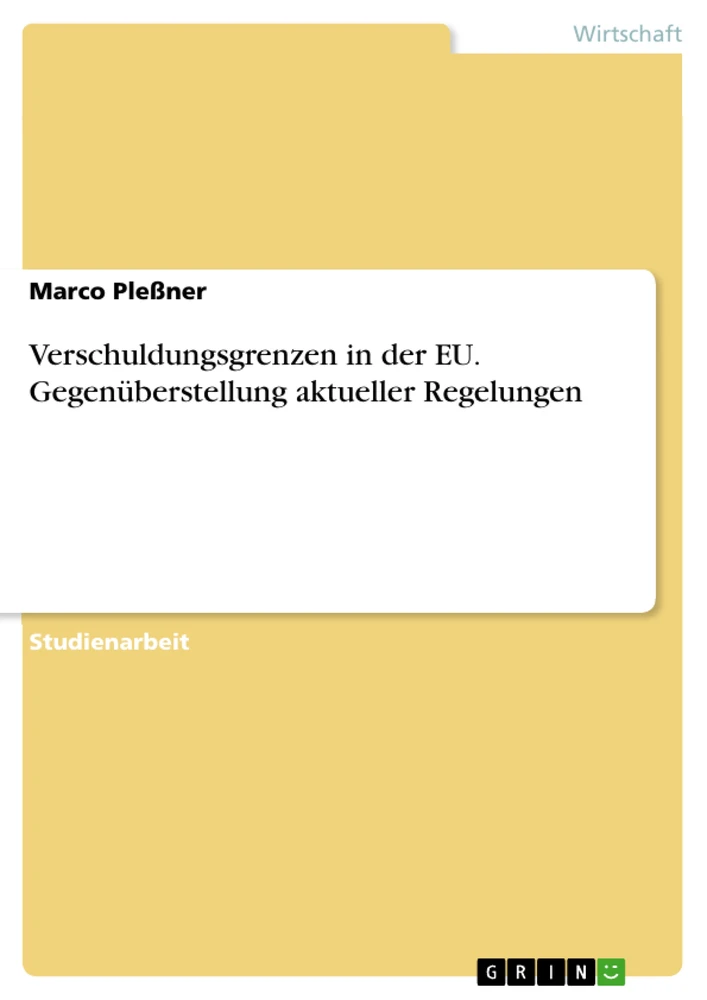Das Thema Staatsverschuldung rutscht auf der Prioritätenskala der Gesamtbevölkerung nicht zuletzt seit Ausbruch der globalen Finanzkrise und der Griechenland-Krise stetig nach oben. Nebst aufgrund krisenbedingter fiskalpolitischer Intervention stark negativen öffentlichen Finanzierungssalden und wachsenden Schuldenbergen weltweit, welche das öffentliche Interesse stark anwachsen ließen, führt eine aktuelle Studie von Reinhart und Rogoff den Nachweis, dass sich das Wachstum entwickelter Volkswirtschaften deutlich verlangsamt, wenn die Schuldenstandquote, also der Schuldenstand in Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), 90% übersteigt (Reinhart/Rogoff 2010, S. 2f.). Selten gelingt es Ländern, aus diesen hohen Schulden aus eigener Kraft „herauszuwachsen“. Bereits Adam Smith mahnte das seines Erachtens leichtfertige Anhäufen enormer Schuldenstände europäischer Nationen im 18. Jahrhundert in seinem Hauptwerk „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ an (Smith 2005, S. 753), obschon deren quantitative Dimension im Vergleich mit den rezenten Schuldenständen eher gering erscheint.
In der finanzwissenschaftlichen Literatur wird daher stets auf die Wichtigkeit effektiver Verschuldungsregeln zur Herstellung fiskalischer Disziplin hingewiesen (vgl. Alesina/Perotti 1996, S. 401ff.). Verfassungen vieler Länder und Wirtschaftsräume verfügen bereits über derartige Restriktionen. Haushalte, welche nicht kompatibel mit den im Gesetz kodifizierten Verschuldungsregeln sind, sollten weder vom Parlament verabschiedet noch von der Regierung ausgeführt werden (Bischoff/Gohout 2009, S. 2).
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen ausgewählte Verschuldungsregeln in der EU einer vergleichenden Analyse unterzogen werden. Nach einer knappen Darstellung von Gründen für die Notwendigkeit von Verschuldungsgrenzen stehen die finanzpolitischen Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Kapitel 3), die im Jahr 2003 in Kraft getretene Schweizer Schuldenbremse (Kapitel 4) und die deutsche Schuldenbremse (Kapitel 5), welche Verfassungscharakter hat und das Verschuldungsverhalten von Bund und Ländern ab 2016 resp. 2020 regulieren soll, im Fokus. Die Funktionsweisen sowie Vor- und Nachteile der jeweiligen Regelungen werden zunächst separat untersucht und in Kapitel 6 mit Blick auf zentrale Kriterien wie Symmetrie, Flexibilität, Transparenz, Komplexität und Effektivität einander gegenübergestellt. Schließlich wird die Analyse durch ein Fazit abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gründe für die Notwendigkeit von Verschuldungsgrenzen
- Zum Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Die Konvergenzkriterien
- Ausgewählte Kritikpunkte
- Zur schweizerischen Schuldenbremse
- Der Mechanismus der Schuldenbremse
- Bisherige Erfahrungen und Probleme
- Zur deutschen Schuldenbremse
- Die Konzeption der Föderalismuskommission II
- Prognosen und Kritik
- Vor- und Nachteile der Regelungen im Vergleich
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Versicherung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Analyse von Verschuldungsregeln in der EU. Ziel ist es, verschiedene Regelungen im Hinblick auf ihre Funktionsweise, Vor- und Nachteile zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit von Verschuldungsgrenzen und analysiert die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Schweizer Schuldenbremse und die deutsche Schuldenbremse.
- Notwendigkeit von Verschuldungsgrenzen
- Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Schweizer Schuldenbremse
- Deutsche Schuldenbremse
- Vergleich der Regelungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Staatsverschuldung ein und erläutert die Relevanz von Verschuldungsregeln. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der Staatsverschuldung in der EU und weltweit sowie die Bedeutung fiskalischer Disziplin.
Das zweite Kapitel behandelt die Gründe für die Notwendigkeit von Verschuldungsgrenzen. Es werden die Risiken hoher Staatsverschuldung und die Bedeutung von fiskalischer Stabilität für das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes dargestellt.
Kapitel 3 analysiert den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der die finanzpolitischen Kriterien für die Mitgliedstaaten der EU festlegt. Es werden die Konvergenzkriterien und die Kritikpunkte an dem Pakt diskutiert.
Kapitel 4 befasst sich mit der schweizerischen Schuldenbremse, die im Jahr 2003 in Kraft getreten ist. Es werden der Mechanismus der Schuldenbremse und die bisherigen Erfahrungen und Probleme erläutert.
Kapitel 5 analysiert die deutsche Schuldenbremse, die Verfassungscharakter hat und das Verschuldungsverhalten von Bund und Ländern ab 2016 resp. 2020 regulieren soll. Es werden die Konzeption der Föderalismuskommission II und die Prognosen und Kritikpunkte zur deutschen Schuldenbremse dargestellt.
Kapitel 6 vergleicht die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verschuldungsregeln im Hinblick auf Kriterien wie Symmetrie, Flexibilität, Transparenz, Komplexität und Effektivität.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Staatsverschuldung, Verschuldungsgrenzen, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Schweizer Schuldenbremse, deutsche Schuldenbremse, fiskalische Disziplin, Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Konvergenzkriterien, Symmetrie, Flexibilität, Transparenz, Komplexität und Effektivität.
- Quote paper
- Marco Pleßner (Author), 2010, Verschuldungsgrenzen in der EU. Gegenüberstellung aktueller Regelungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276368