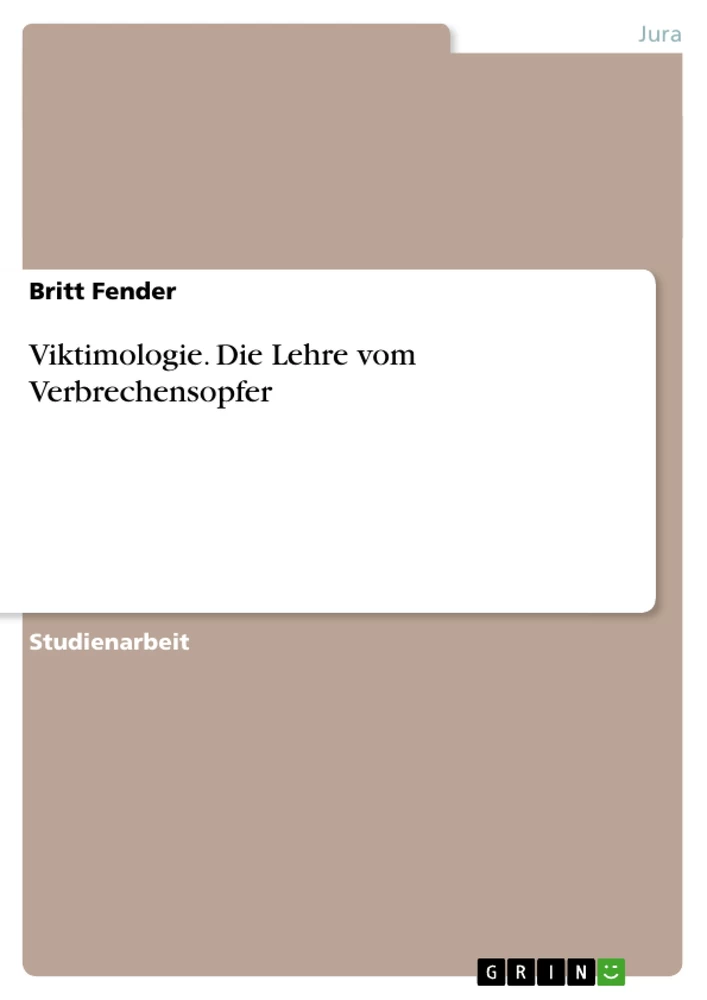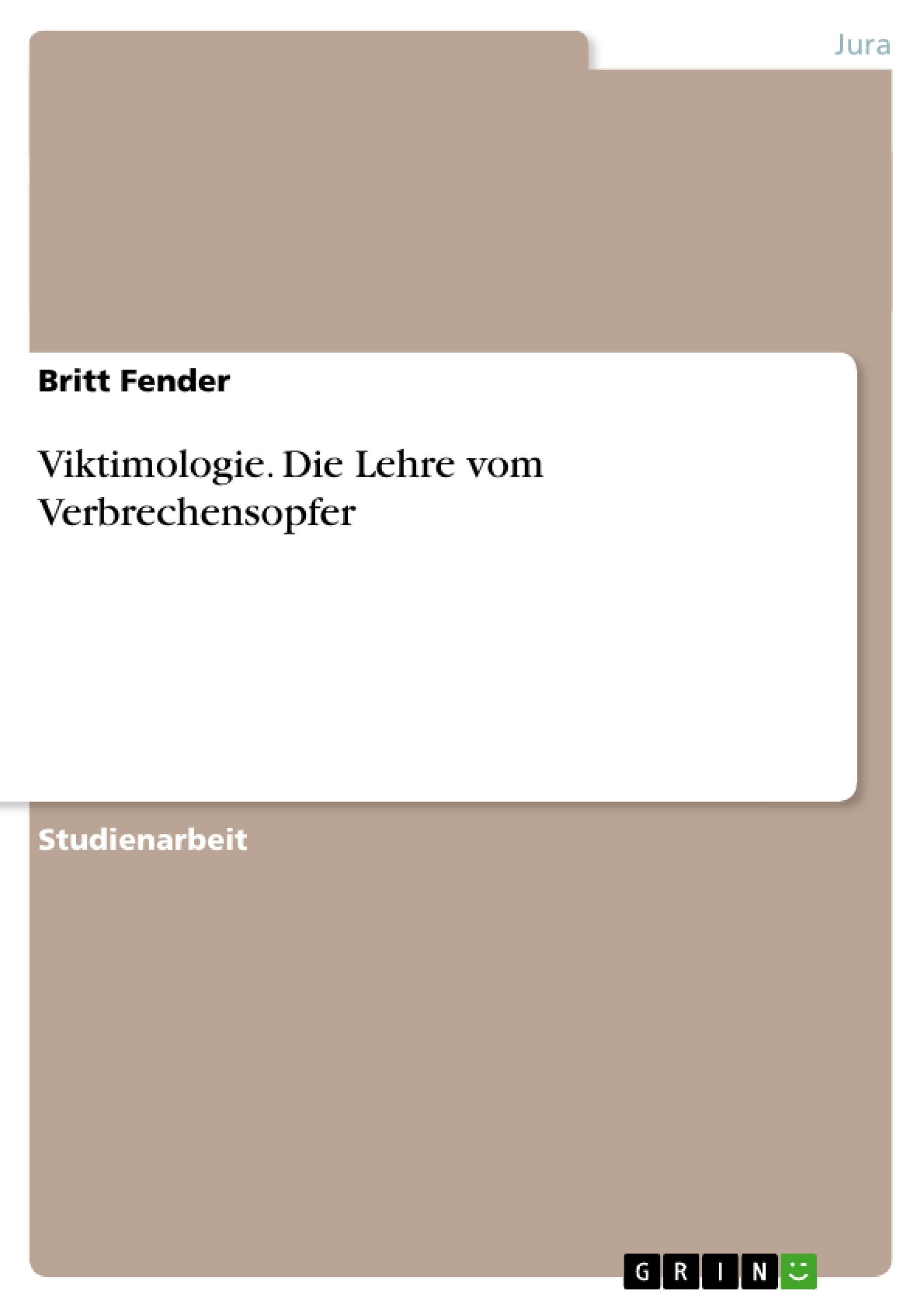Diese wissenschaftliche Arbeit bietet einen umfangreichen Überblick über das Gebiet der Viktomologie. Sie klärt zentrale Fragen und geht unter anderem auf den aktuellen Forschungsstand, Typologien, Erhebungsmethoden, etc. ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition
- 1.1 Der Opferbegriff
- 2. Historie
- 3. Aufgabengebiete der Viktimologie
- 3.1 Viktimisierungstheorien
- 3.1.1 Opfertypologien
- 3.1.2 Opferschädigungen
- 3.1 Viktimisierungstheorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Viktimologie, der Lehre vom Opfer. Ziel ist es, den Opferbegriff zu definieren, die historische Entwicklung der Viktimologie nachzuzeichnen und die zentralen Aufgabenfelder dieser Disziplin darzustellen. Besondere Aufmerksamkeit wird den verschiedenen Viktimisierungstheorien und Opfertypologien gewidmet.
- Definition des Opferbegriffs und seine vielschichtigen Aspekte
- Historische Entwicklung der Viktimologie und ihre Etablierung als (Teil-)Disziplin
- Hauptaufgabenfelder der Viktimologie, einschließlich Ursachsenforschung und Prävention
- Analyse verschiedener Viktimisierungstheorien
- Untersuchung von Opfertypologien und deren Einteilung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Viktimologie als Lehre vom Opfer und diskutiert die Debatte um ihren Status als eigenständige Disziplin oder Teilbereich der Kriminologie. Es betont den interdisziplinären Charakter der Viktimologie und ihren engen Bezug zu anderen Disziplinen wie Kriminologie, Kriminalsoziologie, Psychologie und Strafrechtswissenschaft. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Opferwerdung, den Beziehungen zwischen Täter und Opfer, dem Anzeigeverhalten und den Folgen der Viktimisierung. Der Kapitelteil zum Opferbegriff erörtert die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs und die Herausforderungen bei seiner Abgrenzung, insbesondere im Hinblick auf subjektiven und objektiven Schaden, kollektive Opfer und die Frage der Mitschuld.
2. Historie: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Viktimologie, die lange Zeit vom Entschädigungsgedanken geprägt war. Es verfolgt die Entwicklung von Vergeltungs- und Rachepraktiken hin zu Entschädigungsansätzen, beginnend bei den Babyloniern und Hebräern bis hin zu antiken Kulturen und germanischem Recht. Das Kapitel schildert frühe kriminologische Ansätze zur Betrachtung des Opfers, darunter die Werke von Feuerbach, Hess, Milovanovic und Roesner. Es hebt hervor, dass die Viktimologie erst nach dem Zweiten Weltkrieg als eigenständige Forschungsrichtung an Bedeutung gewann, mit frühen, differenzierten Ansätzen von Hans von Hentig. Der Aufstieg der Viktimologie in den 1970er Jahren und die Rolle von Persönlichkeiten wie Mendelsohn, Ellenberger, Conril, Schafer und Fattah werden ebenfalls diskutiert, wobei der Beitrag von Hans von Hentig als besonders bedeutend hervorgehoben wird. Die Etablierung der Viktimologie wird mit dem ersten Internationalen Symposium für Viktimologie 1973 in Jerusalem markiert.
3. Aufgabengebiete der Viktimologie: Dieses Kapitel beschreibt die vielseitigen Aufgaben der Viktimologie, mit besonderem Fokus auf die Ursachsenforschung der Opferwerdung. Es betont die Notwendigkeit, Täter, Opfer und Gesellschaft in ihrem Zusammenwirken zu analysieren, um die Entstehung von Verbrechen zu verstehen. Die Viktimogenese, die Untersuchung der Entstehung des Opfers, wird als umfassender Prozess dargestellt, der Persönlichkeitsmerkmale, Beziehungen und den sozialen Nahraum einbezieht. Das Kapitel beleuchtet den Präventionsgedanken, der aus der Analyse von Opferdispositionen und -situationen resultiert. Weitere Aufgabenfelder umfassen die Erforschung der Anzeigebereitschaft, des Dunkelfeldes, der Mitwirkungsrechte und -pflichten des Opfers im Strafverfahren, sowie des Opferschutzes und der Schadenswiedergutmachung. Der Beitrag der Viktimologie zur Verbrechensbekämpfung und zur Strafzumessung wird ebenfalls hervorgehoben.
3.1 Viktimisierungstheorien: Dieses Kapitel befasst sich mit der Vielfalt der viktimologischen Theorien und Methoden zur Erforschung der Opferwerdung. Es betont, dass keine einzelne Theorie alle Viktimisierungsprozesse vollständig erklären kann. Der Fokus liegt auf Opfertypologien und deren praktische und theoretische Bedeutung für die Verbrechens-prävention. Es werden verschiedene Typologien vorgestellt, unter anderem die von Hans von Hentig (mit verschiedenen Varianten), Mendelsohn und Ezzat Abdel Fattah. Diese Typologien werden im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Klassifizierungskriterien und die jeweilige Gewichtung von Opferverhalten und Mitschuld analysiert. Zusätzlich wird die Typologie von Schultz vorgestellt, die verschiedene Beteiligungsarten des Opfers an der Tat unterscheidet. Der Abschnitt zu Opferschädigungen behandelt primäre, sekundäre und tertiäre Viktimisierung und die vielschichtigen Folgen für die psychische, physische, soziale, weltanschauliche und ökonomische Situation des Opfers. Die Bedeutung von Langzeitstudien zur Erforschung von Spät- und Frühschäden wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Viktimologie, Opfer, Opferwerdung, Viktimisierung, Täter-Opfer-Beziehung, Opfertypologien, Opferschädigungen, Prävention, Anzeigebereitschaft, Dunkelfeld, Strafverfahren, Kriminologie, Kriminalsoziologie, Psychologie, Strafrechtswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Viktimologie: Eine Einführung"
Was ist der Gegenstand der Viktimologie?
Die Viktimologie befasst sich mit dem Opfer von Straftaten. Sie untersucht den Opferbegriff, die historische Entwicklung des Verständnisses von Opfern, die Aufgabenfelder der Disziplin und verschiedene Theorien der Viktimisierung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Opfertypologien und den Schädigungen, die Opfer erleiden.
Wie ist der Opferbegriff definiert und welche Aspekte sind wichtig?
Der Opferbegriff ist vielschichtig und wird im Text ausführlich diskutiert. Es werden die Herausforderungen bei der Abgrenzung des Begriffs beleuchtet, einschließlich subjektiven und objektiven Schadens, kollektiver Opfer und der Frage der Mitschuld. Der Prozess der Opferwerdung, die Beziehung zwischen Täter und Opfer und die Folgen der Viktimisierung werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche historische Entwicklung hat die Viktimologie durchlaufen?
Die Viktimologie hat eine lange Geschichte, die von Vergeltungs- und Rachepraktiken bis hin zu Entschädigungsansätzen reicht. Der Text verfolgt diese Entwicklung von den Babyloniern und Hebräern über antike Kulturen und germanisches Recht bis hin zur Etablierung als eigenständige Forschungsrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wichtige Persönlichkeiten wie Hans von Hentig, Mendelsohn, Ellenberger, Conril, Schafer und Fattah werden genannt, wobei Hentigs Beitrag besonders hervorgehoben wird. Die Gründung des ersten Internationalen Symposiums für Viktimologie 1973 in Jerusalem markiert einen wichtigen Meilenstein.
Welche Aufgabenfelder umfasst die Viktimologie?
Die Viktimologie hat vielfältige Aufgabenfelder. Wichtige Bereiche sind die Ursachsenforschung der Opferwerdung (Viktimogenese), die Analyse von Täter-Opfer-Beziehungen, Prävention, die Erforschung der Anzeigebereitschaft und des Dunkelfeldes, die Mitwirkungsrechte und -pflichten des Opfers im Strafverfahren sowie Opferschutz und Schadenswiedergutmachung. Der Beitrag der Viktimologie zur Verbrechensbekämpfung und Strafzumessung wird ebenfalls betont.
Welche Viktimisierungstheorien werden behandelt?
Der Text präsentiert verschiedene viktimologische Theorien und Methoden zur Erforschung der Opferwerdung. Es wird betont, dass keine einzelne Theorie alle Prozesse vollständig erklärt. Der Fokus liegt auf Opfertypologien (u.a. von Hans von Hentig, Mendelsohn, Ezzat Abdel Fattah und Schultz), deren Klassifizierungskriterien und die jeweilige Gewichtung von Opferverhalten und Mitschuld. Der Abschnitt zu Opferschädigungen behandelt primäre, sekundäre und tertiäre Viktimisierung und deren Folgen für die psychische, physische, soziale, weltanschauliche und ökonomische Situation des Opfers.
Welche Schlüsselwörter kennzeichnen die Inhalte des Textes?
Schlüsselwörter umfassen: Viktimologie, Opfer, Opferwerdung, Viktimisierung, Täter-Opfer-Beziehung, Opfertypologien, Opferschädigungen, Prävention, Anzeigebereitschaft, Dunkelfeld, Strafverfahren, Kriminologie, Kriminalsoziologie, Psychologie und Strafrechtswissenschaft.
Welche Kapitel sind im Text enthalten?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: 1. Definition (inkl. 1.1 Der Opferbegriff), 2. Historie und 3. Aufgabengebiete der Viktimologie (inkl. 3.1 Viktimisierungstheorien mit 3.1.1 Opfertypologien und 3.1.2 Opferschädigungen).
- Quote paper
- Sozialpädagogin B.A. Britt Fender (Author), 2014, Viktimologie. Die Lehre vom Verbrechensopfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276234