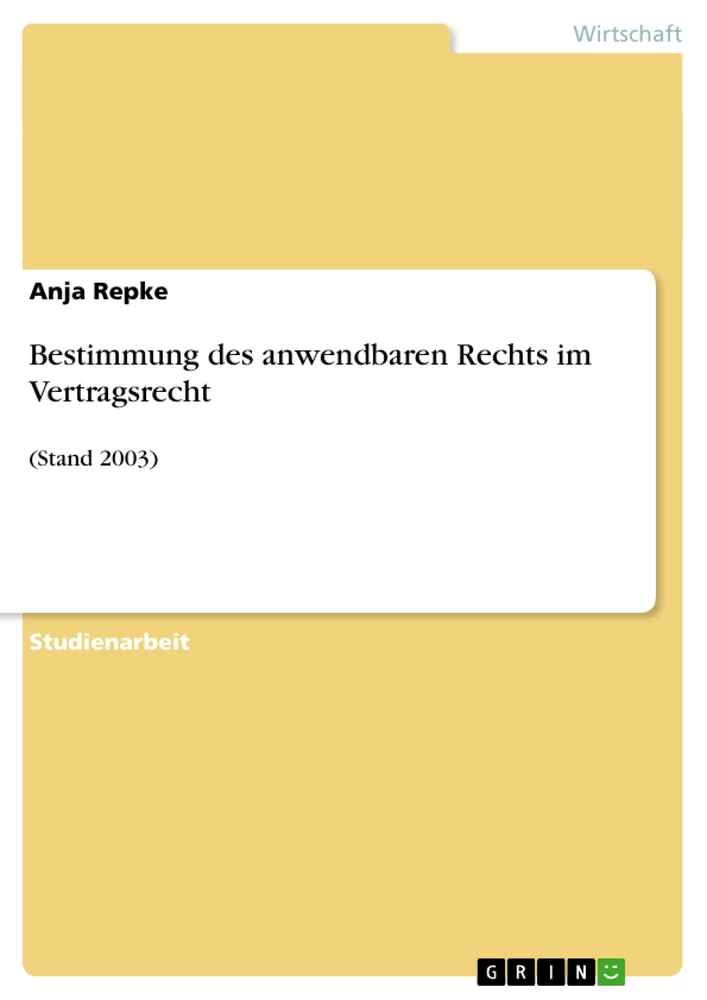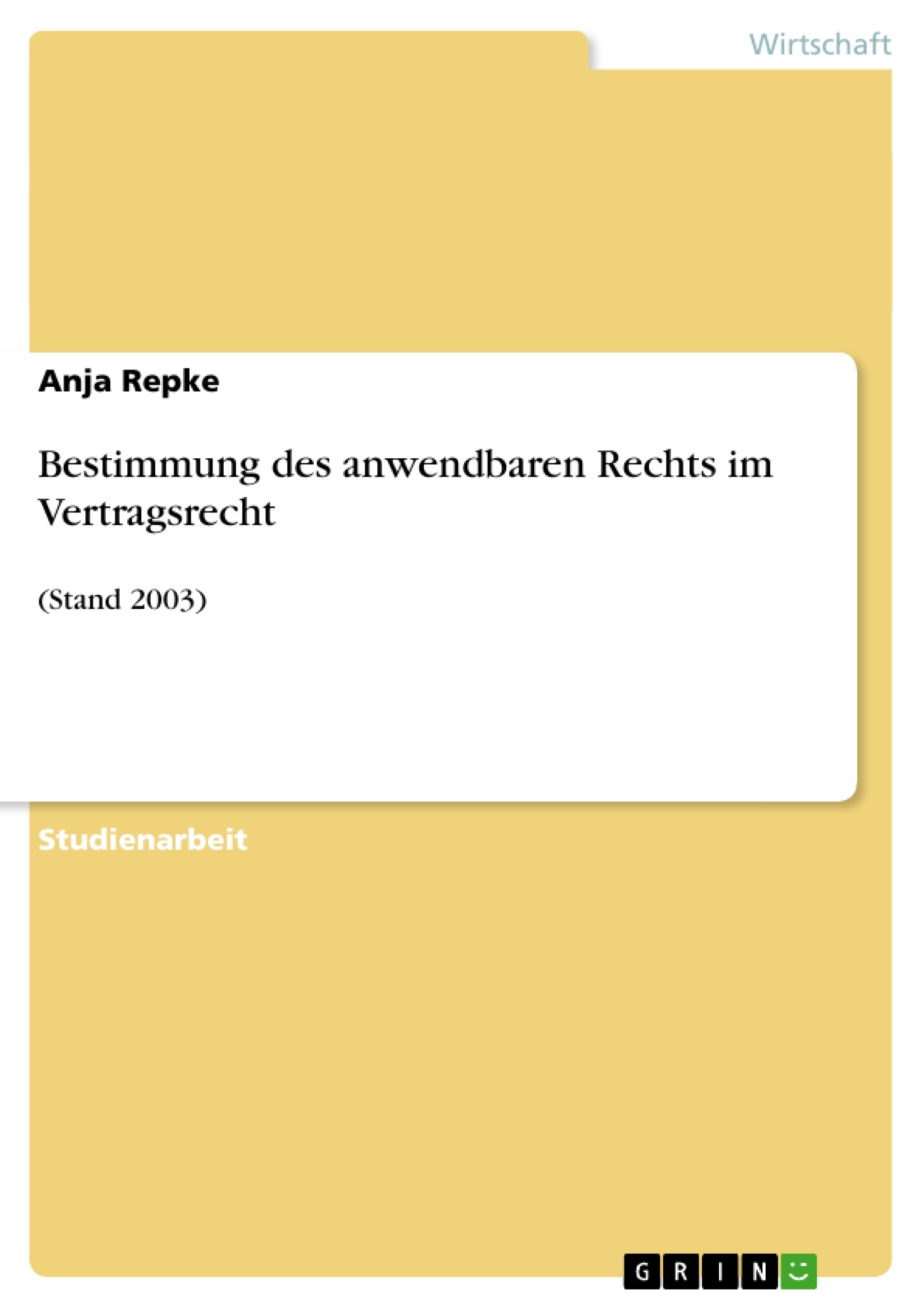Im Zeitalter der Globalisierung und der Europäischen Union, in dem eine multikulturelle Gesellschaft mittlerweile für fast alle Menschen zur Normalität geworden ist, sind Grenzen trotz aller Liberalisierungsmaßnahmen noch nicht auf der Strecke geblieben. Dies schafft vor allem im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr, bei Sachverhalten mit Auslandsbeziehung, die Frage, nach welchem nationalen Recht ein solcher Sachverhalt zu beurteilen ist. Dieses Problem versucht das Internationale Privatrecht, nachfolgend IPR, zu lösen. Dabei handelt es sich grundsätzlich um nationales Recht, das bei einem Sachverhalt mit Auslandsbeziehung, bestimmen soll, welches materielle Recht anwendbar ist. Selbst im vermeintlich grenzenlosen Europa steht eine umfassende Harmonisierung des Zivilrechts noch aus. Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich jedoch nur mit einem Teilbereich des IPR, dem Internationalen Vertragsrecht. Diesem kommt im heutigen Wirtschaftsleben eine essentielle Bedeutung zu, da durch die zunehmende Globalisierung der Anteil der grenzüberschreitenden Verträge ständig zunimmt. Sie stehen somit im Zentrum des internationalen Wirtschaftsverkehrs. Im folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Vorgehensweise zur Ermittlung des anwendbaren Rechts im Bereich des Internationalen Vertragsrechts ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internationales Privatrecht (IPR)
- Exkurs: Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte
- Gesetzliche Grundlagen des IPR
- UN-Kaufrecht (CISG)
- Verordnungen
- Bestimmung des anwendbaren Rechts
- Vertragsstatut
- Rechtswahl (Art. 27 EGBGB)
- Parteiautonomie
- Grenzen der Parteiautonomie
- Ausdrückliche Rechtswahl
- Konkludente Rechtswahl
- Teilrechtswahl
- Nachträgliche Rechtswahl
- Mangels Rechtswahl anwendbares Recht (Art. 28 EGBGB)
- Charakteristische Leistung
- Grundstücksverträge
- Güterbeförderungsverträge
- Engere Verbindung mit einem anderen Staat
- Verträge ohne bestimmbare charakteristische Leistung
- Einschränkungen der Rechtswahl
- Verbraucherverträge (Art. 29 EGBGB)
- Arbeitsverträge (Art. 30 EGBGB)
- Forderungsabtretung (Art. 33 EGBGB)
- Zwingende Vorschriften (Art. 34 EGBGB)
- Sachnormverweisung (Art. 35 EGBGB)
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit einem Teilbereich des Internationalen Privatrechts, dem Internationalen Vertragsrecht. Ziel ist es, die Vorgehensweise zur Ermittlung des anwendbaren Rechts im Bereich des Internationalen Vertragsrechts darzustellen. Dabei wird besonders auf das UN-Kaufrecht (CISG) und die Rechtswahl in grenzüberschreitenden Vertragsbeziehungen eingegangen.
- Gesetzliche Grundlagen des Internationalen Privatrechts
- Bestimmung des anwendbaren Rechts bei Verträgen
- Rechtswahl und ihre Grenzen
- Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts (CISG)
- Einschränkungen der Rechtswahl im internationalen Vertragsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Internationalen Privatrechts (IPR) im Kontext der Globalisierung und des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs. Kapitel 2 erläutert die Grundlagen des IPR, einschließlich der gesetzlichen Grundlagen, Kollisionsnormen und des Vertragsstatuts. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Bestimmung des anwendbaren Rechts bei Verträgen, wobei verschiedene Aspekte der Rechtswahl, wie Parteiautonomie und Grenzen der Rechtswahl, behandelt werden. Kapitel 4 befasst sich mit der Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts (CISG) und den Einschränkungen der Rechtswahl im internationalen Vertragsrecht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Internationalen Privatrecht (IPR), dem Internationalen Vertragsrecht, dem UN-Kaufrecht (CISG), der Rechtswahl, der Parteiautonomie, den Grenzen der Rechtswahl, dem Vertragsstatut, Kollisionsnormen, dem EGBGB und dem EVÜ.
- Arbeit zitieren
- Anja Repke (Autor:in), 2003, Bestimmung des anwendbaren Rechts im Vertragsrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27617